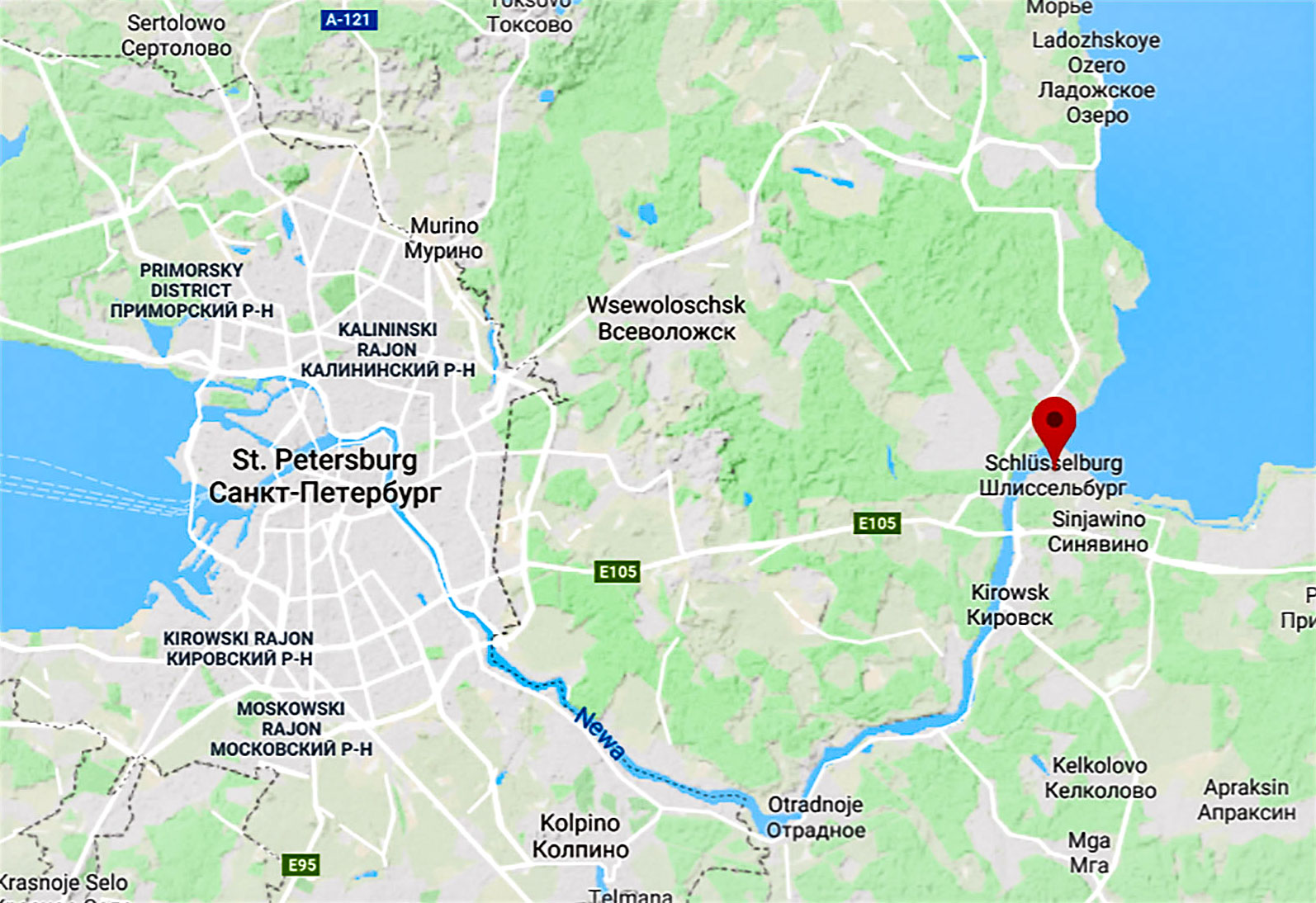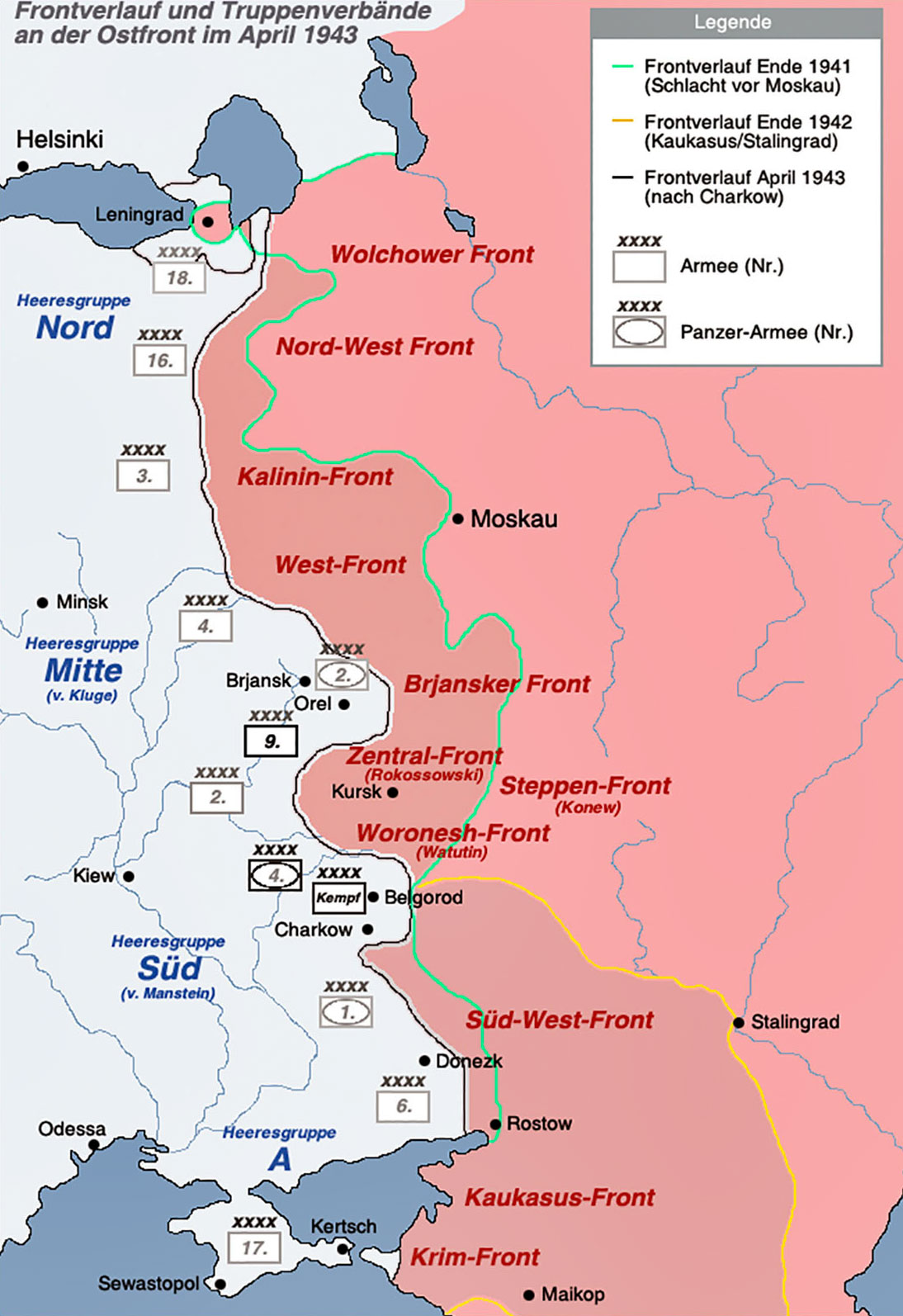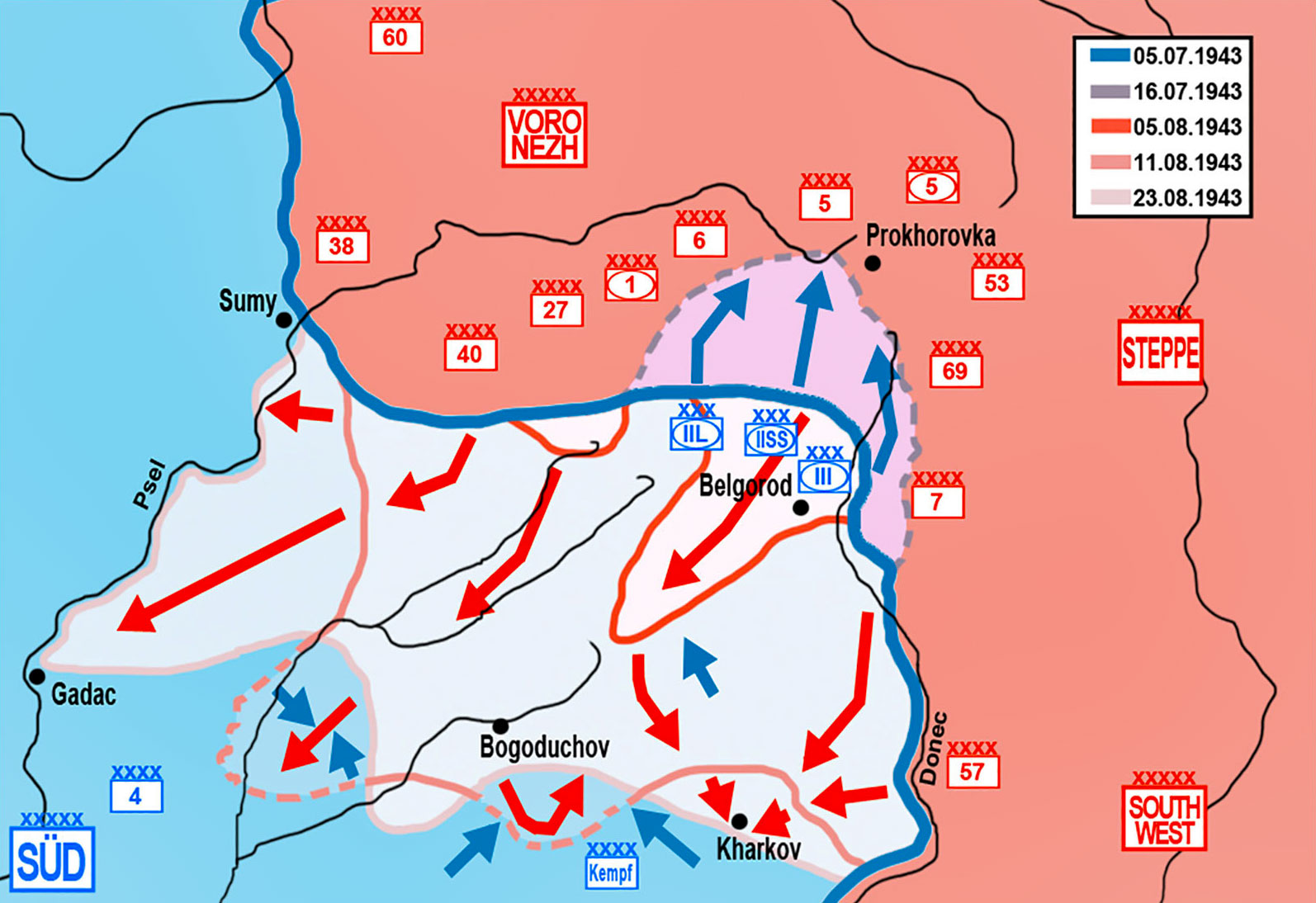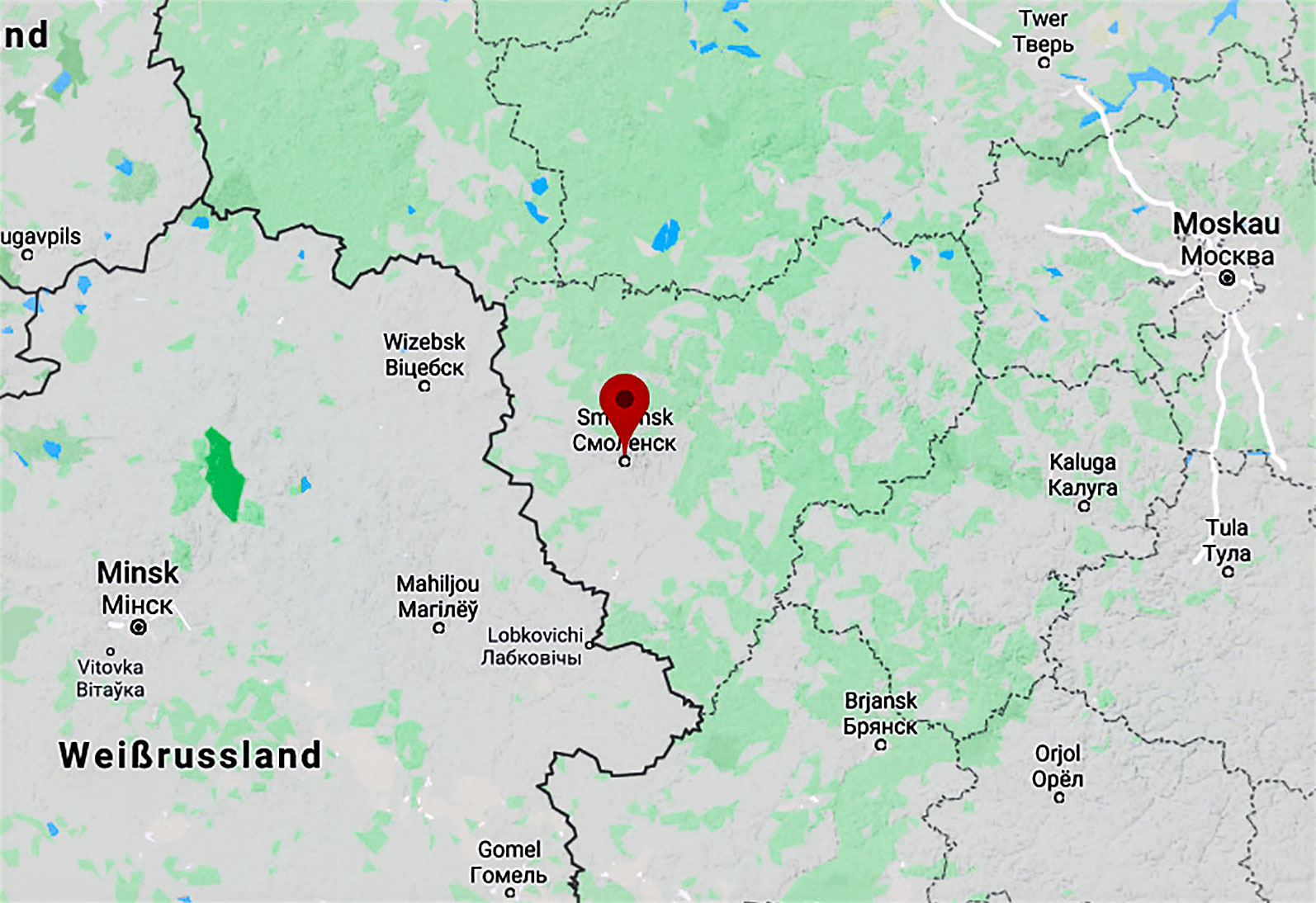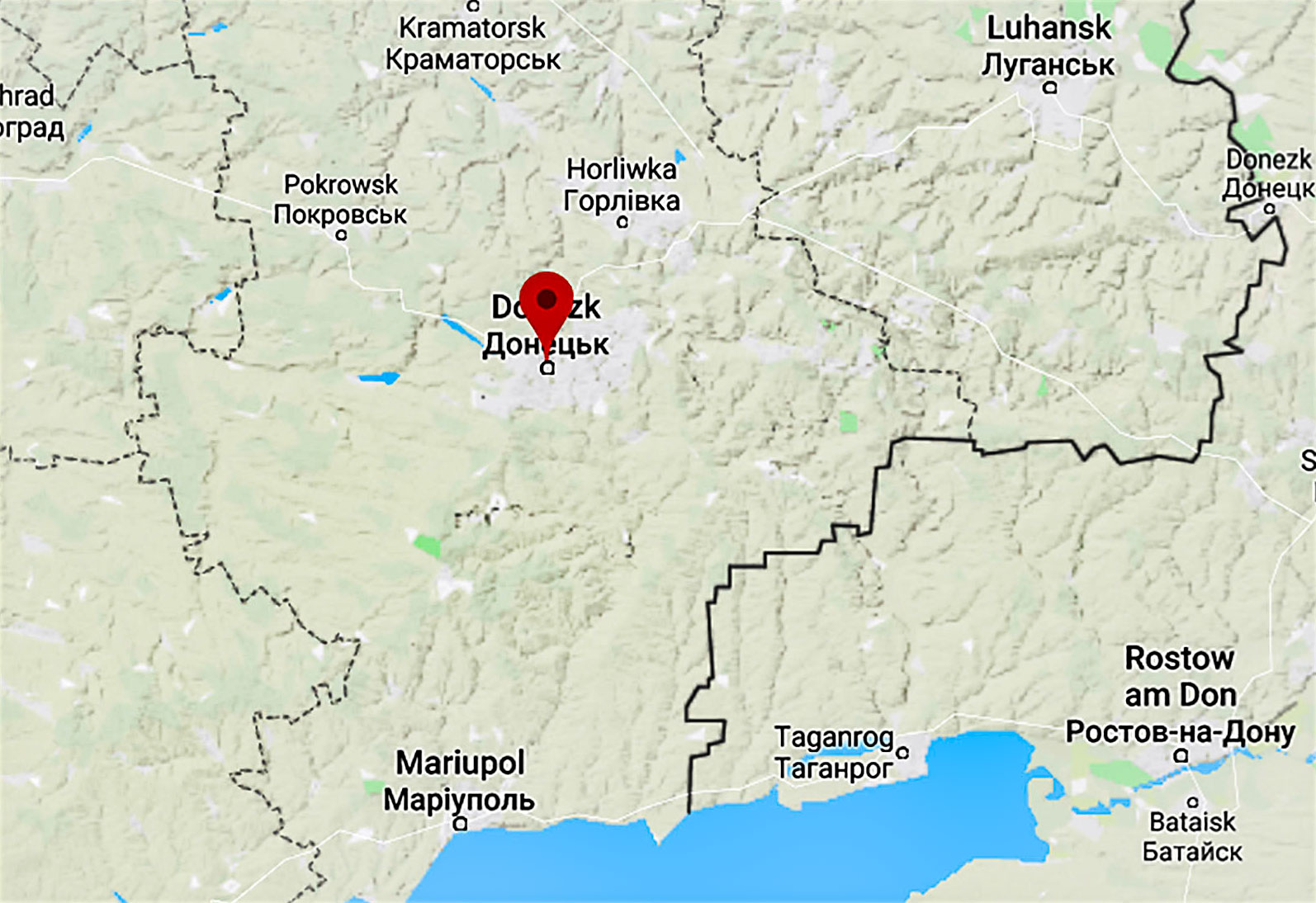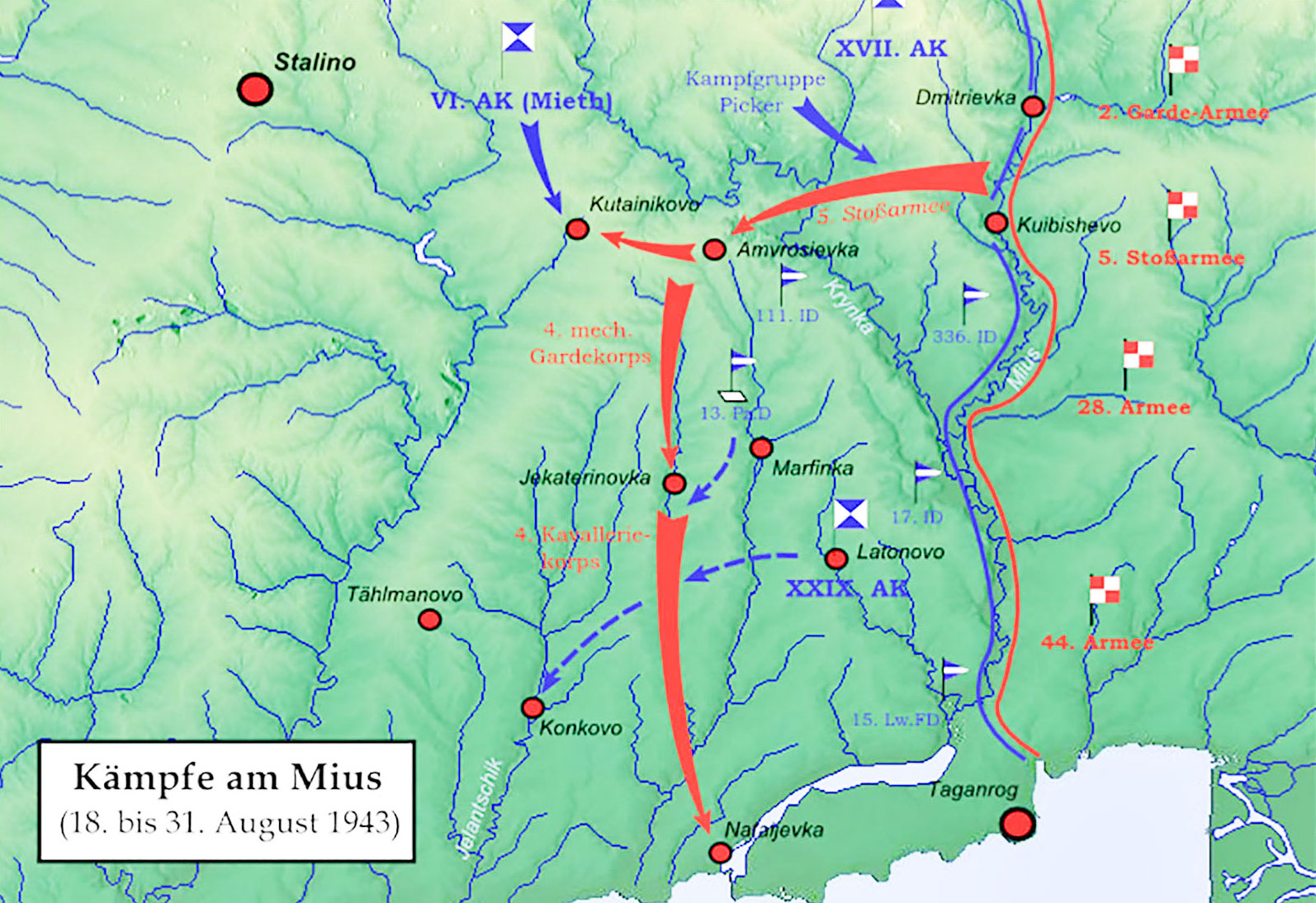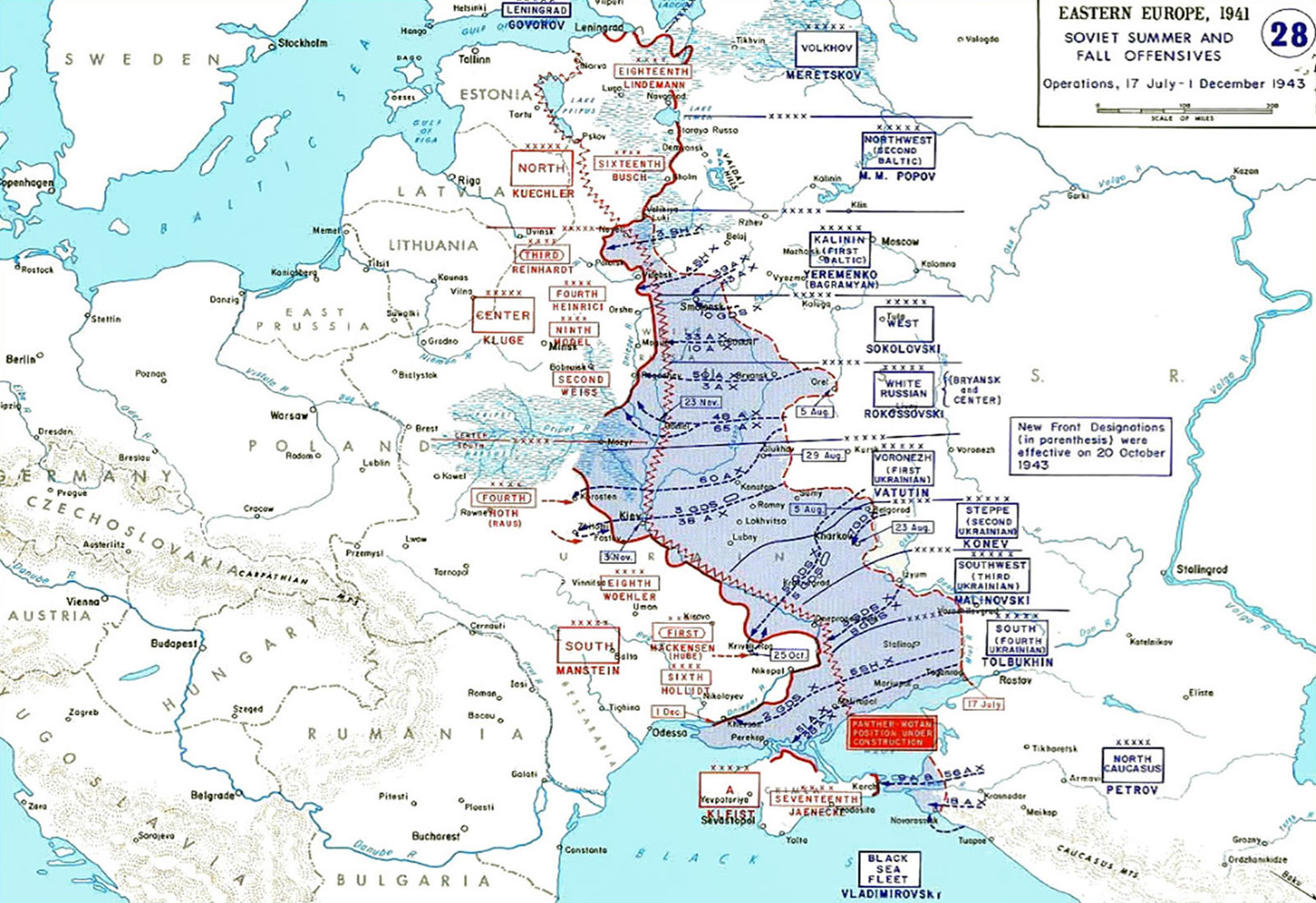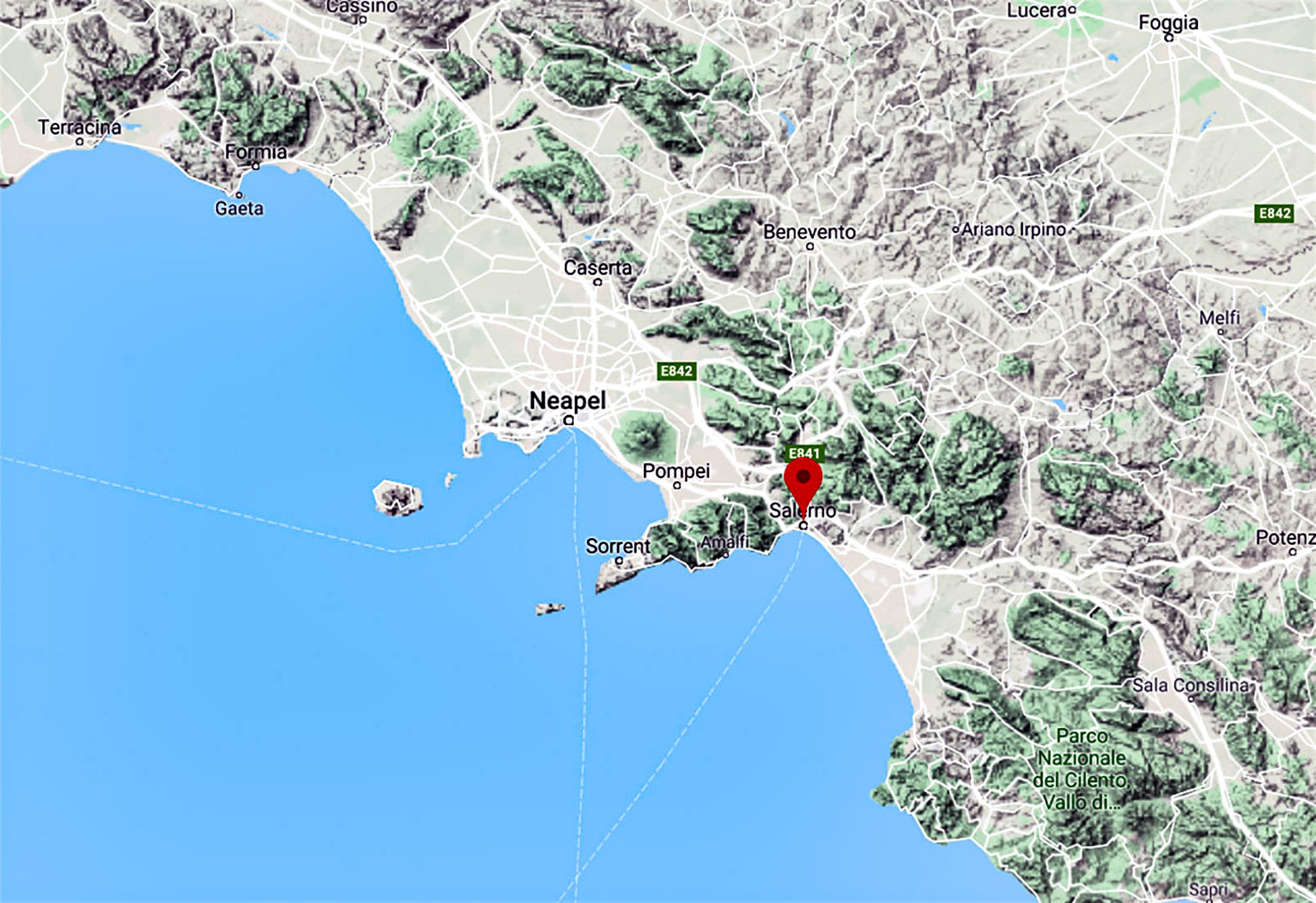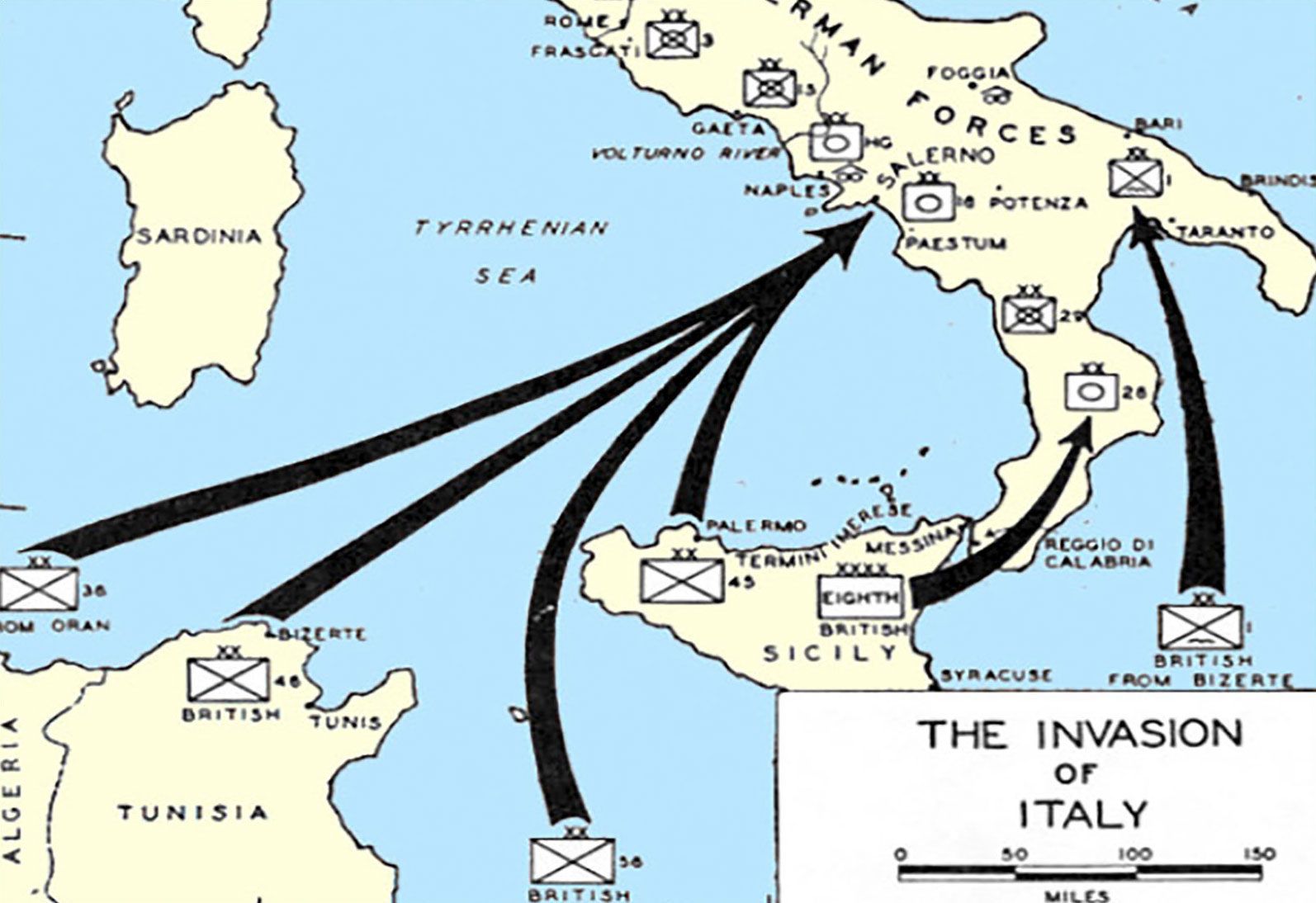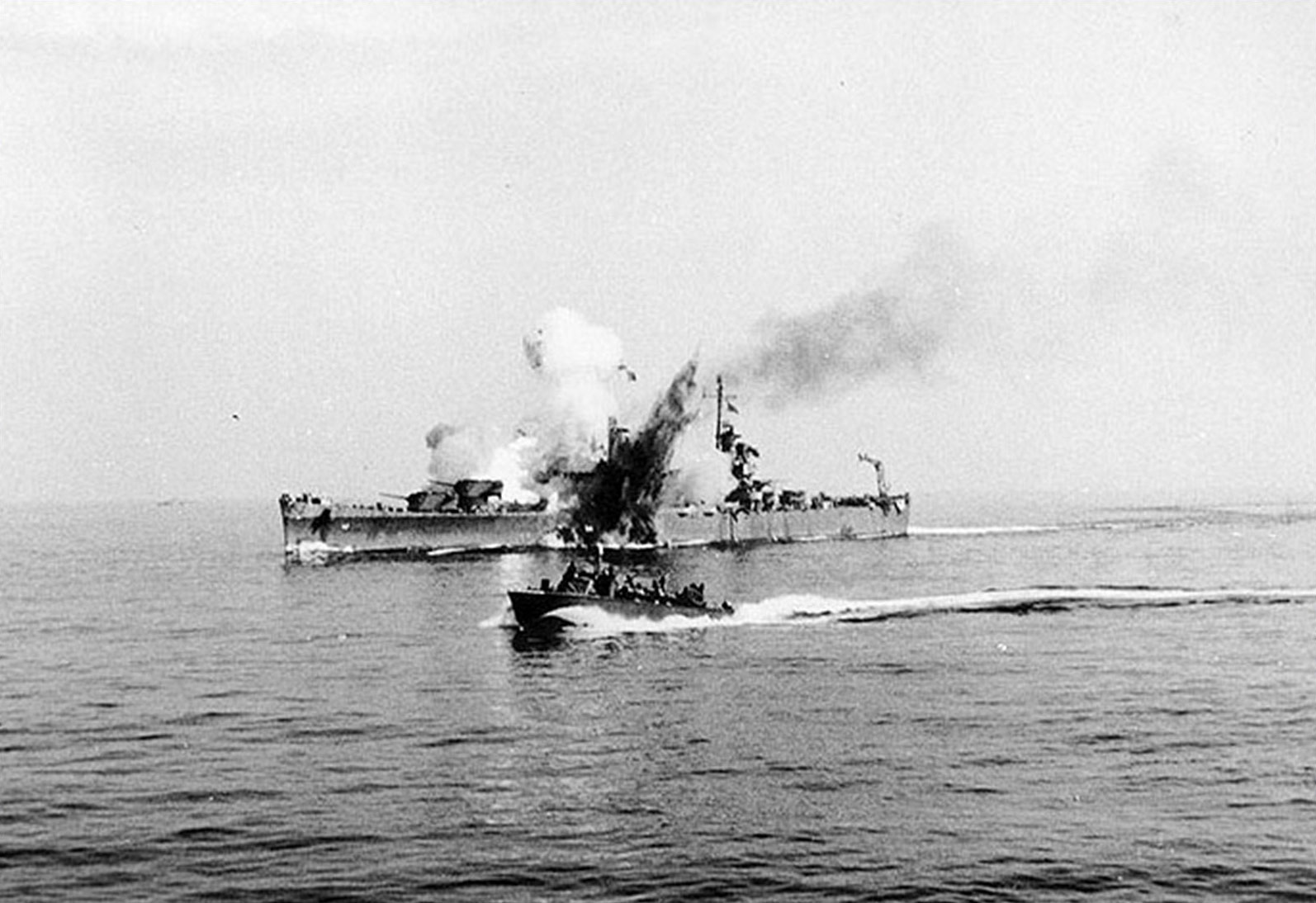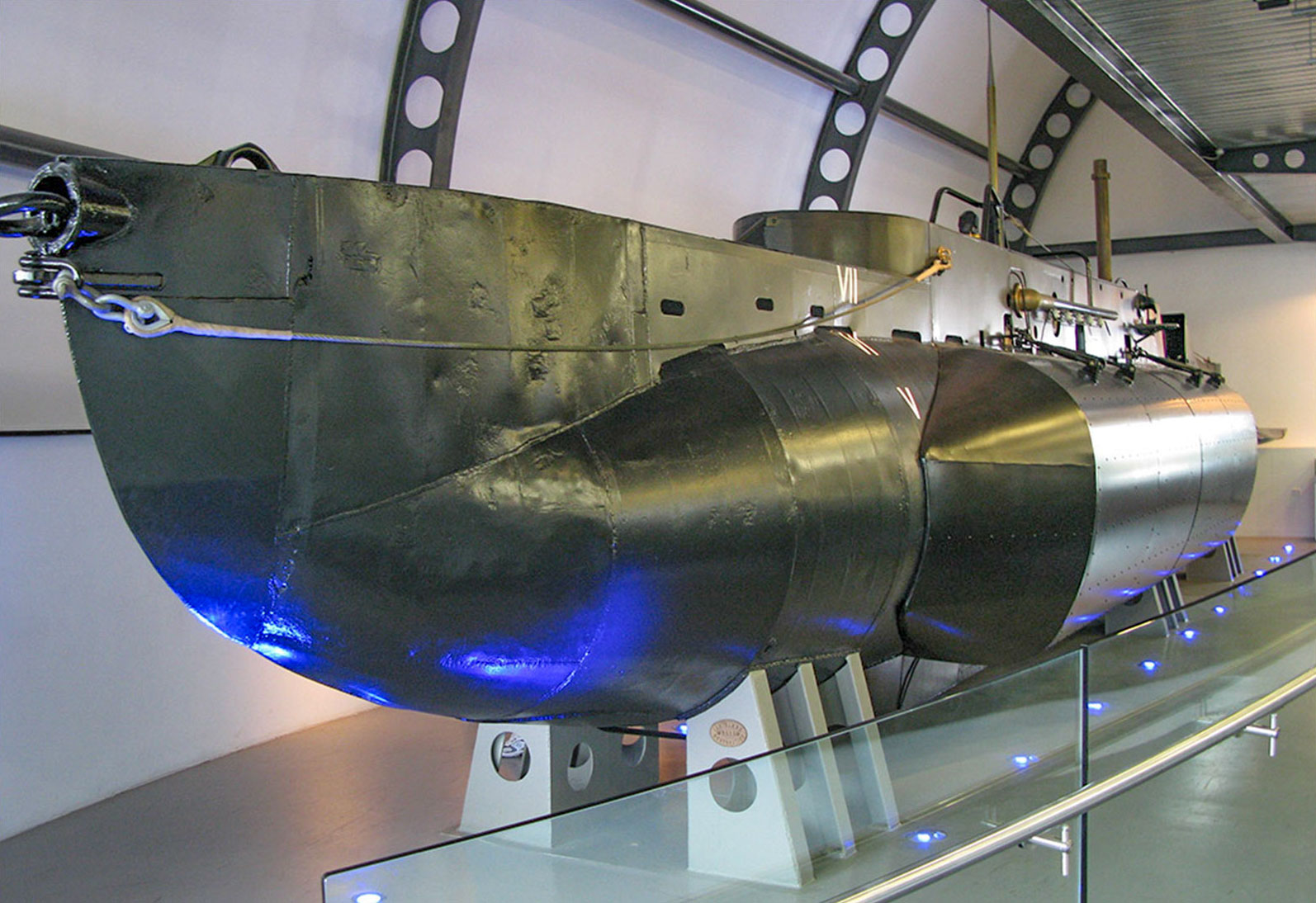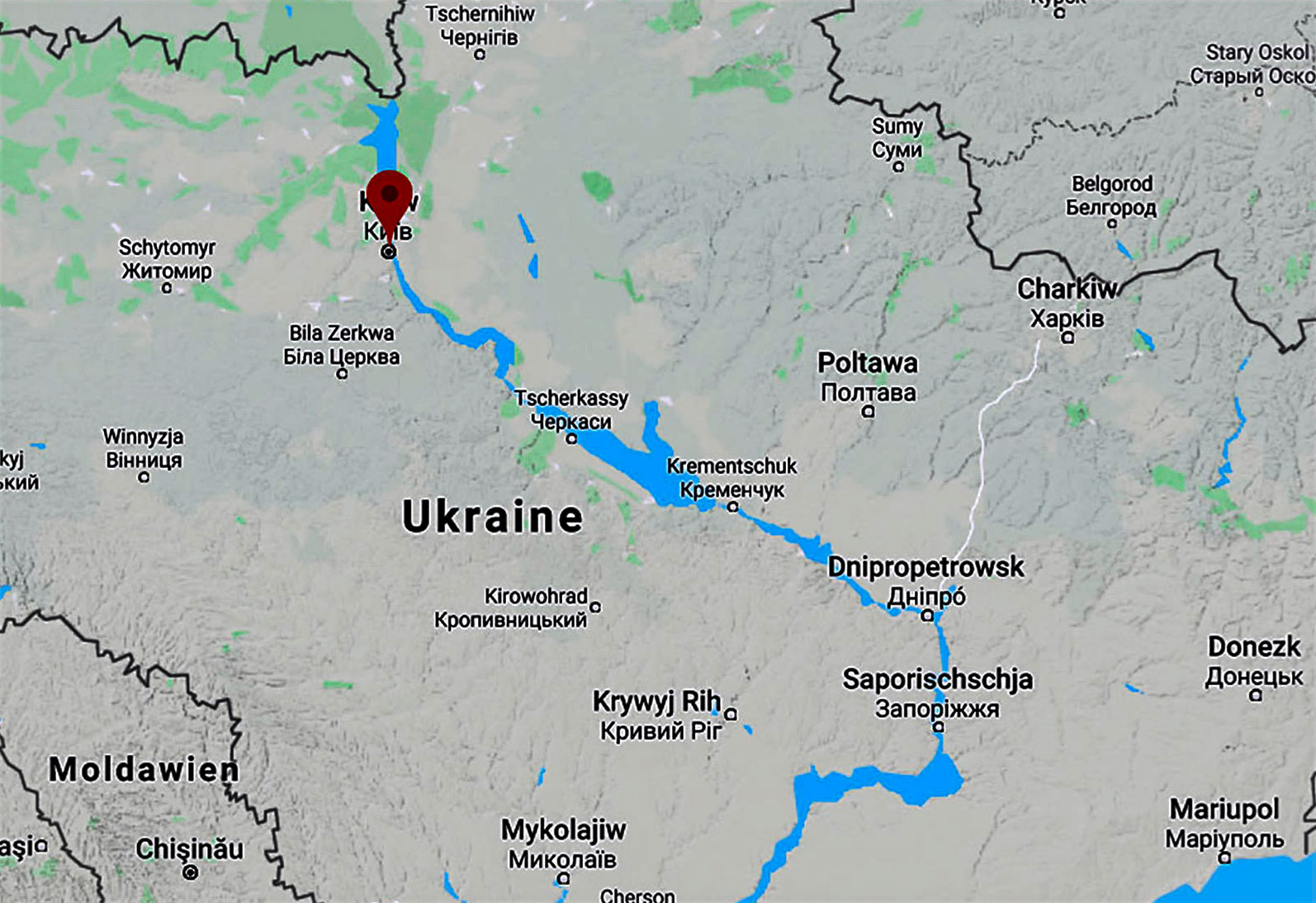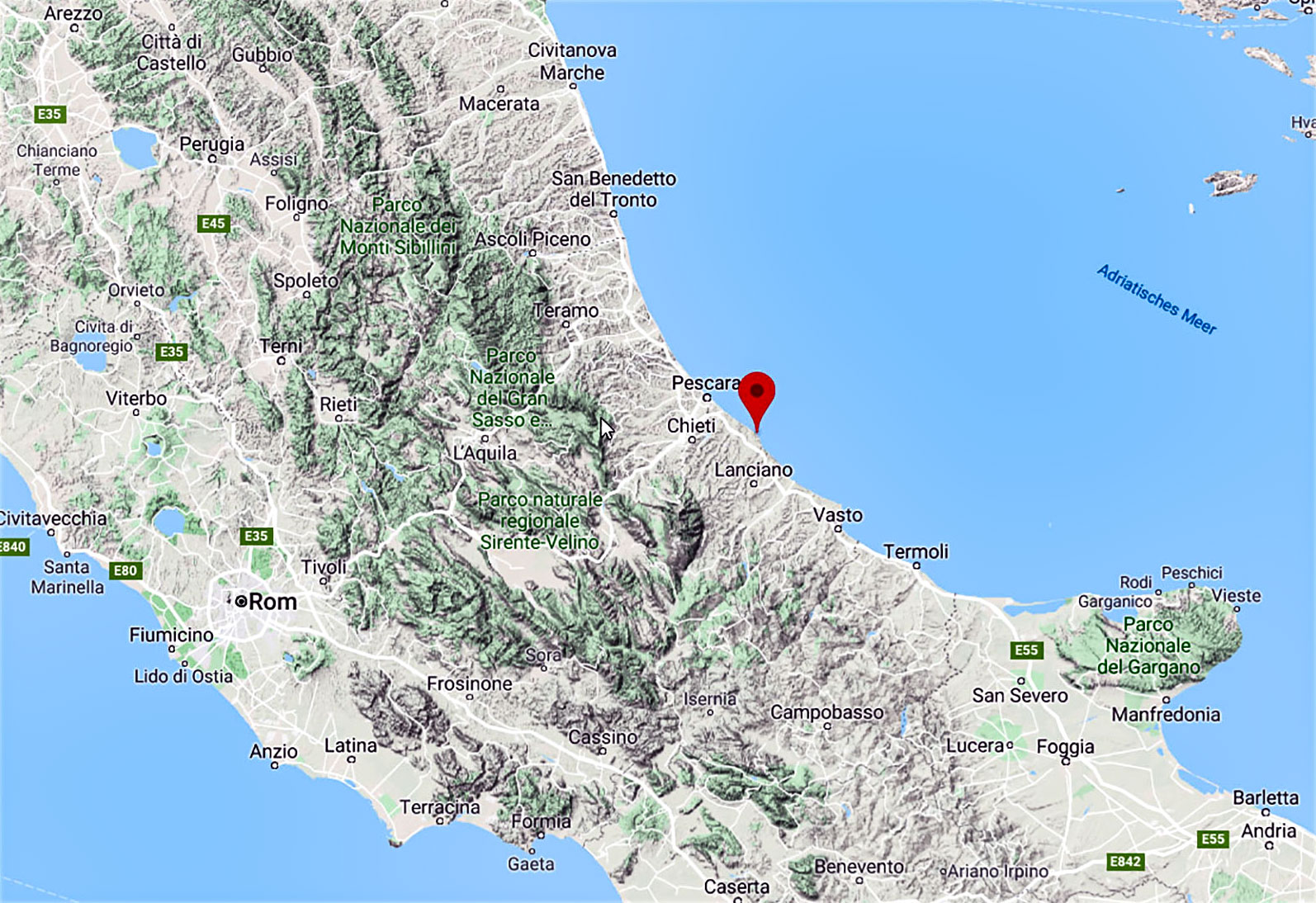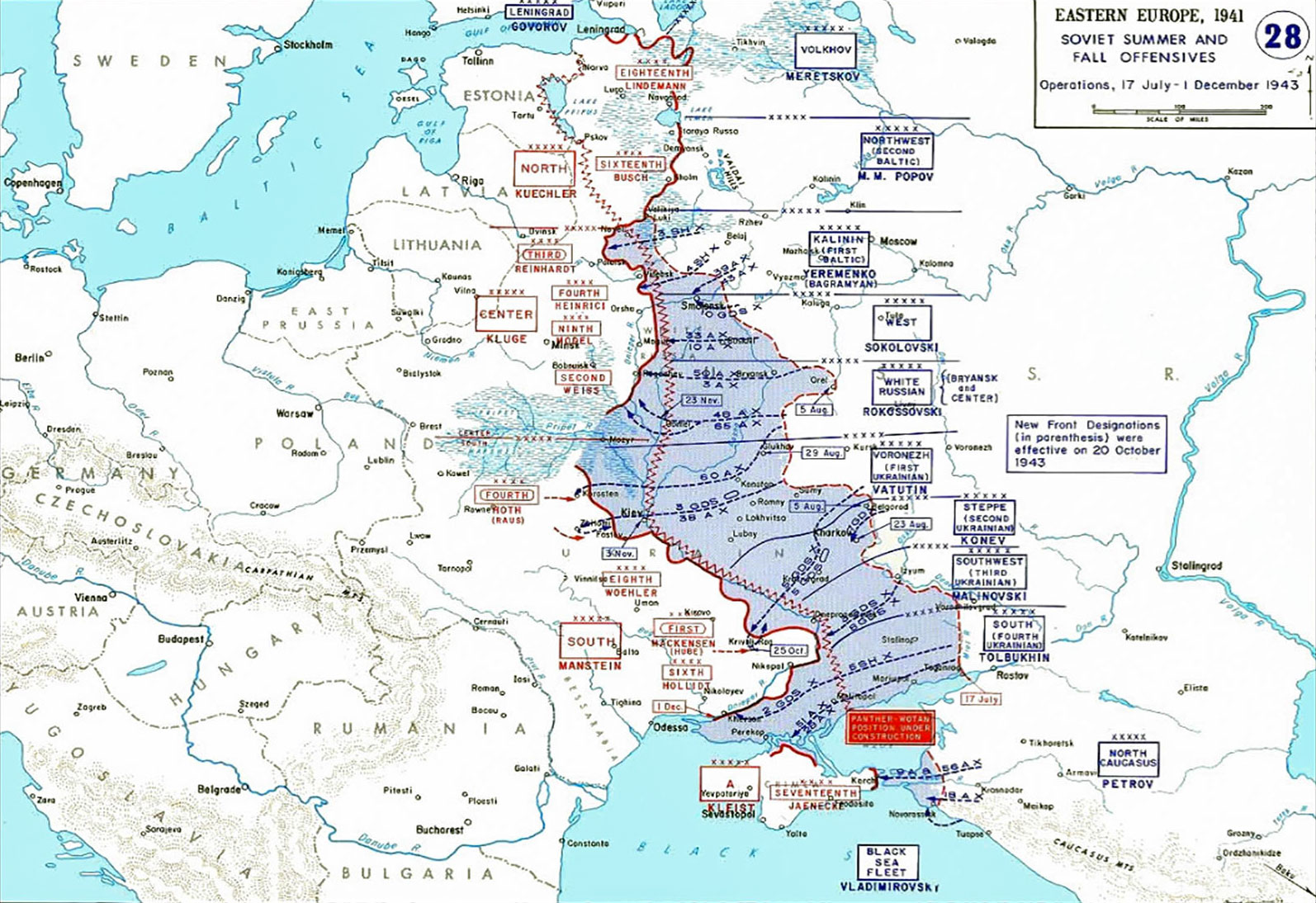Schlachten im Jahr 1943, Teil 2 ab 22.07.1943
Datenherkunft: Die Datenherkunft wird beim jeweiligen Thema angezeigt.
aus-der-zeit.site > Kriegsverlauf 1943
- Dritte Ladoga-Schlacht (22.07.1943 – 25.09.1943)
- Fall Achse (01.08.1943 – 19.09.1943)
- Belgorod-Charkower Operation (03.08.1943 – 23.08.1943)
- Smolensker Operation (07.08.1943 – 02.10.1943)
- Donezbecken-Operation (16.08.1943 – 22.09.1943)
- Schlacht am Dnepr (26.08.1943 – 20.12.1943)
- Alliierte Invasion in Italien (03.09.1943 – 17.09.1943)
- Dodekanes-Feldzug (08.09.1943 – 22.10.1943)
- Operation Avalanche (09.09.1943 – 14.09.1943)
- Operation Source (11.09.1943 – 20.09.1943)
- Schlacht um Kiew (03.11.1943 – 13.11.1943)
- Unternehmen Advent (06.11.1943 – 30.11.1943)
- Schlacht um Ortona (20.12.1943 – 28.12.1943)
- Operation Dnepr-Karpaten (24.12.1943 – 17.04.1944)
Dritte Ladoga-Schlacht (22.07.1943 – 25.09.1943)
Die Dritte Ladoga-Schlacht, auch Schlacht um die Sinjawino-Höhen, fand südlich des Ladoga-Sees an der sowjetisch-deutschen Ostfront während des Zweiten Weltkrieges statt. In der sowjetischen Historiographie wird sie Mga-Operation (Мгинская операция), seltener Operation Brussilow (Операция Брусилов) genannt. Die Rote Armee begann dabei am 22. Juli 1943 eine Offensive zum vollständigen Entsatz des landseitig eingeschlossenen Leningrads gegen die Heeresgruppe Nord der Wehrmacht. Ziel war es, die Schienenverbindung zur Metropole, besonders aber den Eisenbahnknotenpunkt Mga mit den vorgelagerten Sinjawino-Höhen einzunehmen. Bis zum Ende der Operationen am 25. September 1943 konnte sie nur geringe Teilerfolge erringen, erlitt jedoch, wie auch die deutsche Seite, hohe Verluste.
Das operative Ziel der sowjetischen Armeeführung wurde mit der Behauptung sowohl des strategisch wichtigen Höhenzuges als auch der Siedlung Mga durch die deutschen Verbände nicht erreicht. Allerdings trafen die Verluste die deutsche Seite dabei im weiteren Verlauf härter als die sowjetische.
Hintergrund
Nach Beginn des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion näherten sich im Spätsommer 1941 die Truppen der deutschen Heeres-gruppe Nord unter Generalfeldmarschall Wilhelm Ritter von Leeb (1876–1956) dem Leningrader Gebiet. Ab 25. August stiessen sie erneut vor und eroberten am 8. September die Stadt Schlüsselburg am Ladoga-See. Damit war Leningrad vom Rest der UdSSR abgeschnitten und sollte in einem weiteren Schritt erobert werden. Nach dem Erlahmen der eigenen Kräfte stellte die Heeres-gruppe Nord Ende September ihre Angriffe auf die Stadt selbst ein und ging zu deren Belagerung und Aushungerung über. Damit begann die Leningrader Blockade, welche durch finnische Streitkräfte im Norden der Stadt vervollständigt wurde.
Die Leningrader Front der Roten Armee versuchte mehrfach, die deutschen Stellungen südlich des Ladoga-Sees, die oft als „Flaschenhals“ bezeichnet wurden, zu durchbrechen. Dies führte zu mehreren erfolglosen Schlachten im Oktober 1941, von Januar bis Mai 1942 (→ Wolchow-Schlacht) und im August/September 1942 (→ Erste Ladoga-Schlacht). Trotz heftiger Kämpfe und grosser Verluste gelang es der Roten Armee erst im Januar 1943, den „Flaschenhals“ am Ufer des Ladoga-Sees zu durchbrechen und wieder eine Landverbindung nach Leningrad herzustellen (→ Zweite Ladoga-Schlacht). Allerdings verfügte der schmale Durchbruch über keine leistungsfähige Strassen- oder gar Schienenverbindung und lag noch immer im Wirkungsbereich der deutschen Artillerie, die von den das Gelände beherrschenden Sinjawino-Höhen (um die Siedlung Sinjawino) her schoss. Somit wurde die Blockade der Stadt faktisch immer noch aufrechterhalten.
Im Rahmen der Operation Polarstern (10. Februar bis 1. April 1943) hatten die sowjetischen Truppen bereits einen erfolglosen Angriff unternommen. Die Pläne der sowjetischen Stawka an diesem Frontabschnitt richteten sich gegen den Nordteil des Flaschenhalses und die dort befindlichen Sinjawino-Höhen. Südlich der Höhen verlief eine von Osten kommende leistungsfähige Bahnstrecke durch den Verkehrsknotenpunkt Mga bis nach Leningrad. Mit der Einnahme dieser Stadt und dem Freikämpfen der Bahnverbindung sollte die Blockade Leningrads endgültig aufgehoben werden. Ausserdem sollten die deutschen Truppen an dieser Stelle der Ostfront durch den Angriff so gebunden werden, dass sie nicht an die anderen Brennpunkte der Front im Süden, namentlich zur Schlacht im Kursker Bogen, verlegt werden konnten. Nachdem die deutsche Offensive bei Kursk am 12. und 13. Juli 1943 zum Stehen gebracht worden war, befahl die Stawka deshalb den Befehlshabern der Leningrader Front und der Wolchow-Front, zur Offensive überzugehen.
Kräfte und Vorbereitungen
Sowjetische Planungen
In der Zweiten Ladoga-Schlacht waren die Ziele der Stawka nicht erreicht worden. Ab März 1943 trat dann ein Stillstand entlang der gesamten Ostfront ein, da beide Seiten sich in den vorangegangenen Operationen, vor allem im Südabschnitt, erschöpft hatten. Beide wollten im Sommer jedoch die strategische Initiative zurückgewinnen. Stalin und die Führung der Roten Armee planten, basierend auf den Erfahrungen der abgeschlossenen Kämpfe, zunächst die deutsche Sommeroffensive abzuwehren, die sie bei Kursk vermuteten, und erst dann eigene Offensivoperationen in Gang zu setzen. Für die sowjetischen Kräfte im Raum Leningrad bedeutete dies, dass dort zunächst starke Verbände zugunsten des Kursker Abschnitts herausgezogen wurden, darunter die gesamte 11., 27., 53. und 68. Armee, sodass die Fronten hier geschwächt wurden.
Die Befehlshaber der Fronten trafen mit den ihnen verbliebenen Verbänden eigene Vorbereitungen für weitere Operationen. Die Leningrader Front unter Generaloberst L. A. Goworow (1897–1955) versammelte unter Ausdünnung der Frontlinie in ihrer Reserve neun Schützendivisionen, eine Panzerbrigade und zwei weitere Panzerregimenter, während die Wolchow-Front des Armeegenerals K. A. Merezkow (1897–1968) hinter ihren Stellungen vier Schützendivisionen, drei Panzerbrigaden und ein Panzerregiment konzentrieren konnte. Nach Auffassung der Stawka bestand damit an der Leningrader Front eine sowjetische Überlegenheit von 2:1 und an der Wolchow-Front im Verhältnis von 1,3:1, was eine neuerliche Offensive möglich erscheinen liess.
Ziel der Offensive sollte es sein, die deutschen Verbände soweit zurückzudrängen, dass sie nicht mehr in der Lage sein würden, durch eine erneute Offensive hin zum Ladoga-See die vollständige Blockade Leningrads wiederherzustellen. Armeegeneral Merezkow gibt in seinen Memoiren an, dass sich im Frühjahr 1943 die Anzeichen für eine deutsche Offensive zur Wiederherstellung der Blockade gemehrt hätten. Weiterhin sollte die schmale Landverbindung zur Stadt verbreitert werden, um eine geregelte Versorgung zu garantieren. Aus diesem Grund bestand das Ziel der Offensive nicht nur in der Eroberung der Sinjawino-Höhen, sondern auch in der des Eisenbahnknotenpunktes Mga. Zu diesem Zweck wurde die Operation als Zangenangriff konzipiert, durch den das deutsche XXVI. Armeekorps im „Flaschenhals“ aufgerieben werden sollte. Die deutsche 18. Armee würde somit eine schwere Niederlage erleiden und die Rote Armee eine gute Ausgangsbasis für weitere Offensivoperationen gewinnen. Als weiterer Nebeneffekt würde der Angriff auch deutsche Truppen und Reserven binden, die andernfalls an die Brennpunkte der Ostfront im Mittel- und Südabschnitt verlegt werden könnten. Die sowjetische militärische Führung wählte 1943 für die Decknamen ihrer einzelnen Sommeroffensiven die Namen berühmter Heerführer der russischen Geschichte und so erhielt die Offensive der Leningrader und Wolchow-Front die Bezeichnung Operation „Brussilow“ (nach General A.A. Brussilow).
Den Hauptangriff sollten die 67. Armee des Generalmajors M.P. Duchanow von der Leningrader Front und die 8. Armee des Generalleutnants F.N. Starikow von der Wolchow-Front führen. Die 67. Armee sollte zwischen der Newa und dem Ort Sinjawino zum Angriff antreten, die Sinjawino-Höhen einnehmen und dann weiter auf Mga vorgehen. Wenn sich ihr Angriff erfolgreich gestaltete, sollte weiter westlich ein Angriff der 55. Armee (Generalmajor W.P. Swiridow) ihn unterstützen, indem er auch auf Mga vorging. Im Osten hatte die 8. Armee den Auftrag die deutschen Stellungen zwischen den Orten Gaitolowo und Lodwa zu durchbrechen und dann auf Mga vorzustossen. Mit geringeren Teilkräften sollte die 8. Armee jedoch gleich nach ihrem Durchbruch der 67. Armee bei den Sinjawino-Höhen entgegenkommen. Für die deutsche Führung waren diese Pläne wenig überraschend. Der ehemalige Kommandeur des deutschen Grenadier-Regiments 284, Hartwig Pohlman, urteilte später: „Alles in allem keine neuen Gedanken und Ziele, keine grosszügige, überraschende Planung, sondern eine Fortsetzung der zweiten Ladogaschlacht, wie sie die deutsche Führung seit Juni erwartete, die sie aber auch nicht durch irgendwelche Gegenmassnahmen verhindern konnte, da ihr die Mittel dazu fehlten“.
Deutsche Lage
Die deutsche Heeresgruppe Nord, die seit dem 12. Januar 1942 von Generalfeldmarschall Georg von Küchler (1881–1968) befehligt wurde, hatte in den vorangegangenen Monaten immer wieder Truppen an die bedrohten Südabschnitte der Ostfront abzugeben, sodass zur Deckung der insgesamt 750 km Frontlinie am 20. Juli 1943 lediglich 44 Divisionen und Brigaden sowie drei Sicherungs- und eine Ausbildungsdivision im rückwärtigen Frontgebiet zur Verfügung standen. Die Truppen zählten inklusive aller rückwärtigen Versorgungsdienste 710.000 Mann, von denen 360.000 den Frontverbänden angehörten. Die Artillerie umfasste 2.407 Geschütze. Unter diesen Verbänden befand sich keine Panzerdivision, weil diese im Bereich der Heeresgruppe Mitte zum Angriff gegen Kursk eingesetzt wurden. Lediglich 40 einsatzbereite Panzer standen deshalb im Bereich der Heeresgruppe Nord. Diese waren in der schweren Panzer-Abteilung 502 (drei Kompanien) und der Sturmgeschütz-Brigade 912 (drei Kompanien) zusammengefasst und sollten in den folgenden Kämpfen als „Feuerwehr“ an den Brennpunkten der Front eingesetzt werden. Ebenso geschwächt waren die Verbände der Luftflotte 1, welche die Heeresgruppe unterstützen sollte. Sie konnte zum selben Zeitpunkt nur sechs Jagdflugzeuge für den Tageinsatz mobilisieren.
Die Heeresgruppe umfasste zwei Grossverbände, nämlich die 18. Armee (Gen.Ost. Georg Lindemann) vor Leningrad und südlich davon die 16. Armee (Gen.Ost. Ernst Busch). Im Schwerpunktbereich des geplanten sowjetischen Angriffs – im „Flaschenhals“ – war das XXVI. Armeekorps des Gen.d.Inf. Ernst von Leyser (1889–1962) eingesetzt. Dieses umfasste die 212., 1., 11., 69., 290., 23. sowie die 5. Gebirgs-Division. In der Reserve des Armeeoberkommando (AOK) 18 befanden sich nur die 28. Jäger-Division und die 121. Infanterie-Division. Mit diesen Kräften war die Heeresgruppe den ihnen gegenüberstehenden Verbänden erheblich unterlegen. Die Abteilung Fremde Heere Ost ging davon aus, dass ihr allein 734.000 sowjetische Soldaten an der Front gegenüberstanden, hinter denen weitere 491.000 Soldaten in Reserve gehalten wurden. Ausserdem ging sie in ihrem Bericht von 209 sowjetischen Panzern und mindestens 2.793 Geschützen in der Frontlinie aus, die durch weitere 843 Panzer und 1.800 Geschütze aus der Reserve verstärkt werden konnten.
Verlauf
Bereits am 1. Juli 1943 hatte auf sowjetischer Seite die Bereitstellung von Artillerie für den Angriff begonnen. Gleich nach dem Befehl der Stawka zum Beginn der Offensive begann am 12. Juli schliesslich die gezielte Beschiessung der deutschen Stellungen bei Sinjawino. Der Schwerpunkt des Angriffs lag beim 30. Garde-Schützenkorps des Generals Simoniak (45., 63. und 64. Garde-Schützendivision) östlich der Newa. Es sollte zunächst Arbuzowo einnehmen und dann weiter auf Mga vorgehen. Dazu wurde es von der 30. Garde-Panzerbrigade und der 220. Panzerbrigade sowie den Garde-Panzerregimentern 29 und 31 unterstützt. Östlich davon griffen die 90., 268., 43. und 123. Schützendivision die deutschen Stellungen auf den Sinjawino-Höhen an, um sie dort zu fesseln. Allein die erste sowjetische Angriffswelle umfasste in diesem Sektor 75.000 Soldaten und 120 Panzer, denen zunächst lediglich die deutsche 23., 11. und 290. Infanterie-Division mit weniger als 35.000 Mann gegenüberstanden. Am 22. Juli 1943 um 4:30 Uhr morgens setzte entlang der Angriffsfront ein verheerendes sowjetisches Artilleriefeuer ein, dem Bombenangriffe der 13. Luftarmee folgten. Um 6:05 Uhr stiessen die ersten sowjetischen Angriffsverbände vor. An der Spitze des 30. Garde-Schützenkorps gingen die 63. und 45. Garde-Schützendivisionen gegen die Stellungen der 23. deutschen Infanterie-Division vor.
Dabei erzielten sie einen Einbruch zwischen der deutschen 23. und 11. Infanterie-Division, den auch sofort angesetzte Gegenangriffe nicht schliessen konnten. In diese Lücke setzte General Duchanow die 30. Garde-Panzerbrigade an, die den Einbruch bis zum Abend auf zwei Kilometer Tiefe und Breite erweiterte. Dagegen brachte die deutsche Führung schnell einzelne Teile der 121. Infanterie-Division zum Einsatz, die von der II. Abteilung des Nebelwerfer-Regiment 70 und der 2. Kompanie der schweren Panzer-Abteilung 502 (mit Panzerkampfwagen VI „Tiger“) unterstützt wurden. Diesen gelang es, den sowjetischen Einbruch abzuriegeln.
Das deutsche AOK 18 setzte am folgenden Tag die Armeereserven ein. Sie verlegte sowohl weitere Teile der 121. Infanterie-Division als auch die 28. Jäger-Division an die Einbruchstellen und riegelte sie so ab. Ab dem 26. Juli kam es dort wiederum zu heftigen Kämpfen, in denen die sowjetischen Truppen vergeblich versuchten, einen Durchbruch zu erzielen. Dabei war es besonders hinderlich, dass die bereits erreichten Einbrüche nach wie vor im Osten von den Sinjawino-Höhen flankiert wurden. Generaloberst Goworow verlegte deshalb ab dem 1. August den Schwerpunkt seiner Angriffe auf diese Höhen, die von der deutschen 11. und 290. Infanterie-Division verteidigt wurden. Hier bevorzugte das schwierige und waldreiche Gelände sowie die überhöhte Lage die deutschen Verteidiger. Trotzdem gelangen den angreifenden sowjetischen Verbänden zunächst einige Geländegewinne, die allerdings teilweise durch deutsche Gegenangriffe wieder verloren gingen. Die 11. Infanterie-Division erlitt jedoch so grosse Verluste, dass sie nach 20 Kampftagen am 10. August durch die 21. Infanterie-Division abgelöst werden musste. Bis dahin hatte sie in den Kämpfen allein 95.000 Granaten (2.315 t) verschossen.
Auch andere deutsche Divisionen waren bald abgekämpft und mussten abgelöst werden. Dazu musste die Heeresgruppe Nord auf Aushilfen zurückgreifen. So löste sie die 121. Infanterie-Division aus dem Verband der 16. Armee heraus, um mit ihr Anfang August die 28. Jäger-Division zu ersetzen. Aus der Blockadefront vor Leningrad zog sie bereits am 23./24. Juli die 58. Infanterie-Division ab und setzte sie zum Gegenangriff gegen das sowjetische 30. Garde-Schützenkorps an. Obwohl der Angriff der Division am 4. August von wenigen Panzerkampfwagen VI „Tiger“ unterstützt wurde, kam er nur langsam voran, da sowjetische Artillerie von jenseits der Newa wirkungsvoll in den Kampf eingriff. Allein im Angriffsstreifen des II. Bataillons / Grenadierregiment 220 wurden in fünf Stunden die Einschläge von 80 Salven zu je 18 Granaten gezählt. In den folgenden Tagen liessen die sowjetischen Angriffe nach. Dafür wurden die deutschen Stellungen noch einmal intensiv durch Artillerie beschossen. Erst am 12. August begannen die Angriffe an allen Abschnitten erneut und dauerten bis zum 22. August ohne Entscheidung weiter an.
Allgemein gestaltete sich der sowjetische Vorstoss äusserst schwierig und bald schon ging er in einen regelrechten Stellungskrieg über, in dem die Geländegewinne in Metern gemessen wurden. Während der Kämpfe beherrschte die sowjetische Luftwaffe den Luftraum. Erst fünf Tage nach dem Beginn der Schlacht verlegte die Wehrmacht eine zusätzliche Jägergruppe (weniger als 25 Maschinen) in diesen Abschnitt, aber auch diese bewirkte wenig und wurde bald wieder abgezogen. Unter dem Eindruck der hartnäckigen deutschen Abwehr beschloss Generaloberst Goworow, den Angriff der 55. Armee auf Mga von Westen her nicht durchzuführen.
Der Angriff der 8. Armee
Der Angriff der sowjetischen 8. Armee von Osten her auf Mga hatte ähnliche Schwierigkeiten zu überwinden. Hier erfolgte der Angriff in Raum Woronowo auf einer Breite von fast 14 Kilometern. Dazu bildete Merezkow zwei Angriffsgruppen, die in jeweils zwei Wellen gegliedert waren. Je eine Gruppe sollte nördlich und südlich der Bahnlinie Wolchow–Mga vorgehen. Die nördliche Gruppe bestand aus der 18. und 378. Schützendivision in erster, der 379. und 239. Schützendivision in zweiter Welle. Die vier Divisionen der ersten Welle erhielten zu ihrer Unterstützung jeweils ein Panzerregiment und in der zweiten Welle wurden die 16. und die 122. Panzerbrigade bereitgehalten, um jeden Durchbruch durch die feindliche Stellung ausnutzen zu können. Auf der linken Flanke sollten die 265. und 382. Schützendivision, sowie die 1. und 22. Schützenbrigade einen Entlastungsangriff führen. Auf der rechten Flanke fiel diese Aufgabe der 372. Schützendivision zu. Armeegeneral Merezkow hielt allerdings die 286. und 58. Schützendivision in Reserve. Des Weiteren sollte ein Ablenkungs- und Fesselungsangriff bei Pogostje und Kirischi geführt werden, um die Flanke der Hauptangriffskolonne zu decken. Insgesamt verfügte die erste Angriffswelle über 80.000 Mann und 250 Panzer. Im Hauptangriffstreifen (50.000 Mann und 150 Panzer) bedeutete dies eine Überlegenheit von 5:1 über die deutschen Verteidiger.
Das sowjetische Vorbereitungsfeuer dauerte sechs Tage, bevor die Truppen auch hier am 22. Juli um 6:35 Uhr zum Angriff übergingen. Der Vormarsch kam allerdings bereits nach der Einnahme der ersten deutschen Linie ins Stocken. An diesem Frontabschnitt leisteten die 5. Gebirgs-Division und die 132. Infanterie-Division heftigen Widerstand. Hinzu kam, dass sich die sowjetischen Panzer in dem sumpfigen Gelände festfuhren. Ende Juli musste Armeegeneral Merezkow die ausgeblutete 18. und 256. Schützendivision von der Front abziehen und sie durch die 379. und die 165. Schützendivision ersetzen. Von deutscher Seite wurde mangels anderer Reserven die 121. Infanterie-Division wieder aus den Kämpfen bei Arbuzowo herausgezogen und in den Abschnitt der 132. Infanterie-Division verlegt. Letztere hatte bisher allen Angriffen standgehalten und wurde nun zur Verstärkung der 5. Gebirgs-Division verlegt. Diese ersten Kämpfe wurden von der deutschen Führung als kaum ernstzunehmender Vorstoss interpretiert. Erst am 2. August begannen solche Angriffe, die auf deutscher Seite zu einer angespannten Lage führten. Die sowjetische 122. Panzerbrigade und das 32. Garde-Panzerregiment drangen bis kurz vor den Ort Slawjanka vor, bevor sie dort bis zum 8. August von herangeführten Wehrmachtverbänden gestoppt wurden.
Am 9. August verlegte Armeegeneral Merezkow seine Angriffe in den Abschnitt südlich der Bahnlinie und konzentrierte ihn dort auf den deutschen Brückenkopf östlich des Flusses Nasija bei Poretschje. Zur Einnahme des Brückenkopfes zog er am 11. August die 256. und 374. Schützendivision sowie die Garde-Panzerregimenter 35 und 50 zusammen. Diese Angriffskräfte konnten auf die Unterstützung der 378., 364. und 165. Schützendivision rechnen, die bereits um den Brückenkopf eingesetzt waren. Im Brückenkopf standen bereits stark angeschlagene Teile der 5. Gebirgs-Division. Der Angriff der sowjetischen Verbände gewann zunächst Gelände und bald darauf wurde der Stützpunkt Poretschje eingenommen. Dann aber trafen Teile der 132. Infanterie-Division ein, welche die Lage stabilisierten und zum Gegenangriff ansetzten. Ein neuerlicher Angriff der sowjetischen Verbände am 12. August warf die deutschen Truppen, die dabei zum Teil in Nahkämpfe verwickelt wurden, wieder zurück. Armeegeneral Merezkow brachte am 13. August seine letzten Reserven, die 311. Schützendivision und das 503. selbständige Panzerbataillon zum Einsatz. Zwar erzielten diese neuen Kräfte erneut einen Einbruch in die deutschen Linien, doch auch dieser wurde in einem deutschen Gegenangriff wieder bereinigt. Letztendlich waren beide Seiten durch die vorangegangenen Kämpfe völlig erschöpft. Als Ergebnis räumten die Deutschen zwar den Brückenkopf in der Nacht vom 14. zum 15. August, doch der von der Führung der Wolchow-Front erhoffte Durchbruch nach Mga war damit nicht zustande gekommen. Am 16. August wurde die abgekämpfte und fast aufgeriebene deutsche 132. Infanterie-Division abgezogen und durch die 1. und 254. Infanterie-Division ersetzt. Während ihres Einsatzes im Brückenkopf hatte sie 24 sowjetische Panzer zerstört. Die Heftigkeit der Kämpfe wird dadurch veranschaulicht, dass zehn dieser Panzer durch leichte Waffen im Nahkampf ausgeschaltet wurden.
Am 17. August ging zunächst die für die Offensive bereitgestellte sowjetische Artilleriemunition zur Neige. Auch die Fernfliegerkräfte, die vom 29. Juli bis zum 12. August täglich etwa 100 Angriffe auf das deutsche Hinterland geflogen hatten, wurden wieder abgezogen. So flauten die Kämpfe in den folgenden Tagen allmählich ab. Am 22. August um 14:40 Uhr erliess die Stawka angesichts des Misserfolges einen Befehl zum Abbruch der Offensive. In diesem hiess es, die Leningrader- und die Wolchow-Front hätten die ihnen gestellte Aufgabe erfüllt, dem Feind eine Niederlage zugefügt und seine Reserven gebunden.
Die zweite Offensive im September
Auf Befehl der Stawka bereiteten die Frontbefehlshaber Goworow und Merezkow nur wenige Wochen nach dem Scheitern ihrer ersten Operationen eine neue Offensive vor. Die Ziele waren diesmal wesentlich enger definiert und umfassten nun lediglich die Einnahme der Sinjawino-Höhen.
Die Leningrader Front hatte das 30. Garde-Schützenkorps im Raum Leningrad aufgefrischt und dann in das Gebiet südlich von Schlüsselburg verlegt. Dort wurde es temporär der 67. Armee General Duchanows unterstellt. Der Plan sah vor, mit diesem Verband die Sinjawino-Höhen direkt von Norden her anzugreifen. Links vom Korps sollte dieses durch die 43. und 123. Schützendivision, rechts von der 120., 124. und 196. Schützendivision unterstützt werden. Zusätzlich standen vor den Sinjawino-Höhen bereits regulär die 11. und 268. Schützendivision. Die 8. Armee der Wolchow-Front unter General Starikow sollte die Offensive mit einem Angriff zwischen Woronowo und Gaitolowo unterstützen. General Starikow formierte erneut zwei Angriffsgruppen. Die erste umfasste die 372., 379. und 265. Schützendivision und die 58. Schützenbrigade. Diese sollte an der Nahtstelle zwischen der deutschen 290. und 254. Infanterie-Division angreifen. Die zweite Angriffsgruppe mit der 18., 378., 256. und 311. Schützendivision sollte gegen die Stellungen der 5. Gebirgs-Division nahe Woronowo vorgehen.
Am Morgen des 15. September 1943 begann der Angriff erneut. Bei dieser Gelegenheit setzte die Rote Armee ein neues Artilleriekonzept um. Bisher hatte sie die feindlichen Stellungen beschossen und ihr Feuer dann in den rückwärtigen Raum verlegt. In dieser kurzen Zwischenzeit zwischen dem Feuerwechsel besetzten die deutschen Soldaten, die sich bisher in Unterständen verborgen hatten, ihre Verteidigungspositionen. Dieses Mal machte die sowjetische Artillerie keine Pause bei ihrem Feuer und die sowjetische Infanterie ging bereits währenddessen vor. Der Angriff des 30. Garde-Schützenkorps mit seinen drei Divisionen war erfolgreicher als noch einige Wochen zuvor. Die deutschen Infanterie-Divisionen 11 und 290 wurden von dem neuen Artilleriekonzept überrascht und so gelang den sowjetischen Angriffsverbänden ein Geländegewinn von mehreren Hundert Metern auf den Sinjawino-Höhen. Doch das AOK 18 führte die 28. Jäger-Division sowie die Infanterie-Divisionen 215 und 61 heran. Mit dieser Massnahme riegelte die deutsche Führung den sowjetischen Einbruch schnell ab. In den folgenden Tagen rannten die Verbände der sowjetischen 67. Armee trotzdem weiter gegen die deutsche Verteidigung an, um in das Flachland nach Mga vorzustossen. Diese Versuche blieben jedoch erfolglos. Der Angriff der sowjetischen 8. Armee von Osten her gewann ebenfalls kaum an Boden. Der nördlichen Angriffsgruppe gelang kein Einbruch in die Stellungen der 5. Gebirgs-Division und der Angriff der südlichen Gruppe wurde schnell abgeriegelt. Am 18. September 1943 genehmigte die Stawka deshalb erneut die Einstellung der Offensivoperationen. Am 24. September flammten die Kämpfe um die Höhen erneut kurz auf, bevor sich die Front danach wieder stabilisierte.
Folgen und Bewertung
Die äusserst geringen Geländegewinne, die die Rote Armee bei diesen Operationen erzielt hatte, waren mit unverhältnismässig hohen Verlusten erkauft worden. Nach amtlichen Angaben beliefen sich die sowjetischen Verluste allein in der Phase von 22. Juli bis zum 22. August auf 79.937 Soldaten, von denen 20.890 Mann als tot oder vermisst galten. Im gleichen Zeitraum verloren die Wehrmachtverbände 26.166 Mann, von denen 5.435 Soldaten tot oder vermisst waren. Zur zweiten Offensive liegen keinerlei genaue Zahlenangaben vor. Es steht jedoch fest, dass die sowjetischen Verluste vom 15. bis zum 18. September mehr als 10.000 Mann betrugen.
Das Ziel der sowjetischen Operationen – ein Aufreiben des XXVI. Armeekorps, ein Zurückdrängen der deutschen Linien, eine Wiedergewinnung des Bahnknotenpunktes Mga und die Bindung von deutschen Reserven – wurden nur in geringem Umfang erreicht. Die Stadt Mga befand sich noch in deutschem Besitz. Das XXVI. Armeekorps hatte Verluste erlitten, stand aber noch als kampffähiger Verband an der Front. Die deutschen Linien waren nur an einigen Abschnitten einige hundert Meter zurückgedrängt worden, allerdings befand sich unter den Geländegewinnen auch ein wesentlicher Teil der Sinjawino-Höhen. Eines der Hauptziele der Offensive, die Bindung deutscher Reserven, war insofern nicht gelungen, als die Heeresgruppe Nord sich mit eigenen Mitteln behalf, indem sie Divisionen aus nicht angegriffenen Frontabschnitten herauszog, um sie an die Brennpunkte zu werfen. Mehr noch: Von Juli bis November 1943 wurden nacheinander 13 Divisionen von der Heeresgruppe an die Heeresgruppen Mitte und Süd abgegeben. Durch die Eroberung eines Grossteils der Sinjawino-Höhen war jedoch die Gefahr, dass die deutschen Truppen später wieder bis zum Ladoga-See vordringen könnten, beseitigt und die provisorische Versorgung Leningrads gesichert worden. Die grossen Ziele der Operationen wurden jedoch erst mit der grossangelegten Offensive im Januar und Februar 1944 in der Leningrad-Nowgoroder Operation erreicht, die die Heeresgruppe Nord mehrere hundert Kilometer weit zurückdrängte und die Stadt Leningrad wieder an das reguläre Schienennetz anschloss.
Wie der amerikanische Historiker David M. Glantz bemerkte, neigt die sowjetische und russische Historiographie dazu, Fehlschläge (oder wenig erfolgreiche Unternehmen) nicht zu thematisieren oder aber sie zu bagatellisieren. So wird auch die Mgaer Operation (Мгинская операция), wie die Offensive vom 22. Juli zum 22. August im russischen Raum genannt wird, selten in Publikationen zum Zweiten Weltkrieg erwähnt. Die in den 1960er-Jahren erschienene offizielle Geschichte des Grossen Vaterländischen Krieges der Sowjetunion (6 Bde.) übergeht beispielsweise diese Kämpfe vollständig. In anderen Publikationen wurden die Kämpfe als unbedeutende Entlastungsoffensive dargestellt, die lediglich deutsche Kräfte an diesem Teil der Ostfront binden sollte, was auch erreicht worden sei. Selbst heute noch ist dies die offizielle Version, die auf den Seiten des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation nachzulesen ist. Dagegen sprechen jedoch die umfangreichen Kräfte, die aufgewendet wurden, die unverhältnismässigen Verluste sowie die Hauptstossrichtungen der Schwerpunktarmeen, welche auf eine Zerschlagung des deutschen XXVI. Armeekorps und die Beseitigung des „Flaschenhalses“ abzielten.
Die Darstellung in den Memoiren des Armeegenerals Merezkow ist widersprüchlich: Einerseits betont er, dass er die zur Verfügung stehenden Kräfte nicht für ausreichend gehalten habe, anderseits sei das Ziel der Operation nicht die Eroberung von Gelände gewesen. Er führt weiterhin aus, dass die deutschen Truppen in den ersten Tagen der Schlacht bereits durch den massierten Artillerie-Einsatz aufgerieben worden seien. Obwohl keine operativen Ziele verfolgt worden seien, kritisierte Merezkow den Abbruch der Offensive und deutete damit an, dass tatsächlich ein operativer Frontdurchbruch erzielt werden sollte:

„Noch ein kräftiger Druck, und die deutsche Front bei Mga wäre zusammengebrochen. […] hätte ich von der Lage des Gegners gewusst, wäre ich ins Hauptquartier geflogen und hätte mich für eine Verstärkung eingesetzt, um die Operation weiterführen zu können“.
In deutschen Veröffentlichungen wird meist der Abwehrerfolg im Juli und August betont, der anschliessende sowjetische Teilerfolg im September jedoch vernachlässigt. Selbst die neueste Darstellung des Historikers Karl-Heinz Frieser geht mit keinem Wort auf ihn ein. Letztlich bleibt festzustellen, dass eine moderne Aufarbeitung in Form einer Monografie noch aussteht.
Fall Achse (01.08.1943 – 19.09.1943)
Fall Achse war der Deckname einer Operation des Oberkommandos der Wehrmacht während des Zweiten Weltkrieges. Er sah die Besetzung Italiens für den Fall vor, dass der Verbündete kapitulierte bzw. aus dem Krieg ausschied. Die Operation trug zunächst den Namen Unternehmen Alarich (nach Alarich I.), wurde dann aber nach der Verhaftung Mussolinis in Fall Achse umbenannt.
Vorgeschichte
Am 10. Juli 1943 landeten die Alliierten auf Sizilien (Operation Husky) und drängten die deutsch-italienischen Verbände innerhalb der nächsten zwei Wochen auf einen immer kleiner werdenden Brückenkopf am Ätna zurück. Die sich seit der Niederlage in Nordafrika formierenden Widerstandsbewegungen gegen Mussolini strebten nun nach seiner Absetzung. Auf einer Sitzung des Grossen Faschistischen Rates am 24./25. Juli wurde Mussolini entmachtet und anschliessend auf Befehl von König Viktor Emanuel III. verhaftet. Als neuer Ministerpräsident wurde Pietro Badoglio eingesetzt.
Den Versicherungen der Regierung Badoglio, dem Achsenbündnis treu bleiben zu wollen, schenkte man auf deutscher Seite nur noch wenig Glauben. Die bereits zu einem früheren Zeitpunkt erarbeiteten Planungen und Vorbereitungen zur Übernahme der italienischen Besatzungsgebiete auf dem Balkan und in Frankreich (Deckname: Konstantin) und zur Besetzung Italiens selbst (Deckname: Alarich) wurden nun reaktiviert und zum Fall Achse zusammengefasst. Zusätzlich zu den bereits in Italien befindlichen deutschen Verbänden wurden Truppen der neu gebildeten Heeresgruppe B, deren Hauptquartier zunächst in München eingerichtet wurde, an der Alpengrenze zusammengezogen.
Hauptziele der Operation waren:
- die Entwaffnung der italienischen Truppen
- die Festsetzung der italienischen Flotte
- die Beschlagnahmung von Waffen und sonstiger kriegswichtiger Ausrüstung
- die vollständige Räumung Sardiniens und Korsikas
- Stabilisierung der übrigen Fronten in Italien.
Durch das Mithören eines Funkferngespräches zwischen Roosevelt und Churchill am 29. Juli war die deutsche oberste Führung frühzeitig über den bevorstehenden Waffenstillstand unterrichtet.
Ab dem 1. August rückten Truppen der Heeresgruppe B mit italienischer Zustimmung über die Grenze und besetzten trotz italienischer Beschwerden (die italienische Führung hätte eine Verstärkung der Front befürwortet) nach und nach Oberitalien. Die 2. Fallschirmjäger-Division flog aus Frankreich ein und bezog Stellungen um Rom. In der Folge fand am 6. August eine Konferenz in Tarvis statt, bei der das gegenseitige Misstrauen jedoch nur oberflächlich übertüncht wurde. In der Tat hatten die Italiener zu diesem Zeitpunkt bereits Gespräche mit den Westalliierten aufgenommen. Wenig später begannen die Vorbereitungen zur Evakuierung der auf Sizilien eingesetzten Truppen der Achsenmächte auf das Festland.
Verlauf
Am 3. September landeten zwei britische Divisionen bei nur minimalem Widerstand der Verteidiger auf dem italienischen Festland. Am gleichen Tag schloss die neue italienische Regierung den Waffenstillstand von Cassibile mit den Alliierten, der jedoch erst am 8. September bekanntgegeben wurde. Daraufhin leitete der Oberbefehlshaber Süd, Generalfeldmarschall Albert Kesselring, in seinem Befehlsbereich den Fall Achse ein, in welchem die Deutschen alle italienischen Verbände entwaffneten. Mit der Durchführung der Operation in Norditalien wurde Generalfeldmarschall Erwin Rommel betraut.
Das OKW hatte eine solche Entwicklung bereits Anfang 1943 befürchtet und im Verlauf des ersten Halbjahres 1943 deutsche Truppen strategisch auf alle Regionen Italiens verteilt. Dies sollte den schnellen Erfolg der Operation sicherstellen.
Am 10. September besetzten deutsche Truppen Rom und am 12. September gelang es einem deutschen Fallschirmjäger-Kommando, Mussolini aus seiner Gefangenschaft im Hotel Campo Imperatore zu befreien (Unternehmen Eiche). Mussolini wurde nach Ostpreussen gebracht; er übernahm wenig später die Leitung einer Marionetten-Regierung in Norditalien (Republik von Salò) und setzte den Kampf an deutscher Seite fort. Ebenfalls am 10. September errichteten deutsche Heeresgruppen die Operations-zone Adriatisches Küstenland und die Operationszone Alpenvorland, die kurz darauf in die Republik von Salò eingegliedert wurden.
Die italienische Flotte konnte sich zu grossen Teilen dem Zugriff entziehen – lediglich das Schlachtschiff Roma wurde durch deutsche Bomber versenkt. Auf den griechischen Inseln Kefalonia und Korfu leisteten die dort stationierten italienischen Truppen heftigen Widerstand gegen ihre Entwaffnung. Im Massaker auf Kefalonia (21./22. September 1943) wurden nach ihrer Gefangennahme mehr als 5.000 italienische Soldaten erschossen.
Resultate
Laut Bericht der Heeresgruppe B wurden allein bis zum 19. September insgesamt 82 italienische Generäle, 13.000 weitere Offiziere und ca. 400.000 Soldaten entwaffnet und in Gefangenschaft genommen – hiervon waren 183.000 Soldaten bereits in Internierungs-lager in Deutschland überstellt worden. Auf Anweisung Hitlers erhielten sie nicht den Status von Kriegsgefangenen, sondern von Militärinternierten, auf die die Genfer Konventionen nicht angewendet wurden.
Vom 8. September 1943 bis zum 2. Mai 1945 ermordeten Angehörige der Wehrmacht, SS und Polizei in Italien rund 11.400 italienische Militärangehörige, 44.720 Partisanen sowie 9.180 weitere Männer, Frauen und Kinder.
Am 13. Oktober erklärte die Badoglio-Regierung dem Deutschen Reich den Krieg. An der Seite der verbliebenen offiziellen italienischen Verbände operierte eine kampfstarke Partisanenarmee von 256.000 Frauen und Männern, die 1944 mit ihren Kampfhandlungen zehn Wehrmachtsdivisionen band.
Das Kriegstagebuch des OKW bezeichnete die Zeit zwischen dem abgehörten Gespräch (Churchill – Roosevelt) und dem 8. September als:

„gut genutzt. Die unter mancherlei Vorwänden erfolgte Infiltration einer ganzen deutschen Armee nach Nord- und Mittelitalien unter gleichzeitiger Sicherung der von den Italienern besetzten Passstrassen und Eisenbahn-Kunstbauten ist ein organisatorisches und militärpolitisches Meisterstück des Wehrmachtführungsstabes gewesen. Auch war es noch rechtzeitig gelungen, auf dem Balkan die Befehlsverhältnisse so zu regeln, dass deutsche Verbände an allen wichtigen Abschnitten standen bzw. an sie in Kürze herangeführt werden konnten. Infolge des vorzeitigen Bekanntwerdens der Kapitulation Italiens am 8. September abends gelang es, die italienische Wehrmacht so rasch zu entwaffnen, dass der Gegner dieses Schwächemoment der deutschen Truppen, die zunächst durch die Entwaffnungsaktion gebunden waren, nicht auszunutzen vermochte“.
Belgorod-Charkower Operation (03.08.1943 – 23.08.1943)
Die Belgorod-Charkower Operation (auch als Operation Rumjanzew bekannt; russisch Белгородско-Харьковская операция) war eine Offensive der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg, die vom 3. bis zum 23. August 1943 dauerte und aus sowjetischer Sicht als Teil der Schlacht am Kursker Bogen angesehen wird. Die Operation war Teil der lange geplanten sowjetischen Sommeroffensive, in deren Verlauf fast alle Fronten der Roten Armee auf breiter Front zum Angriff übergingen. Während der Operation wurden am 5. August Belgorod und am 23. August Charkow von den deutschen Besatzern zurückerobert.
Die Vorgeschichte
Anfang Juli eröffnete die Wehrmacht ihre Offensive gegen den Kursker Bogen, welche sich aber gegen gut aufgestellte sowjetische Verteidiger festlief. Die Operation, die letzte deutsche Grossoffensive an der Ostfront, wurde daraufhin von Hitler abgebrochen. Die Rote Armee begann teilweise schon während des deutschen Angriffes ihrerseits ihre lange geplante Sommeroffensive. Teil dieser umfassenden Offensive war auch die Operation Rumjanzew, die als direkter Gegenangriff gegen die vorstossenden deutschen Verbände geplant war. Dafür wurde eine ganze sowjetische Front (vergleichbar mit einer deutschen Heeresgruppe) als Reserve aufgestellt. Da der deutsche Angriff die sowjetische Führung veranlasst hatte, diese Reserve frühzeitig einzusetzen, konnte die Operation Rumjanzew nicht zum geplanten Termin beginnen. Insbesondere die hohen Verluste an Panzern machten eine Auffrischung nötig.
Während die Gegenoffensive nördlich von Kursk (Operation Kutusow) im vollen Gange war, blieb es daher um Belgorod herum ruhig. Zusammen mit den enormen Panzerverlusten der Woronescher und Steppenfront im südlichen Teil des Kursker Bogens führte dies zu der Fehleinschätzung der Wehrmacht, die Rote Armee wäre hier nicht mehr zu einem grossen Angriff fähig. Auf deutscher Seite kam es deshalb zu einem Abzug von mehreren Panzer-Divisionen. Viele davon wurden nach Norden geschickt, um die in Bedrängnis geratenen Armeen unter Walter Model zu unterstützen. Die 9. Armee sowie die 2. Panzerarmee sahen sich dort, während der Orjoler Operation, schweren Angriffen von drei sowjetischen Fronten ausgesetzt. Des Weiteren wurde zum Beispiel die SS-Panzergrenadier-Division Leibstandarte SS Adolf Hitler nach Italien verlegt, um dem erwarteten Abfall des Achsenpartners zu begegnen.
Die Operation Rumjanzew war von der Stawka als der Hauptstoss der Sommeroffensive geplant. Während die Operation Kutusow hauptsächlich die Verteidigung im Kursker Bogen unterstützen sollte, hatte Rumjanzew weitaus ambitioniertere Vorgaben. Die Operation zielte darauf ab, die während des Unternehmens Zitadelle geschwächten deutschen Armeen zu zerschlagen.[5] Die 4. Panzerarmee sowie die Armeeabteilung Kempf sollten direkt am Kursker Bogen vernichtet werden, um dann nach Süden zu schwenken und die 1. Panzerarmee und die 6. Armee an der Schwarzmeerküste einzukesseln. Dies wäre dann die Vernichtung der ganzen Heeresgruppe Süd unter Erich von Manstein gewesen. Stalin wollte den Angriff bereits am 23. Juli beginnen, doch Schukow erklärte, dass die Verbände Zeit benötigten, um aufgefrischt zu werden. Das erste Ziel der vorstossenden Armeen sollte die direkte Einnahme des wichtigen Knotenpunkts Bogoduchow sein. Von dort aus sollten die Panzerarmeen einschwenken und Charkow einkesseln. Um die Operation vorzubereiten, begannen bereits am 17. Juli die Süd- und Südwestfront mit Angriffen auf Mansteins Südflügel im Donezbecken (Donez-Mius-Offensive). Diese Angriffe scheiterten zwar unter hohen Verlusten, führten aber gleichzeitig zu einem Abzug von Truppen im Belgorod-Charkow-Sektor. Die Operation, welche als Maskirowka geplant war, erfüllte somit ihren Zweck, den Nordflügel Mansteins zu schwächen. Für den direkten Angriff standen schon in der ersten Phasen zehn Armeen bereit, davon zwei Panzerarmeen. Des Weiteren wurden fünf selbständige Korps bereitgestellt.
Truppenstärke
Zwei sowjetische Fronten, die Woronescher Front unter Nikolai Watutin und die Steppenfront unter Iwan Konew, verfügten über eine Truppenstärke von 1.144.000 Soldaten[8], 12.886 Geschütze, 2.418 Panzer und 1.311 Flugzeuge.[9] Die 4. Panzerarmee und die Armeeabteilung Kempf der deutschen Heeresgruppe Süd unter Erich von Manstein verfügten über insgesamt 250.000 Soldaten, 237 Panzer und Sturmgeschütze, sowie 796 Flugzeuge.[10] Durch Verstärkungen erhöhte sich die Zahl der deutschen Kampfwagen bis zum 10. August auf 567.[10] Durch gelungene sowjetische Ablenkungsangriffe im Süden und die kritische Lage im Norden, welche deutsche Truppenverschiebungen nötig machte, ergab sich im Bereich Belgorod/Charkow ein äusserst günstiges Verhältnis für die Rote Armee.
Operation Rumjanzew: Stärkeangaben von Karl-Heinz Frieser und David M. Glantz

Verlauf
Um 5 Uhr am 3. August begann die Operation mit einer dreistündigen Feuerwalze. Danach schwenkten die Artillerieeinheiten auf deutsche Ziele im Hinterland, gleichzeitig begannen die sowjetischen Bodentruppen ihren Vormarsch.[14] Zwei sowjetische Panzerarmeen überrannten die vorderen Stellungen, die durch das Artilleriefeuer und Luftangriffe geschwächt waren. Es entstand ein Loch zwischen Belgorod und Tomarowka, durch das sowjetische gepanzerte Stosskeile bis zu 25 Kilometer vorstiessen. Die sowjetische Infanterie drang bis zu acht Kilometer tief in die deutschen Stellungen ein. Am Abend des 3. August bauten zwei deutsche Panzer-Divisionen in der Nähe von Tomarowka eine Verteidigungsstellung auf und schafften es erstmals, den Vormarsch der beiden Panzerarmeen zeitweilig zu stoppen.
Teile von fünf deutschen Divisionen wurden im Bereich Borissowka teilweise eingeschlossen und versuchten, den sowjetischen Vormarsch zu verlangsamen. Die sowjetischen Schützendivisionen, die eigentlich den gepanzerten Stosskeilen folgen sollten, sahen sich gezwungen, gegen die deutschen Widerstandsnester vorzugehen. Das kostete Zeit und liess die Panzerverbände teilweise ohne infanteristische Unterstützung. Diese deutschen Verbände wurden später, bis zum 9. August, durch gekonnte Gegenangriffe der 11. Panzer-Division und der hastig herangeführten Grossdeutschlanddivision wieder entsetzt. Bereits am 5. August wurde Belgorod zurückerobert und die Rote Armee begann mit dem Angriff in Richtung Charkow. Die sowjetischen Verbände rissen mit ihrer grossen Masse an Panzern genau an der Nahtstelle der beiden deutschen Grossverbände ein Loch in die Front. Am 7. August klaffte eine 50 Kilometer grosse Lücke, durch die sowjetische Verbände weiter vordrangen. Dieser Erfolg gilt als einer der ersten sowjetischen operativen Durchbrüche durch deutsche Linien.
Gefechte bei Bogoduchow
Im deutschen Führungsstab kam es zu Panik und bereits verlegte Panzereinheiten wurden zurückbeordert. Bis zum 10. August wurden die deutschen Verbände durch zehn weitere Panzer- und Panzergrenadierdivisionen verstärkt, darunter die SS-Panzergrenadier-Division „Das Reich“ und SS-Panzergrenadier-Division „Totenkopf“ sowie die Division Grossdeutschland. Die nachgeführten Panzer-Divisionen erhöhten die Anzahl der deutschen Kampfwagen beträchtlich und ermöglichten erste Gegenangriffe. Teile der neu eingetroffenen SS-Panzer-grenadier Divisionen „Das Reich“ und „Totenkopf“ starteten am 12. August einen Gegenangriff gegen die sowjetische 1. Panzerarmee und 5. Gardepanzerarmee, die versuchten, südlich von Boguduchow weiter Raum zu gewinnen. Die sowjetischen Verbände hatten durch ihren raschen Vormarsch ihre Flanken überdehnt und waren dementsprechend verwundbar. In den folgenden schweren Gefechten konnten die deutschen Verbände grosse Teile der sowjetischen Einheiten einkesseln und aufreiben. Die Kämpfe werden als ähnlich intensiv wie die Kämpfe um Prochorowka beschrieben. Auch hier schafften es die sowjetischen Panzerverbände trotz beträchtlicher materieller Überlegenheit nicht, die deutschen Truppen zurückzudrängen. Alle Angriffe der Roten Armee wurden abgeschlagen. Die deutschen Verbände fügten den zwei sowjetischen Panzerarmeen beträchtliche Verluste zu, daraufhin stellten diese ihre Angriffe ein. Bis zum 17. August waren die zwei sowjetischen Armeen zurückgedrängt und büssten praktisch ihre gesamte Angriffskraft ein. Die beiden Panzerarmeen hatten von ihren ursprünglich über 1000 Panzern nur noch 200 zur Verfügung und waren vorerst nicht mehr dazu fähig, Operationen auszuführen.
Auch wenn der Angriff der beiden sowjetischen Panzerarmeen gestoppt wurde, war weiter westlich die Lage immer noch kritisch für die Wehrmacht. Die Lücke zwischen der 4. Panzer- und der 8. Armee (umbenannte Armeeabteilung Kempf) war immer noch nicht geschlossen. Die deutsche Führung entschied deshalb, mit einem Zangenangriff zu versuchen, die vorgedrungenen sowjetischen Verbände einzukesseln und zu vernichten und damit gleichzeitig die Front wiederherzustellen. Dafür stellte die 4. Panzerarmee das XXIV. Panzerkorps, das von Norden her angriff. Von Süden her griff die SS-Panzergrenadier-Division „Totenkopf“ der 8. Armee an. Am 18. August startete der Angriff und bereits am 20. August trafen sich Verbände der Divisionen Totenkopf und Grossdeutschland, unter Hyazinth Graf Strachwitz, im Rücken der sowjetischen Stosskeile.
Neben zwei sowjetischen Panzerkorps wurden grosse Teile der 6. Gardearmee und 27. Armee eingeschlossen. Die völlig unzureichenden infanteristischen Kräfte der Deutschen schafften es nicht, diesen Kessel völlig abzuriegeln, weshalb grosse Teile der sowjetischen Verbände ausbrechen und sich zurückziehen konnten. Um den Ausbruch der sowjetischen Kräfte zu unterstützen, griffen weitere Verbände der Roten Armee die Stellungen der deutschen 57. Infanterie-Division an. Das folgende schwere Artilleriebombardement traf die Stellungen der Division so hart, dass sie in Folge in Unordnung geriet und ihre Positionen verliess. Dieser Vorfall war für die Wehrmacht ein äusserst seltenes Ereignis und führte dazu, dass deutsche Truppen den Angriff aufgaben und sich wieder zurückzogen. Die Führung der Roten Armee entschied, sich vorerst auf Charkow zu konzentrieren, und nutzte ihre Überlegenheit weiter westlich nicht weiter aus.
Die Einnahme von Charkow
Nachdem der sowjetische Angriff in Richtung Westen vorerst gestoppt wurde, richtete sich der weitere Vormarsch nun primär auf Charkow. Die Stadt und ihre Umgebung waren stark befestigt. Für die Verteidigung der Stadt waren hauptsächlich das XXXXII. und XI. Armeekorps zuständig. Demgegenüber beteiligten sich bis zu fünf sowjetische Armeen an dem Angriff auf Charkow. Konew plante eine Umfassung der Stadt und griff bereits am 12. August den äusseren Verteidigungsring der Stadt an. Die 5. Garde-Panzerarmee unter Pawel Rotmistrow diente der Roten Armee dabei als Stosskeil. General Kempf wies auf die Gefahr eines möglichen Einschlusses der deutschen Truppen hin und forderte eine Aufgabe der Stadt, woraufhin Hitler forderte, die Stadt „unter allen Umständen“ zu halten. Die deutschen Verteidiger sahen sich aufgrund der Versorgungslage und der Übermacht der sowjetischen Verbände nicht imstande, die Stadt gegen die von mehreren Richtungen angreifenden Armeen zu verteidigen. Insbesondere der Munitionsmangel der Artillerie machte den Verteidigern zu schaffen.
General Kempf, der schon am 14. August für eine Räumung der Stadt plädierte, wurde durch Hitler seines Kommandos enthoben und durch General Otto Wöhler ersetzt, der aber auch für eine Evakuierung votierte. Die heftigen Kämpfe forderten auf beiden Seiten hohe Verluste. Die sowjetischen Angriffe wurden teilweise sehr übereilt ausgeführt und blieben deshalb oft mit hohen Verlusten liegen. Laut Frieser berichtete Stalin den Westmächten voreilig über die Einnahme der Stadt und liess deshalb diese ohne Rücksicht auf Verluste angreifen, um nicht dementieren zu müssen. Die Führung der 8. Armee (vorher Armeeabteilung Kempf) meldete nach den schweren Kämpfen erneut Munitionsmangel, so dass schliesslich Feldmarschall Erich von Manstein den Rückzug anordnete. Hitler hatte zuvor die unbedingte Verteidigung der Stadt gefordert, wurde aber im Generalstab überzeugt, die Erlaubnis für den Rückzug zu erteilen. Um die politischen Konsequenzen zu mindern, befahl er aber, die Stadt nur im Notfall aufzugeben und den Rückzug so lange wie möglich hinauszuzögern. Manstein zufolge befürchtete Hitler vor allem negative Auswirkungen auf die Haltung der neutralen Türkei und des verbündeten Bulgariens. Die 5. Garde-Panzerarmee versuchte am 22. August vergeblich, die Evakuierungsrouten der deutschen Verbände zu blockieren und konnte den relativ geordneten Rückzug der Wehrmacht nicht verhindern. Am 23. August wurde schliesslich das weitestgehend geräumte Charkow von Truppen der Roten Armee befreit. Das von beiden Seiten als Prestigeobjekt angesehene Charkow wechselte während des Krieges mehrmals den Besitzer. Diese letzte Schlacht um Charkow wird auch als Vierte Schlacht um Charkow bezeichnet.
Folgen
Auch wenn die Rote Armee ihr Ziel, die zwei deutschen Armeen zu vernichten, nicht erreichte, errang sie einen Sieg. Die Stawka war nach der Schlacht mit ihren Ergebnissen weitestgehend zufrieden und weitere Angriffe weiter nördlich zwangen Mansteins Truppen zum erneuten Rückzug. Die sich stetig entwickelnde Sowjetarmee erzwang schon in der Anfangsphase des Angriffes einen entscheidenden Durchbruch. Die neuen Verfahren der sowjetischen Panzerwaffe und insbesondere der Artillerie, die nach Studien der früheren Niederlagen entstanden, zeigten erstmals ihr Potential. Sowjetische Panzerverbände wurden konzentriert eingesetzt, um die deutschen Linien zu durchbrechen und dann in der operativen Tiefe zu agieren. Georgi Schukow nannte diese Angriffe später „Hammerschläge“, was die Intensität der Angriffe gut charakterisiert. Gleichzeitig wurde aber auch erneut offensichtlich, dass die Wehrmacht ihre taktische Überlegenheit nicht verloren hatte. So konnte sie letztendlich grössere Verluste auf ihrer Seite verhindern und sich relativ geordnet in Richtung Dnepr zurückziehen. Die taktische Überlegenheit der Wehrmacht, insbesondere bei den Panzerverbänden, führte zu relativ hohen Verlusten auf Seite der Roten Armee, die bei ihren „Hammerschlägen“ wenig Rücksicht auf Verluste nahm. Im Gegensatz zur Roten Armee war die Wehrmacht aber nicht in der Lage, ihre Verluste ausreichend zu kompensieren. Die bessere strategische Planung der Stawka führte dazu, dass mit Beginn der Operation Rumjanzew gleichzeitig der stetige Rückzug der Wehrmacht einsetzte. Die zahlenmässige sowjetische Überlegenheit mit nun verbesserter Führung sorgte dafür, dass die Wehrmacht nicht mehr in der Lage war, die strategische Initiative zu übernehmen. Die kontinuierlichen sowjetischen Angriffe auf breiter Front führten dazu, dass die Wehrmacht nicht mehr fähig war, Truppen für Operationen grösseren Ausmasses zu sammeln. Nach Beendigung der Operation Rumjanzew begann sofort die Schlacht am Dnepr. Im Zuge dieser Schlacht über-schritten sowjetische Verbände den Dnepr und befreiten grosse Teile der östlichen Ukraine.
Verluste
Die sowjetischen Verluste waren beträchtlich. In der Literatur wird das Buch von Generaloberst Grigori Kriwoschejew als Standardwerk für sowjetische Verluste akzeptiert. Demnach verloren die sowjetischen Verbände 255.566 Mann, wovon 71.611 tot oder vermisst waren. Bei den Angaben zu personellen Verlusten ist zu beachten, dass das damalige sowjetische Meldesystem oft fehlerhaft war. Deshalb sehen einige Historiker diese offiziellen Zahlen als untere Grenze an. Einzelne Historiker geben bis zu doppelt so hohe Zahlen an. An Panzerverlusten wurden 1.864 gemeldet, was in etwa den Verlusten des Unternehmens Zitadelle entspricht. Die Verluste an Flugzeugen sind schwer zu bestimmen, da die sowjetischen Archive hier nicht komplett sind. Frieser schätzt anhand der deutschen Abschussmeldungen, dass die Rote Luftwaffe 942 Maschinen verloren hat.
Die Verluste für die deutsche Seite sind ebenfalls nicht eindeutig zu bestimmen. Da Verlustmeldungen für deutsche Operationen angegeben sind und diese sich zeitlich von den sowjetischen unterscheiden, gibt es nur relativ genaue Schätzungen. Laut Frieser verloren die 4. Panzerarmee und die Armeeabteilung Kempf insgesamt 30.000 Mann, wovon 10.000 entweder tot oder vermisst waren. Die Panzerverluste sind noch schwieriger zu bestimmen. Frieser gibt für die Operationen um Kursk eine generelle Panzer-Verlustrate von 8:1 zugunsten der Wehrmacht an. Laut Frieser ist dieses Verhältnis auch bei Operation Rumjanzew gültig. Die deutsche Luftwaffe verlor 147 Flugzeuge. Vor allem die sowjetische Nachkriegsliteratur gibt für die deutsche Seite weitaus höhere Verluste an.
Smolensker Operation (07.08.1943 – 02.10.1943)
Die Smolensker Operation (auch als Operation Suworow bekannt; russisch Смоленская операция) war eine grosse Offensive der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg, die vom 7. August bis zum 2. Oktober 1943 dauerte. Im Laufe dieser Operation wurden vier Unteroperationen durchgeführt, die von russischen Militärhistorikern als Spas-Demensker Operation, Jelnja-Doro gobuscher Operation, Duchowschtschina-Demidower Operation und Smolensk-Roslawler Operation bezeichnet werden.
Truppenstärke
Die Westfront unter Sokolowski verfügte zusammen mit der linken Flanke der Kalininfront unter Jerjomenko über 1,253 Mio. Soldaten, 20.640 Geschütze, 1.436 Panzer und 1.000 Flugzeuge. Die deutsche Heeresgruppe Mitte unter Generalfeldmarschall von Kluge hatte etwa 850.000 Soldaten, 8.800 Geschütze, 500 Panzer und bis zu 700 Flugzeuge (3. Panzerarmee, 4. Armee und Teile der 9. Armee) zur Verfügung. Die 100–130 Kilometer tiefe deutsche Verteidigung wurde auf schwierigem Gelände mit zahlreichen Wäldern, Seen und Sümpfen aufgebaut.
Verlauf
Angriffe bei Spas-Demensk und Kirow
Am 7. August griff die 10. Gardearmee (General Trubnikow), die 33. und 49. Armee (Generalmajor Grischin) der Westfront an und drohten die deutsche Gruppierung bei Spas-Demensk einzukesseln, weshalb die deutsche 4. Armee (Generaloberst Heinrici) begann, sich geordnet zurückzuziehen. Beim deutschen XII. Armeekorps (General der Infanterie von Tippelskirch) konnten zunächst neuerliche Angriffe der 49. Armee gegen Spas-Demensk abgeschlagen werden. Im Raum Kirow hielt das LVI. Panzerkorps bei Pesotschnja Anschluss an das LV. Armeekorps der 2. Panzerarmee (ab 18. August herausgezogen, dann Befehlsbereich der 9. Armee).
Die Gruppe des Generals Hossbach war westlich des Flusses Bolwa konzentriert: im Süden hielt die 321. Infanterie-Division am Westufer des Flusses Stellungen gegenüber Kirow, im Westen und Norden des Frontvorsprunges hielten die 131. und 14. Infanterie-Division gegenüber der sowjetischen 10. Armee. Zwischen Bolschucha und Aleksandrowskoje spielte sich der Haupt-kampf um den Besitz der Rollbahn Roslawl-Juchnow ab, am nördlichen Flügel wurde hier die abgekämpfte 9. Panzer-Division aus der Reserve zugeführt. Zudem wurden die in ihrer Kampfkraft geschwächte 5. und 20. Panzerdivision zur Hilfe des durch die sowjetische 10. Armee und 5. mechanischen Korps (General Wolkow) bedrängten südlichen Abschnittes eingesetzt. Am 13. August wurde Spas-Demensk durch die 49. Armee im Zusammenwirken mit der 33. Armee (General Gordow) und dem 2. Garde-Panzerkorps (Generalmajor Burdenji) befreit, welche bis zum 20. August noch etwa 10 Kilometer vordrangen und dann an der Desna zur Verteidigung überging.
Am 13. August griff der linke Flügel der Kalinin Front (39. Armee unter General A.I. Sygin und 43. Armee unter General K. D. Golubjew) sowie der rechte Flügel der Westfront (31. Armee unter Generalleutnant Gluszdowski) in Richtung Duchowschtschina an. Der Angriff wurde am 17. August abgebrochen, weil Gegenstösse einsetzten und die Verteidigungslinien des deutschen XXVII. Armeekorps nicht überwunden werden konnten.
Jelnja-Dorogobuscher Operation
Am 18. August änderte sich nach dem Abgang der 2. Panzerarmee die Abschnittsgrenze zwischen der deutschen 9. und 4. Armee, die Strasse zwischen Roslawl und Juchnow bildete hinfort die neue Grenze, bei der zusätzlich das LVI. Panzerkorps in den Befehls-bereich der 9. Armee wechselte. Generaloberst Model schaltete wegen der Bedrohung der durch das Eingreifen der Brjansker Front (Generaloberst Popow) bedrohten Verbindungswege von Smolensk nach Roslawl zwischen den Korpskommandos LV. und LVI. das XXXXI. Panzerkorps ein. Am 27. August wurde das LVI. Panzerkorps überhaupt aus der Front herausgelöst und durch das Korps-kommando XXXXI. (General der Panzertruppe Harpe) ersetzt, welches den bedrohten Raum Smolensk zu schützen hatte.
Am 28. August erzielte die sowjetische Truppen einen erneuten Durchbruch, den die Wehrmacht vergeblich mit Gegenstössen zu schliessen versuchte. Im Abschnitt des deutschen IX. Armeekorps (General der Infanterie Schmidt) wurde am 30. August Jelnja durch die sowjetische 33. Armee befreit und am 1. September Dorogobusch durch die sowjetische 5. Armee (Generalmajor Polenow) freigekämpft. Am 6. September wurden eine Infanteriedivision und eine SS-Brigade aus der Reserve herangezogen, welche das weitere Vordringen der sowjetischen Truppen zunächst noch eindämmen konnten.
Duchowschtschina-Demidower Operation
Nach der Umgruppierung der sowjetischen Truppen eröffneten diese am 14./15. September eine neue Angriffsphase, welche auch den rechten Flügel der deutschen 3. Panzerarmee erfasste. Am 14. September eröffneten Truppen der Kalinin Front den Angriff auf Demidow und Duchowschtschina. Den Hauptangriff führte die 39. Armee (jetzt unter Generalleutnant N. J. Bersarin) und der linke Flügel der 43. Armee (Generalleutnant K. D. Golubjew) mit zusammen 12 Schützendivisionen, dazu aus der Reserve das 5. Garde-Schützenkorps. Truppen des rechten Flügels der Westfront (31., 5. und 68. Armee) versuchten in die deutschen Stellungen im Raum Jarzewo einzubrechen, geplant war nach Überquerung der Flüsse Vop und Dnjepr, die Vereinigung mit dem linken Flügel der Kalinin-Front zu erreichen. Bis zum Ende des Tages konnten die deutschen Stellungen auf 30 Kilometer Breite zwischen 3 und 13 Kilometer tief eingedrückt worden. Nach 4-tägigen Kämpfen war die Verteidigung des deutschen VI. und XXVII. Armeekorps vollständig durchbrochen. In der Nacht des 19. September drang die 39. Armee nach Unterstützung der 3. Luftarmee (General-leutnant Papiwin) in Duchowschtschina ein. Die 43. Armee rückte am 22. September nach zweitägigem Kampf mit dem 91. Schützenkorps (Generalmajor Fjodor Andrejewitsch Wolkow) in Demidow ein.
Smolensk-Roslawler Operation
Am 15. September wurden die Verteidigungslinie der deutschen 4. Armee fast überall durchbrochen, die sowjetischen Truppen wurden durch im Hinterland operierende Partisanen unterstützt. Die Hauptangriffe der Westfront wurde jetzt von der 10. Garde-, der 21. und 33. Armee über Potschinok auf Orscha angesetzt. Die Armeen des rechten Flügels (31., 5. und neu eingeführte 68. Armee) sollten die deutsche Gruppierung bei Smolensk umfassen, während der linke Flügel (49. und 10. Armee) sich auf die Einnahme von Roslawl konzentrieren und die Erreichung des Sosch-Abschnittes zu forcieren hatte. Am 16. September eroberten Einheiten der 31. Armee (36. Schützenkorps unter Generalmajor Olescha) die Stadt Jarzewo.
Am 23. September schnitten sowjetische Truppen die Eisenbahnlinie zwischen Smolensk und Roslawl ab und bedrohten das südliche Vorfeld von Smolensk. Die Stadt Potschinok wurde von Streitkräften der 33. Armee eingenommen. Am 23. September musste infolge der Gesamtlage Smolensk vom XXXIX. Panzerkorps geräumt werden und wurde vom sowjetischen 72. Schützenkorps (Generalmajor Prokofjew) der 31. Armee besetzt. Nordwestlich davon fiel die Stadt Rudnja am 29. September in die Hände des 5. Schützenkorps (Generalmajor Viktor Genrichowitsch Poznjak) der 39. Armee. Am 25. September wurde Roslawl durch die sowjetische 10. Armee befreit. Am 2. Oktober erhielten die sowjetischen Truppen im Raum östlich von Tschaussy den Befehl die Offensive zu stoppten. Die Truppen der Westfront beendeten die Operation an der neuen Frontlinie Ljady, Drybin und am Fluss Pronja.
Durch den zusätzlichen Angriff der Brjansker Front hatte sich die Lage der Heeresgruppe Mitte bis zum 3. Oktober in andauernden Kämpfen weiter verschlechtert. Der Zusammenhang zur Heeresgruppe Süd war ebenfalls nur vage, weil die Ausweichbewegungen an ihren inneren Flügeln nicht in Übereinstimmung erfolgten.
Verluste und Folgen
Die Rote Armee stiess auf der 400 km breiten Front 200–250 km nach Westen vor, zerschlug 7 deutsche Divisionen, fügte weiteren 14 schwere Verluste zu, betrat zum ersten Mal Weissrussland und verlor 451.500 Soldaten (108.000 davon Tote). Diese Operation entlastete zugleich die sowjetischen Truppen in der Schlacht am Kursker Bogen, die aus sowjetischer Sicht bis zum 23. August 1943 dauerte.
Donezbecken-Operation (16.08.1943 – 22.09.1943)
Die Operation Donezbecken oder Donbass-Operation (russisch Донбасская операция ‚Donbasskaja operazija‘) war eine Schlacht während des Zweiten Weltkrieges an der deutsch-sowjetischen Front vom 16. August bis zum 22. September 1943. Dabei durch-brachen die sowjetische Südwest- und Südfront zunächst die deutschen Linien am Donez und dem Mius im südlichen Grenzbereich von Russland und der Ukraine. Dies war im Kern eine erfolgreiche Wiederaufnahme der kurz zuvor erfolgten, in ihren Zielen weitgehend gescheiterten Donez-Mius-Offensive. In weiterer Folge eroberte die Rote Armee grosse Teile des wirtschaftlich bedeutenden Donezbeckens zurück, darunter die Städte Mariupol, Taganrog und Stalino. Grosse Teile der deutschen Heeresgruppe Süd mussten sich hinter den Dnepr zurückziehen.
Hintergrund
Das Donezbecken war vor allem als Kohleabbaugebiet von Bedeutung. Vor dem Kriegsausbruch lieferte es ca. 60 % der Stein- und 75 % der Kokskohle der UdSSR. Weiterhin waren dort rund die Hälfte aller metallurgischen Betriebe, zwei Drittel der chemischen Industrie und drei Viertel der Wärmekraftwerke angesiedelt. Von der Eisenproduktion entfielen 30 % und von der Stahlerzeugung 20 % auf dieses Industriegebiet. Im Sommer/Herbst 1941 wurde die Industrie fast vollständig evakuiert oder zerstört. Unter Leitung der Berg- und Hüttenwerksgesellschaft Ost (BHO) förderte die deutsche Besatzungsmacht mit täglich 15.000 Tonnen (Juli 1943) noch etwa 5 % der Vorkriegsproduktion an Kohle.
Vom Frühjahr bis zum Sommer 1943 war es an der deutsch-sowjetischen Front kaum zu bedeutenden Kämpfen gekommen. Erst die von der sowjetischen Führung erwartete deutsche Offensive gegen den Kursker Bogen (Unternehmen Zitadelle), welche am 5. Juli 1943 begann, löste eine weitere Serie von Operationen entlang der gesamten Frontlänge aus. Um den Druck der deutschen Angriffe im Raum Kursk zu mindern, begann die Rote Armee bereits im Juli 1943 drei Gegenoffensiven nahe Leningrad (Dritte Ladoga-Schlacht), gegen den Frontbogen bei Orjol (Orjoler Operation) und am Südflügel der Front (Donez-Mius-Offensive). Letztere Operation sollte zur Rückeroberung des wirtschaftlich bedeutenden Donezbeckens führen, scheiterte aber nach geringen Anfangserfolgen.
Obwohl letztlich keine dieser Offensiven ihre weitgesteckten Ziele erreichte, banden sie doch die wenigen deutschen Reserven. Als deshalb im Mittelabschnitt der Front Anfang August 1943 weitere sowjetische Offensiven eingeleitet wurden (Belgorod-Charkower Operation; Smolensker Operation), verfügte die Wehrmachtführung kaum noch über nennenswerte Reserveverbände, um sie aufhalten zu können. An mehreren Frontabschnitten gewann das Vordringen der Roten Armee an Boden. Um diesen günstigen Augenblick zu nutzen, beschloss die sowjetische Führung einen weiteren Anlauf zur Rückeroberung des Donezbeckens. Das sowjetische Oberkommando beauftragte Anfang August 1943 die Süd- und Südwestfront mit der Vorbereitung neuer Offensiv-operationen, die für die Mitte des Monats vorgesehen waren.
Deutsche Lage
Im südlichen Teil der Ostfront stand die deutsche 6. Armee unter General der Infanterie Karl-Adolf Hollidt am Mius und die 1. Panzerarmee unter Generaloberst Eberhard von Mackensen am Donez. Beide gehörten zum Verband der Heeresgruppe Süd des Generalfeldmarschalls Erich von Manstein. Diese Armeen waren jedoch zugunsten der Kursk-Offensive geschwächt und aus-gedünnt worden. So war die Bezeichnung „Panzerarmee“ irreführend, denn sie verfügte über keinerlei Panzertruppen. Stattdessen hatte sie in ihrem Bestand das XXX. Armeekorps (drei Inf.Div.), das XXXX. Panzerkorps (drei Inf.Div.) und das LVII. Armeekorps (drei Inf.Div.). Die 6. Armee bestand aus dem XXIX. Armeekorps (drei Inf.Div., eine Kampfgruppe), dem XVII. Armeekorps (drei Inf. Div.) und dem Korps Mieth (IV.) (eine Geb.Div., zwei Inf.Div.). Durch die vorangegangenen Kämpfe der zweiten Julihälfte hatten die deutschen Truppen in diesen Abschnitten bereits hohe Verluste erlitten, die noch nicht hatten ersetzt werden können. Allein die 6. Armee hatte 3298 Gefallene, 15.817 Verwundete und 2254 Vermisste zu beklagen. Die 384. Infanterie-Division beispielsweise war so ausgedünnt, dass sie aus der Front herausgelöst werden musste. Für einen gewissen Ausgleich konnten lediglich die 17. Infanterie-Division und die 15. Luftwaffen-Felddivision herangeführt werden.
Bei den Kämpfen war es der sowjetischen Südfront gelungen, einen Brückenkopf am westlichen Ufer des Mius zu errichten. Erst durch den Gegenangriff mehrerer deutscher Panzerdivisionen, die aus dem Raum Kursk abgezogen worden waren, konnte dieser wieder beseitigt werden. Somit konnte sich die Verteidigung wieder auf den Lauf des Flusses stützen. Anders gestaltete sich die Lage am Donez: Hier hatte die sowjetische Südwestfront ebenfalls einen Brückenkopf erobert, den die Deutschen mangels ausreichender Kräfte nicht auch beseitigen konnten. Der Brückenkopf blieb daher, wie Generalfeldmarschall von Manstein sich ausdrückte, eine „schwärende Wunde in der Front der 1. Panzer-Armee“. Da die deutsche Führung eine Fortsetzung der sowjetischen Offensive aus diesem Brückenkopf erwartete, konzentrierten sie hier mit der 16. Panzer-Grenadier-Division und der 23. Panzer-Division die einzigen schwachen Reserven der Heeresgruppe Süd hinter der Front.
Sowjetische Planungen
Am 6. August 1943, nur zwei Tage nach der gescheiterten Donez-Mius-Offensive, erliess das sowjetische Hauptquartier seine Direktive №30160. Die Südwestfront unter Generaloberst R.J. Malinowski und die Südfront unter Generaloberst F.I. Tolbuchin erhielten den Auftrag neue Operationen vorzubereiten. Wie schon im Juli war ein konzentrisches Vorgehen auf Stalino vorgesehen, welches zwischen dem 13. und 14. August beginnen sollte. Zur Koordination des Vorgehens beider Fronten, aber auch zur besseren Kooperation mit den Nachbarfronten wurde der Chef des sowjetischen Generalstabes Marschall der Sowjetunion A.M. Wassilewski als Vertreter des Hauptquartiers zum südlichen Kriegsschauplatz abkommandiert.
Am 7. August 1943 traf Wassilewski im Hauptquartier der Südwestfront ein und arbeitete dort mit Generaloberst Malinowksi und dem Stab der Front einen Operationsplan aus. Dieser sah einen Hauptstoss südlich von Isjum aus dem Brückenkopf jenseits des Donez heraus in Richtung Barwenkowo und Losowaja, Pawlograd und Sinelnikowo vor. Für die Operation waren die 6. Armee (Gen.Lt. I.T. Schljomin), die 12. Armee (Gen.Maj. A.I. Danilow) und die 8. Gardearmee (Gen.Lt. W. I. Tschuikow) vorgesehen. Als besonders bewegliche Kräfte standen das 23. Panzerkorps (Gen. J. G. Puschkin), das 1. mechanisierte Gardekorps (Gen. I.N. Russijanow) sowie das 1. Gardekavalleriekorps zur Verfügung, die von den Kräften der 17. Luftarmee unterstützt werden sollten.
Am 9. August weilte Wassilewski dann im Hauptquartier der Südfront, wo er mit Generaloberst Tolbuchin und dessen Stab die Pläne für die Operationen am Mius entwarf. Die Anstrengungen sollten sich demnach auf einen nur zehn bis zwölf Kilometer breiten Abschnitt nahe Kuibyschewo konzentrieren. An ihm sollten die 5. Stossarmee (Gen.Lt. W.D. Zwetajew) und die 2. Gardearmee (Gen.Lt. G.F. Sacharow), unterstützt von Teilen der 28. Armee (Gen.Lt. F.G. Gerassimenko), den Übergang über den Mius und den Durchbruch durch die deutsche Verteidigung erzwingen. Zu diesem Zweck wurden 120 Geschütze pro Front-kilometer zum Einsatz gebracht, während die 51. Armee (Gen.Lt. J.G. Kreiser) nahe Sneschnoje einen Unterstützungsangriff führen sollte. Nach einem erfolgreichen Durchbruch standen dann das 2. und 4. mechanisierte Gardekorps sowie das 4. Gardekavalleriekorps zur Verfügung, um über Amwrossijewka und Starobeschewo in Richtung Stalino vorzustossen. Die 8. Luftarmee (General T.T. Chrjukin) hatte dieses Vorgehen zu unterstützen.
Am 10. August 1943 bestätigten Stalin als Oberster Befehlshaber und sein Hauptquartier die Operationspläne, die praktisch nichts anderes waren als eine voraussehbare Wiederaufnahme der Offensiven vom Juli 1943. Allerdings bestand noch immer das Problem, dass die Südfront von den vorangegangenen Kämpfen geschwächt war. Um diesen Nachteil auszugleichen, erhielt Wassilewski die Erlaubnis, diese Front zwei Tage später als die Südwestfront angreifen zu lassen. Als die Vorbereitungen zu den neuerlichen Offensiven abgeschlossen waren, standen den beiden sowjetischen Fronten schliesslich 1.053.000 Soldaten, 21.000 Geschütze und Granatwerfer sowie 1257 Panzer und Selbstfahrlafetten zur Verfügung, die von 1400 Flugzeugen unterstützt wurden.
Verlauf
Der Angriff der Südwestfront bis Ende August 1943
Am 13. August 1943 begannen die Truppen der Südwestfront mit einem Angriff über den Donez südlich von Charkow. Dort setzten sie drei Armeen ein, um die nördlich vorgehende Steppenfront bei der Einnahme der Stadt zu unterstützen. Obwohl diese Operation in keinem Zusammenhang mit den Kampfhandlungen im hunderte Kilometer entfernten Donezbecken stand, markiert das Datum in der sowjetischen Geschichtsschreibung den offiziellen Beginn der „Donezbecken-Operation“.
Tatsächlich traten erst am 16. August 1943 die sowjetische 6. und 12. Armee sowie die 8. Gardearmee aus dem Brückenkopf nahe Isjum zum Angriff an. Nach deutschen Angaben sollen dabei am ersten Tag auf sowjetischer Seite elf Schützendivisionen und 130 Batterien zum Einsatz gekommen sein. Der Schwerpunkt des Angriffs lag im Bereich der sowjetischen 12. Armee südlich von Isjum. Bereits in den ersten Stunden der Offensive erzielten die Angriffsverbände hier einen Einbruch in die Stellungen der deutschen 46. Infanterie-Division. Diesen riegelte jedoch schon am Nachmittag ein Gegenangriff der deutschen 23. Panzer-Division ab und eroberte bis zum Abend das verlorene Gelände zurück. In den folgenden Tagen konzentrierten sich die Kämpfe auf den Ort Dolgenkaja. Hier brachte die Südwestfront vom 16. bis zum 27. August 1943 insgesamt neun Schützendivisionen, neun Panzerbrigaden, ein Garde-Panzerregiment und eine motorisierte Schützenbrigade zum Einsatz. Zwar gelangen der Roten Armee immer wieder tiefe Einbrüche in die deutschen Stellungen, doch Gegenangriffe der deutschen 23. Panzer-Division, 16. Panzer-Grenadier-Division und 17. Panzer-Division fügten ihr gleich darauf schwere Verluste zu und warfen sie zurück.
Diese Angriffe und Gegenangriffe erwiesen sich für beide Seiten als verlustreich. Da genaue Angaben zu den Gesamtverlusten fehlen, können nur beispielhaft einige Zahlen angeführt werden. So meldete allein die 23. Panzer-Division, die im Brennpunkt der Kämpfe stand, den Abschuss von 302 feindlichen Panzern. Allerdings hatte sie selbst 71 Offiziere und 1746 Unteroffiziere und Mannschaften verloren. Nach zwölftägigen Gefechten verfügte die Division deshalb kaum mehr über infanteristische Kräfte. Auf sowjetischer Seite führten die verlustreichen und ergebnislosen Angriffe zu einem Umdenken. Marschall Wassilewski und Generaloberst Malinowski beschlossen „das sinnlose Anrennen einzustellen“ und stattdessen an anderer Stelle einen Durchbruch zu versuchen. Dazu sollte die 8. Gardearmee des Generalleutnants Tschuikow weiter nach Osten verschoben werden. Für die Umgruppierung der Truppen wurden mehrere Tage eingeplant. Damit hatte die deutsche 1. Panzerarmee die Offensive der sowjetischen Südwestfront vorerst abgewehrt.
Der Angriff der Südfront bis Ende August 1943

„Die Erde erzitterte, und ein Gedröhn wie ein endlos rollender Donnerschlag hob an. Länger als eine Stunde währte dieses Grollen, von Zeit zu Zeit durch ‚Katjuscha‘-Salven unterbrochen, die gleich Lawinen donnerten […] Über der gegnerischen Stellung stand eine schwarze, undurchdringliche Wand aus Rauch und Staub. Die Artillerie vollbrachte ihr Vernichtungswerk“.
Am 18. August 1943 trat schliesslich auch die Südfront des Generaloberst Tolbuchin zum Angriff über den Mius an. Bereits in den vorangehenden Tagen hatten kleinere Vorstösse in Regimentsstärke die sowjetische Ausgangsbasis verbessern sollen. Am Morgen des Hauptangriffstages liess die Südfront um 5 Uhr das Trommelfeuer von 5000 Geschützen und Granatwerfern auf die deutschen Linien niedergehen. Von diesen waren 2000 in den wenige Kilometer breiten Angriffstreifen der 5. Stossarmee und 2. Gardearmee zusammengefasst, wo 120–200 Geschütze (die Angaben variieren) auf einen Frontkilometer kamen. Kurz darauf gingen 17 sowjetische Divisionen und vier Panzerbrigaden gegen die Verteidigungspositionen von drei deutschen Divisionen vor. Während die 306. und 336. Infanterie-Division ihre Positionen halten konnten, wurde die Stellung der 294. Infanterie-Division des XVII. Armeekorps förmlich überrannt. Bereits am ersten Angriffstag erzielten die sowjetischen Truppen hier einen zehn Kilometer tiefen Einbruch. Auch schnell herangebrachte Sperrverbände der 111. Infanterie-Division konnten den Durchbruch nicht abriegeln, sodass die sowjetische 5. Stossarmee bis zum Abend des 19. August weitere zwölf Kilometer nach Westen vorstiess, die Krynka erreichte und einen Brückenkopf auf dem jenseitigen Ufer errichten konnte. Noch am gleichen Abend liess Generaloberst Tolbuchin das 4. mechanisierte Gardekorps des Generalleutnants Tanaschtschischin durch die Lücke in der deutschen Verteidigung einführen und den Durchbruch erweitern.
Die wenigen Reserven der Heeresgruppe Süd waren bereits in den Kämpfen am Donez gebunden, sodass die 6. Armee mit ihren geringen Verbänden auskommen musste, die jedoch bereits in der Front standen. Den etwa 800 Panzern und Selbstfahrlafetten der Südfront konnte sie zwar kaum etwas entgegenstellen, doch Generaloberst Hollidt sah eine Chance, die Lage zu bereinigen, indem er Gegenangriffe gegen die Basis des sowjetischen Durchbruchs ansetzte. Dieser war südlich Kalinowka nur drei Kilometer breit, was zu der Hoffnung veranlasste, die 5. Stossarmee hier abschneiden zu können. Unter dem Befehl des Kommandeurs der 3. Gebirgs-Division, Generalmajor Egbert Picker, konnten aus dem Bereich des IV. Armeekorps allerdings nur fünf Bataillone, sechs Batterien, eine Sturmgeschütz-Batterie und zwei Panzerjäger-Kompanien zusammengebracht werden, welche ab dem 20. August die sowjetische Nordflanke angriffen. Der Angriff kam zunächst gut voran, dann jedoch liess Tolbuchin das 4. mechanisierte Gardekorps wenden und zum Gegenangriff antreten. Obwohl es gelang, 84 sowjetische Panzer abzuschiessen, wurde die „Kampfgruppe Picker“ am 21. August wieder zurückgedrängt. In den beiden folgenden Tagen gelang es den sowjetischen Verbänden dann, die Lücke in der deutschen Front auf neun Kilometer zu verbreitern. Von der Krynka aus setzten die mech-anisierten Verbände der Roten Armee gleichzeitig zu einem weiteren Vorstoss an und eroberten am 23. August den wichtigen Verkehrsknotenpunkt Amwrossijewka. Nach dem Scheitern der Gegenangriffe stützte sich die Verteidigung der Deutschen nunmehr auf den Lauf der Krynka südostwärts von Kolpakowka, obwohl die sowjetischen Truppen diesen Fluss bereits weiter nördlich überwunden hatten.
Inzwischen trafen auch von der Heeresgruppe A entsandte Verstärkungen ein, darunter die 13. Panzer-Division. Allerdings hatte diese „Division“ nur die Stärke eines Panzergrenadier-Regiments mit sieben Panzern. Dieser Verband kam zunächst am 23. August bei der „Kampfgruppe Picker“ erfolglos zum Einsatz. Danach wurde sie in Eilmärschen in den Bereich des XXIX. Armeekorps südlich des sowjetischen Durchbruchs verlegt, um die Abwehr an der Krynka zu verstärken.
Der 25. und 26. August vergingen auf Seiten der Roten Armee mit Umgruppierungen und der Auffüllung der Munitionsbestände. Am Morgen des 27. August 1943 begann eine weitere Phase der sowjetischen Offensive, welche die Einkesselung eines Teils der deutschen 6. Armee vorsah. Aus dem Raum Amwrossijewka griffen das 4. mechanisierte Gardekorps und das 4. Kavalleriekorps nach Süden an. Die Kavallerie sollte das deutsche XXIX. Armeekorps einschliessen, während das 4. mechanisierte Gardekorps diese Operation nach Westen abschirmen sollte. Bereits am 28. August wurden die wichtigsten deutschen Rückzugswege abgeschnitten. Am folgenden Tag erreichten die Kavalleristen über Jekaterinowka den Mius-Liman bei Nataljewka. Die Gegenangriffe der 13. Panzer-Divisionen gegen die Einschliessungsbewegung blieben erfolglos. Im Kriegstagebuch der 6. Armee wurde zur Lage des XXIX. Armeekorps des Generals der Panzertruppen Erich Brandenberger notiert:

„Die Telefonverbindung mit dem Korps war unterbrochen. Stündlich musste damit gerechnet werden, dass die Verbände gespalten wurden und das Korps in einzelne Gruppen zerfiel“.
– Kriegstagebuch 6. Armee (Eintrag 30. August 1943)
Tatsächlich nahm der sowjetische Druck von allen Seiten zu. Die 2. Gardearmee und 28. Armee griffen von Norden her an, während die 44. Armee direkt auf Taganrog vorrückte. Den Seeweg blockierte zudem die sowjetische Asow-Flottille unter Konteradmiral S.G. Gorschkow, welche ebenfalls Truppen anlandete. Am 30. August wurde Taganrog schliesslich eingenommen.
Als sich am 27. August 1943 die Einschliessung des XXIX. Armeekorps abzeichnete, ergriff das Oberkommando der 6. Armee hastig Massnahmen. Es befahl dem Korps, seine rückwärtigen Dienste nach Mariupol abzuschieben und versammelte unter dem Kommando des Kommandierenden Generals des IV. Armeekorps, General der Infanterie Friedrich Mieth, Truppen für einen Gegenangriff. Diese umfassten die Masse der 3. Gebirgs-Division und der 17. Panzer-Division, welche vom Donez herangeholt worden war. Mit diesen Truppen griff General Mieth wiederholt an, um ein weiteres Vordringen der Roten Armee zu verhindern und erreichte am 30. August den Raum nördlich Kuteinikowo. Zu diesem Zeitpunkt setzten sich die Infanteriedivisionen des XXIX. Armeekorps aus ihren bisherigen Stellungen ab. Die dem Korps unterstellte 13. Panzer-Division führte den Durchbruchsversuch ab dem 30. August an. Am folgenden Tag – die vier Divisionen des XXIX. Armeekorps waren auf eine Fläche von etwa 25 km² zusammengedrängt, die unter sowjetischen Artilleriebeschuss lag – gelang den Truppen des Generals Brandenberger südlich Konkowo der Ausbruch. In der Nacht setzten sich beide Korps nach Westen an den Jelantschik ab. Allerdings hatten die einge-schlossenen Divisionen schwere Verluste erlitten. So zählte zum Beispiel das Luftwaffen-Jäger-Regiment 30 der 15. Luftwaffen-Felddivision nur noch 400 von ursprünglich 2400 Soldaten.
Das Ringen um den Rückzug
Da alle Bemühungen der 6. Armee gescheitert waren das sowjetische Vordringen aufzuhalten, kam Generalfeldmarschall von Manstein zu dem Schluss, dass der Südflügel seiner Heeresgruppenfront nicht mehr zu halten sei. Bereits vor dem sowjetischen Durchbruch hatte er den elf Divisionen der 6. Armee nur mehr einen Kampfwert von vier Divisionen zugebilligt. Er forderte von Hitler deshalb entweder Bewegungsfreiheit oder die Zuführung erheblicher Verstärkungen. In einer Besprechung in Winniza am 27. August sagte Hitler zwar weitere Verbände zu, doch in den folgenden Tagen zeigte sich, dass nirgendwo Divisionen entbehrt werden konnten, um sie der Heeresgruppe Süd zuzuführen. Eine vollständige Räumung des Donezbeckens verbot er jedoch. Nach der vorübergehenden Einschliessung des XXIX. Armeekorps erteilte Manstein der 6. Armee jedoch eigenmächtig den Befehl auf die vorbereitete „Schildkröten-Stellung“, eine Verteidigungslinie entlang dem Kalmius östlich von Stalino, auszuweichen. Erst am folgenden Tag billigte auch Hitler nachträglich diesen Schritt.
Die Auseinandersetzungen um eine Räumung des Donezbeckens, aber auch um einen Rückzug grösseren Ausmasses erfolgte unter den Eindrücken der Rückschläge entlang der gesamten Front seit dem Abbruch der Schlacht im Kursker Bogen. Schon im Frühjahr hatte der Generalstab die Anlage einer rückwärtigen Verteidigungslinie gefordert, die Hitler jedoch kategorisch ablehnte. Erst am 12. August 1943 gab Hitler endlich nach und genehmigte den Bau entlang des Dnepr (Panther-Stellung). Er verbot jedoch vorerst alle Ausweichbewegungen. So erklärte er, dass ohne die Kohle des Donezbeckens der Krieg verloren sei. Als der General-stabschef General der Infanterie Kurt Zeitzler diese Behauptung im Rüstungsministerium überprüfte, teilte ihm der Rüstungs-minister Albert Speer mit, dass dies nicht stimme und die Kohle dieses Gebietes überhaupt nicht in die wirtschaftlichen Berech-nungen einbezogen worden sei. Hitler verbot daraufhin auch die Kontaktaufnahme des Generalstabschefs mit anderen Ministerien.
Da die sowjetischen Verbände jedoch weitere Fortschritte erzielten und Hitler auch während einer Besprechung in seinem Haupt-quartier in Ostpreussen am 4. September nicht nachgeben wollte, sah sich Manstein veranlasst, ihn zu einer weiteren Unterredung ins Hauptquartier der Heeresgruppe Süd nach Saporoschje zu bitten. Dort erklärte er Hitler am 8. September noch einmal die aussichtslose Lage. Hitler stimmte schliesslich einem Rückzug zum Dnepr zu, ordnete allerdings an, dass dieser nur schrittweise und langsam zu erfolgen habe. Noch am gleichen Abend befahl Generalfeldmarschall von Manstein der 6. Armee und der 1. Panzerarmee, zum beweglichen Abwehrkampf überzugehen.
Der Rückzug zum Dnepr
Nachdem am 31. August 1943 der Befehl an die 6. Armee ergangen war, sich in die „Schildkröten-Stellung“ zurückzuziehen, begann sie sich schrittweise nach Westen abzusetzen. Am 4. September erreichten ihre Verbände die neue Verteidigungslinie. Die Truppen der sowjetischen Südfront drängten den Deutschen nach. Um ihre Schlagkraft zu erhöhen, führte das sowjetische Oberkommando dieser Front am 2. September 1943 zusätzlich das 20. Panzerkorps (Generalleutnant I.G. Lasarew) und das 11. Panzerkorps (Generalmajor N.N. Radkewitsch) zu.
Bedingt durch den Rückzug der 6. Armee musste auch die 1. Panzerarmee ihren rechten Flügel zurücknehmen. Die sowjetische Südwestfront versuchte dies auszunutzen und griff bei Isjum am 3./4. September erneut an. Wieder blieb der Angriff der 6. und 8. Gardearmee im deutschen Abwehrfeuer liegen. Doch am östlichen Flügel, wo die Verbände der 1. Panzerarmee der Ausweich-bewegung der 6. Armee folgten, konnte die 3. Gardearmee unter General Leljuschenko einen grösseren Raumgewinn erzielen. In rascher Folge fielen nun Proletarsk, Popasnaja und Artjomowsk. Generaloberst Malinowski und Marschall Wassilewski beschlossen, aus der übrigen Front das 1. mechanisierte Gardekorps und das 23. Panzerkorps herauszuziehen und damit die Truppen Leljuschenkos zu verstärken. Mithilfe dieser Verstärkungen durchbrachen die sowjetischen Truppen am 6. September 1943 den rechten Flügel der 1. Panzerarmee bei Konstantinowka. Damit öffneten sie eine Lücke zwischen der 6. Armee und 1. Panzerarmee, die sich bald auf 60 Kilometer verbreiterte. In dieser Lücke kämpften nur noch Reste von zwei deutschen Divisionen. So konnten Teile der 5. Stossarmee und 2. Gardearmee in Strassenkämpfen am 7./8. September 1943 Stalino erobern. Zwei Tage später fielen auch Mariupol und Barwenkowo.
Das General Leljuschenkos 3. Gardearmee unterstellte 1. mechanisierte Gardekorps und 23. Panzerkorps waren nach ihrem Durchbruch bei Konstantinowka weit nach Westen vorgestossen und standen bereits nahe Pawlograd im Rücken der Heeresgruppe Süd. Die Heeresgruppe reagierte darauf mit hastigen Improvisationen. Sie fasste die Reste der 23. Panzer-Division, 16. Panzer-Grenadier-Division und die neu herangekommene 9. Panzer-Division unter dem Befehl des XXXX. Panzerkorps zusammen, welches von General der Panzertruppe Sigfrid Henrici kommandiert wurde. Dieser setzte die drei Divisionen am 9. September von Norden und Süden gegen die Flanken des sowjetischen Vorstosses an, welche von Schützendivisionen gehalten wurden. In schweren Kämpfen gelang es ihnen, bis zum 12. September die Lücke zwischen der 1. Panzerarmee und 6. Armee bei Slawjanka wieder zu schliessen und dabei die Masse der beiden sowjetischen Korps abzuschneiden.
Ausklingen der Operationen
Nachdem es für den Augenblick gelungen war, die grösste Bedrohung der Heeresgruppe Süd abzuwenden, entschloss sich Generalfeldmarschall von Manstein zu einem gewagten Schritt. Da auch der Nordflügel seiner Heeresgruppe unter stetig wachsendem sowjetischen Druck stand, meldete er am 14. September 1943 an das Oberkommando des Heeres, dass er am folgenden Tag eigenmächtig Teilen seiner Heeresgruppe das Absetzen auf den Dnepr befehlen werde. Daraufhin kam es am folgenden Tag zu einer weiteren Unterredung mit Hitler in dessen Hauptquartier. Da Hitler den Argumenten Mansteins nichts mehr entgegensetzen konnte, stimmte er dem allgemeinen Rückzug schliesslich zu. Am 16. September 1943 wurde der Heeresgruppe Süd und der Heeresgruppe Mitte der Rückzug in die „Panther-Stellung“ gestattet.
Unterdessen standen die sowjetischen Verbände in der Linie Losowaja–Tschaplino–Guljai-Pole–Ursuf. Doch auch sie hatten schwere Verluste erlitten. Die letzte Reserve der Südwestfront, das 30. Schützenkorps, hatte der 3. Gardearmee zugeführt werden müssen, um die Verluste zu ersetzen, die durch den Gegenangriff des deutschen XXXX. Panzerkorps entstanden waren. Sie folgten den deutschen Truppen auf ihrem Rückzug deshalb nicht mehr so energisch, obwohl es örtlich auch weiterhin zu heftigen Rückzugsgefechten kam. Nach wenigen Tagen erreichten die sowjetischen Verbände der Südwestfront am 22. September 1943 den Dnepr. Die deutsche 1. Panzerarmee hatte sich rechtzeitig auf das jenseitige Ufer zurückziehen können. Nur im Raum Nikopol behauptete das deutsche XVII. Armeekorps noch einen Brückenkopf auf der östlichen Seite. Die anderen beiden Armeekorps der 6. Armee setzten sich in eine Verlängerung der „Panther-Linie“ ab, welche entlang der Molotschna (östlich von Melitopol) verlief und als „Wotan-Stellung“ bezeichnet wurde. Sie unterstand seit dem 16. September 1943 nicht mehr der Heeresgruppe Süd, sondern der Heeresgruppe A. Ihr folgte die sowjetische Südfront, bis auch hier die Front Ende September vorläufig zum Stehen kam.
Folgen / Verluste
Offizielle sowjetische Angaben sprechen für die Donezbecken-Operation von 273.522 Mann an Gesamtverlusten. Von diesen seien 66.166 Soldaten getötet oder als vermisst gemeldet worden. Darüber hinaus waren 886 Panzer und Selbstfahrlafetten, 814 Geschütze und Granatwerfer sowie 327 Flugzeuge verloren gegangen. Die deutschen Verluste in diesem Zeitraum sind nicht nachgewiesen. Allerdings waren die Verluste zumindest der Verbände sehr hoch, die im Brennpunkt der Kämpfe gestanden hatten. So zum Beispiel bei der 3. Gebirgs-Division, welche am 18. August insgesamt 2000 Mann an die „Kampfgruppe Picker“ abgegeben hatte: Von diesen kehrten fünf Tage später weniger als 200 zurück. Auch die 15. Luftwaffen-Felddivision musste kurze Zeit später aufgelöst werden. Besonders schwer wogen auch die materiellen Verluste. Die II. Abteilung des Panzer-Regiments 23 (von der 23. Panzer-Division) war erst im Sommer in Deutschland mit 85 Panzern vom Typ Pz.Kfw. V „Panther“ ausgerüstet worden. Mit diesen war die Abteilung erst Anfang September 1943 in die Rückzugskämpfe geraten und verlor bis zum 16. September 1943 alle Panzer bis auf fünf.
Die Verluste der Zivilbevölkerung lassen sich nur schwer abschätzen, da sich nicht feststellen lässt, wie hoch die Gesamt-bevölkerung zum Zeitpunkt der Kämpfe war und sich letztere auf ein weites Gebiet mit zahlreichen Ortschaften ausdehnten. Die deutsche Okkupationspolitik in den Jahren zuvor und die Deportationen im Zuge der Räumung dieser Gebiete stellen ebenfalls einen wichtigen aber kaum berechenbaren Faktor da. Fest steht, dass Stalino im Jahre 1940 über 507.000 Einwohner hatte. Bei der Rückeroberung der Stadt im September 1943 lebten dort nur noch 175.000 Menschen. Hinzu kamen kurz darauf jedoch weitere Verluste unter der Zivilbevölkerung durch Massenverhaftungen, die vom NKWD durchgeführt wurden. Tausende Sowjetbürger wurden wegen Kollaboration angeklagt und verurteilt. Da genaue Zahlen fehlen muss als Anhaltspunkt gelten, dass in den 1990er-Jahren nicht weniger als 3364 Menschen allein aus Stalino rehabilitiert wurden. Sowjetische Historiker gehen zudem davon aus, dass mindestens noch einmal soviele Einwohner der Stadt zwar ebenfalls verurteilt aber nicht rehabilitiert worden waren.
Verbrannte Erde
Da Hitler dem Donezbecken einen grossen wirtschaftlichen Wert beimass, befahl er die Zerstörung aller Industrieanlagen. Zum Verantwortlichen für diese „Evakuierung“ ernannte er noch am 31. August 1943 den General der Infanterie Otto Stapf als Leiter des „Wirtschaftsstabes Ost“. Allerdings erlaubte die sich schnell verändernde Frontlage keine planmässige Räumung, sodass nunmehr Generalfeldmarschall von Manstein selbständig die weitgehende Zerstörung aller wirtschaftlichen Anlagen befahl:

„Alles, was nicht abtransportiert werden kann, unterliegt der Zerstörung, Pumpstationen und Energiezentralen, überhaupt sämtliche Kraftwerke und Transformatorenstationen, Schächte, Betriebseinrichtungen, Produktionsmittel aller Art, Getreide, das nicht mehr abtransportiert werden kann, Siedlungen und Häuser“.
Insgesamt kamen 284.000 Zivilisten ums Leben und 268.000 Tonnen Getreide, 280.000 Rinder, 209.000 Pferde, 363.000 Schafe, 18.700 Schweine, 800 Traktoren und 820 LKW wurden auf dem Rückzug mitgenommen. Weitere 941.000 Tonnen Getreide, 13.000 Stück Vieh, 635 LKW und 10.800 Traktoren wurden vernichtet. Weiterhin wurden die Industriezentren wie beispielsweise in Stalino oder Mariupol zerstört. Der Beauftragte des Nationalkomitees Freies Deutschland Friedrich Wolf befand sich in diesen Tagen im Donezbecken und berichtete seiner Ehefrau am 2. Oktober 1943:

„Ganz Mariupol verbrannt, gesprengt. Wir waren dort zehn Stunden nach den Deutschen. In alle Häuser waren Minen gelegt, alles systematisch in die Luft gesprengt, rücksichtslos, ob sich alte Frauen und Kinder noch darin befanden“.
Die Zerstörungen erwiesen sich jedoch nicht als nachhaltig. Bereits im Februar 1943, als sich das erste Mal eine Rückeroberung der ukrainischen Industriegebiete abzeichnete (Woronesch-Charkiwer Operation), hatte die sowjetische Regierung Vorbereitungen für den Wiederaufbau des Donezbeckens getroffen und entsprechende Direktiven erteilt. Diese erwiesen sich nach dem sowjetischen Erfolg als so effektiv, dass Ende 1943 die Kohlegruben des Donezbeckens wieder etwa 20 % der sowjetischen Kohleproduktion deckten. Bis 1945 wurden dort zudem 7500 Betriebe wiederhergestellt.
Schlacht am Dnepr (26.08.1943 – 20.12.1943)
Die Schlacht am Dnepr (russisch Битва за Днепр) fand zwischen Verbänden der Wehrmacht und der Roten Armee im Krieg Deutschlands gegen die Sowjetunion 1941–1945 vom 26. August bis zum 20. Dezember 1943 statt, sie bildete die Fortsetzung der sowjetischen Sommeroffensive nach dem Scheitern des Unternehmens Zitadelle, der letzten deutschen Grossoffensive im Osten. Die Schlacht am Dnepr stellte eines der seltenen Beispiele der Überquerung eines grossen Flusses bei starker feindlicher Gegenwehr dar. Die monatelangen Operationen erreichten am 6. November 1943 mit der sowjetischen Rückeroberung Kiews ihren Höhepunkt.
Ausgangslage
Nach der sich Mitte Juli abzeichnenden Niederlage in der Schlacht bei Kursk (Unternehmen Zitadelle) und den folgenden Gegen-offensiven der Roten Armee, plante das Oberkommando der Wehrmacht, eine starke Verteidigungslinie von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer aufzubauen. Vor den beiden nördlichen Heeresgruppen sollte dieser von Hitler propagierte „Ostwall“ etwa an der Linie Narwa-Pskow-Witebsk-Gomel zum Dnepr im Raum Kiew verlaufen und das weitere Vordringen der sowjetischen Westfront aufhalten. Nachdem am 23. August 1943 Charkow durch die Rote Armee befreit worden war, eröffneten drei sowjetische Fronten eine weitere Offensive.
Die 4. Panzerarmee und die 8. Armee bildeten den Nordflügel der Heeresgruppe Süd, der während der Tschernigow-Poltawa-Operation angegriffen wurde. Die Heeresgruppe Süd unter Generalfeldmarschall Erich von Manstein sollte den sowjetischen Vormarsch zum Dnepr stoppen. Seine Heeresgruppe zählte 1,2 Millionen Soldaten, 12.600 Geschütze, 2.100 Panzer und 2.100 Flugzeuge. Ihr standen fünf sowjetische Fronten (Zentralfront unter Rokossowski, Woronescher Front unter Watutin, Steppenfront unter Konew, Südwestfront unter Malinowski, Südfront unter Tolbuchin) mit einer Gesamtstärke von 2,6 Millionen Soldaten, 51.200 Geschützen, 2.400 Panzern und 2.850 Flugzeugen gegenüber.
Erste Phase
Operationen im Donez-Becken (16. August bis 22. September)
Am 16. August griffen die sowjetische Süd- und Südwestfront die deutsche 6. Armee sowie die 1. Panzerarmee an. Die beiden deutschen Armeen bildeten den Südflügel der Heeresgruppe Süd. Als die Vorbereitungen abgeschlossen waren, standen den beiden sowjetischen Fronten etwa 1 Million Soldaten, 21.000 Geschütze und Granatwerfer sowie 1257 Panzer zur Verfügung. Die ersten Angriffe gegen die 1. Panzerarmee erzielten keinen grossen Erfolg. Die etwas später angreifende Südfront erzielte einen Durchbruch im Gebiet der 6. Armee bei Kuibyschewo. Durch die Lücke bei Kuibyschewo drangen sowjetische Einheiten im Rücken der deutschen Verbände bis zum Asowschen Meer durch und konnten kurzzeitig das deutsche XXIX. Armeekorps abschneiden. Nach schweren Kämpfen konnten sich die deutschen Einheiten aber aus dem Kessel befreien und sich zurückziehen. Bei den deutschen Verbänden machte sich bemerkbar, dass mehrere Panzerdivisionen nach erfolgreicher Abwehr der Mius-Offensive abgezogen worden waren. Dies hing nicht zuletzt mit den schweren Kämpfen in Italien zusammen. Die 6. Armee hatte nur mehr wenige einsatzbereite Panzer – im Gegensatz zu den sowjetischen Verbänden, die durch 800 Panzer unterstützt wurden. Auch die Zuführung einiger gepanzerter Einheiten konnte die Lage der deutschen Truppen nicht mehr stabilisieren. General von Manstein genehmigte der 6. Armee, sich zurückzuziehen und neue Stellungen bei Donezk (damals Stalino) zu beziehen. Doch auch diese Stellungen fielen innerhalb weniger Tage. Für die nördlicher operierende 1. Panzerarmee hatte dies negative Auswirkungen; sie musste jetzt ebenfalls zurückgehen. Die sowjetischen Verbände stiessen in der Folge mit Wucht nach und drängten die Wehrmacht Richtung Dnepr. Weitere Vorstösse der Roten Armee rissen eine neue Lücke zwischen die beiden deutschen Armeen, durch die später schnelle Verbände weiter in die Tiefe vorstiessen. Wie an den anderen Frontabschnitten der Heeresgruppe zeigte sich auch hier, dass die deutschen Soldaten erschöpft waren und die Rote Armee nur mehr schwer aufzuhalten war. Die Rote Armee hatte bei diesen Angriffen dennoch 273.522 Soldaten und 886 Panzer bzw. Sturmgeschütze verloren.
Tschernigow-Poltawa-Operation (26. August bis 30. September)
Die Zentralfront unter Armeegeneral Rokossowski griff am 26. August an der Nahtstelle zur Heeresgruppe Mitte an, während Generaloberst Konjews Steppenfront weiter südlich die 8. Armee (vormals Armeeabteilung Kempf) angriff. Die deutsche 4. Panzer-armee wurde durch die Woronescher Front angegriffen. Die drei sowjetischen Fronten verfügten über 1.581.300 Mann, denen ungefähr 350.000 Soldaten auf deutscher Seite gegenüberstanden. Letztere befanden sich allerdings in einer starken Verteidi-gungsposition. Der sowjetischen 60. Armee (General Tschernjachowski) gelang es südlich von Sewsk innerhalb der nächsten Tage nur mühsam in die deutschen Verteidigungslinien einzubrechen. Erst nachdem die Hauptkräfte der Front, das 9. Panzerkorps und die 13. Armee (General Puchow), unter strikter Geheimhaltung dorthin verlegt worden waren, gelang es, diesen Einbruch bis zum 31. August auf 100 Kilometer Breite und 60 Kilometer Tiefe zu erweitern und die deutsche 2. Armee (Generaloberst Weiss) zum Rückzug zu zwingen.
Im Verlauf dieser Operation nahm die Rote Armee eine Reihe grösserer Städte ein, wie Sumy (2. September), Tschernigow (21. September) und Poltawa (23. September), erreichte den Dnepr und errichtete eine Reihe von Brückenköpfen an dessen linkem Ufer. Infolge der beiden sowjetischen Operationen begann die Wehrmacht mit der Planung des vollständigen Rückzuges hinter den Dnepr. Die Rote Armee erkaufte ihren Sieg mit extrem hohen Verlusten: Während der Tschernigow-Poltawa-Operation verlor sie 427.952 Mann.
Deutscher Rückzug hinter den Dnepr
Am 8. September erschien Hitler im Hauptquartier des Generalfeldmarschall von Manstein in Saporoschje, bei der Lage-besprechung waren auch Feldmarschall von Kleist, der Befehlshaber der Heeresgruppe A und Generaloberst Ruoff anwesend. Zur Erlangung von Reserven wurde endlich die Aufgabe des Kuban-Brückenkopfes durch die 17. Armee gestattet. Zudem wurde der Rückzug der 6. Armee auf die Panther-Stellung genehmigt. Hitler beharrte aber darauf, bei Nikopol und Saporoshje einen östlichen Brückenkopf zu halten, um von dieser Position aus das kriegswirtschaftlich wichtige Donezbecken zurückerobern zu können.
Am 15. September begann die Heeresgruppe Süd endlich mit dem nötigen Rückzug auf das westliche Dnepr-Ufer. Es mussten innerhalb kürzester Zeit 15 Generalkommandos mit 63 Divisionen und der gesamten Ausrüstung im Wesentlichen auf nur sechs Brücken auf das andere Dnepr-Ufer gebracht und auf einer neuen 700 Kilometer breiten Front wieder aufgefächert werden. Neben etwa 1 Million Soldaten wurden etwa 200.000 Verwundete und ebenso viele Zivilisten durchgeschleust, dazu kamen 153.000 Pferde und 270.000 Schafe. Die am linken Flügel eingesetzte 4. Panzerarmee ging mit dem VII. und XIII. Armeekorps unter Feinddruck durch Kiew auf das linke Ufer zurück. Die 8. Armee vollzog ihren Rückzug über die Brücken bei Tscherkassy und Krementschug, das links eingesetzte XXIV. Panzerkorps setzte seine Verbände bei Kanew über. Der Masse der sich hinter dem grossen Dnepr-Bogen zurückgehenden 1. Panzerarmee gelang bei Saporoshje und Dnjepropetrowsk rechtzeitig der Übertritt auf das westliche Ufer. Die verfolgenden Truppen der Südwestfront unter General Malinowski erreichten den Dnepr am 22. September. Sowjetische Vorhuten bedrohten bereits Dnepropetrovsk, wurden aber durch einen deutschen Gegenangriff rechtzeitig zurückgeworfen. Die Übergangs-stellen für die 6. Armee wurden bei Cherson und Nikopol zugewiesen. Die deutsche Front wurde wiederhergestellt und es trat auf dem Südflügel der Heeresgruppe Süd eine vorübergehende Stabilisierung ein. Im Süden hatte die 6. Armee die Anweisung, mit dem IV. Armeekorps bei Nikopol noch einen östlichen Brückenkopf zu halten, das XXIX. und XXXXIV. Armeekorps sollten im Raum östlich von Melitopol bis zum Asowschen Meer versuchen, die sogenannte „Wotan“-Stellung zu halten.
Zweite Phase
Am Nordflügel der Heeresgruppe Süd kam es Ende September zur Krise, der Hauptdruck der sowjetischen Offensive lastete besonders auf die 4. Panzerarmee unter Generaloberst Hoth. Für die Wehrmacht entstand zudem eine kritische Situation, als sowjetische Verbände am Südflügel der Heeresgruppe Mitte den Raum Gomel forcierten, im Bereich der 2. Armee den Desna-Abschnitt bei Tschernigow überwanden und in Richtung Dnepr vorgingen. Weitere Durchbrüche im Bereich der 4. Panzerarmee spalteten die dortige deutsche Front. Gegenstösse des aus dem Raum Kirow abgezogenen LVI. Panzerkorps mit der 8. Panzer-Division verhinderten hier den sowjetischen Durchbruch. Um die Lücke zum Pripjat-Gebiet zu schliessen, wurde zudem das LIX. Armeekorps herangeführt und dieser Bereich zwecks einheitlicher Führung zusätzlich der 4. Panzerarmee übertragen. Zusammen mit den sowjetischen Operation in Taurien (Nogaische Steppe) geriet die gesamte Heeresgruppe Süd in Gefahr. Um die Kampfführung am unteren Dnjepr zu erleichtern, wurde die 6. Armee hingegen in den Befehlsbereich der Heeresgruppe A überstellt.
Sowjetisches Luftlandeunternehmen bei Bukrin
Armeegeneral Watutin, Oberbefehlshaber der Woronescher Front (am 20. Oktober umbenannt in 1. Ukrainische Front) wollte gleich anfangs Kiew befreien und entschloss sich nördlich Kiew und bei Kanew Brückenköpfe über den Dnjepr zu errichten, aus denen dann der Angriff erfolgen sollte. Am Morgen des 22. September errichtete die 3. Gardepanzerarmee (General Rybalko) mit der 51. Garde-Panzerbrigade nordwestlich von Kanew zwischen den Dörfern Grigorowka und Sarubenzy einen ersten Brückenkopf am anderen Flussufer. Am 24. September wurde im Rücken der deutschen 112. Infanterie Division in der Dnjepr-Windung von Bukrin die 1., 3. und 5. Luftlande-Brigade abgesetzt.
Diese Truppen zählten insgesamt etwa 8.000 Mann und verfügten über 24 45-mm-Geschütze, 180 50-mm- oder 82-mm-Mörser und 540 Maschinengewehre. Ihnen standen 180 Transportflugzeuge Lissunow Li-2, 35 Lastensegler und 10 Schleppflugzeuge zur Verfügung. Aber das Feuer der deutschen Flak-Artillerie sowie schlechtes Wetter liessen das Unternehmen scheitern. Viele Rotarmisten landeten direkt in den deutschen Stellungen oder im Fluss. Nur dem Kommandeur der 5. Brigade, P. M. Sidortschuk, gelang es, gelandete Einheiten zu sammeln, Verbindung zur Führung herzustellen und kleine Widerstandsnester am jenseitigen Ufer zu bilden, die erst ab 26. September durch Nachlandungen über den Fluss verstärkt werden konnten. Diese wurde ihrerseits sofort durch einsetzende Gegenangriffe der 20. Panzergrenadier- und 19. Panzer-Division eingedämmt.
Bildung des Brückenkopfes bei Ljutesch
In der zweiten Phase der Dnepr-Offensive verfolgte die Rote Armee das Ziel, eine Erweiterung der eroberten Brückenköpfe am linken Dnepr-Ufer zu erreichen. Die in der sowjetischen Militärgeschichte als Strategische Offensive am Unteren Dnepr bezeichneten Kampfhandlungen dauerten vom 26. September bis zum 20. Dezember 1943. Bis Ende September hatte die Woronesch-Front auch im Raum nördlich Kiew bei Ljutesch und Tschernigow gegenüber dem deutschen XIII. Armeekorps der 4. Panzerarmee mehrere Brückenköpfe durch die 13., 60. und 38. Armee bilden können. Hierher wurde bis Mitte Oktober die 3. Gardepanzerarmee vom Bukriner Brückenkopf herüber gezogen, um am geplanten Angriff auf Kiew teilzunehmen, wo das deutsche VII. Armeekorps verteidigte.
Kampf um den Bukriner Brückenkopf
Am 29. September wurde im Bereich der deutschen 8. Armee Krementschug durch Truppen der 5. Gardearmee (Generalleutnant Schadow) befreit. Am 12. Oktober begann eine neue Offensive. Die sowjetische 40. Armee stiess im Bukriner Brückenkopf erneut auf hartnäckigen Widerstand. Um den Durchbruch der sowjetischen Truppen aufzuhalten, wurde das XXIV. Panzerkorps (General Nehring) sofort zu Gegenangriffen angesetzt. Das 47. Schützenkorps (Generalmajor S. P. Merkulow) konnte zusammen mit den Einheiten der 27. Armee und Teilen der 3. Gardepanzerarmee die Stützpunkte auf 5 bis 8 Kilometer erweitern und das Dorf Chodorow besetzen. Noch weniger Erfolg erzielte das 52. Schützenkorps (Generalmajor F. I. Perchorowitsch) bei der Übergangs-stelle von Schtschuchin. Seine Offensive wurde durch starkes Feuer und Gegenangriffe der deutschen Truppen bereits nach geringem Geländegewinn gestoppt. Die sowjetische 47. Armee, die im Brückenkopf von Studenetski angriff, schaffte es nicht, den deutschen Widerstand zu brechen und sich mit Einheiten der 27. Armee zu verbinden. Nach monatelangem Kampf konnten die kleinen Brückenköpfe erst am 13. November vereinigt und gesichert werden.
Kämpfe um Dnjepropetrowsk und Saporoshje
Die zu erwartete Offensive der Steppenfront (ab 20. Oktober umbenannt in 2. Ukrainische Front unter Generaloberst Konjew) gegen den Abschnitt der deutschen 1. Panzerarmee brach am 15. Oktober los, die Verteidigung des XXX. Armeekorps (46., 257., 387. und 304. Infanterie-Division) brach zusammen. Am 25. Oktober fiel Dnjepropetrowsk in die Hände der sowjetischen 46. Armee. Anfang November festigte sich die neue Front des XXX. Armeekorps zwischen Alexandrowka und dem Dnepr bei Augustinowka. Weitere sowjetische Versuche, in das kriegswichtige Erzgebiet von Kriwoi Rog vorzudringen, scheiterten am wieder gefestigten deutschen Widerstand. Im östlichen Dnepr-Bogen hielt das deutsche XXXX. Panzerkorps gemeinsam mit dem XVII. Armeekorps (123., 125. und 335. Infanterie-Division) die Stadt Saporoshje gegenüber der Südwestfront unter General Malinowski noch bis 14. Oktober, dann fiel die Stadt in die Hände der sowjetischen 3. und 8. Gardearmee (General Tschuikow).
Kampf am unteren Dnepr
In der gleichzeitig am Südabschnitt laufenden Melitopoler Operation gelang es der sowjetischen Südfront (Armeegeneral Tolbuchin) am 23. Oktober die Wotan-Stellung zu durchbrechen, mit der 2. Gardearmee in die Nogaische Steppe einzudringen und zusammen mit der 51. Armee die Landenge von Perekop (Armjansk) abzuschneiden. Dadurch ging die Verbindung zwischen der deutschen 6. und 17. Armee verloren, starke deutsche und rumänische Kräfte wurden dadurch auf der Halbinsel Krim völlig abgeschnitten. Die sowjetische 44. Armee blockierte das die Dnepr-Linie bis Cherson haltende XXXXIV. Armeekorps.
Gegenüber der 5. Stossarmee und 3. Gardearmee der 4. Ukrainischen Front hielt sich die deutsche 6. Armee noch bis Ende Januar 1944 im östlichen Dnepr-Brückenkopf von Nikopol. Am östlichen Dnepr-Ufer verblieben neben der 13. und 17. Panzer-Division das IV. und XXIX. Armeekorps mit der 3. Gebirgs-Division, die 5. Luftwaffen-, der 101. Jäger- sowie der 9., 17., 79., 258., 302., und 335. Infanterie-Division.
Kiewer Offensive
Auch die darauf folgende Kiewer Strategische Offensive (3. bis 13. November 1943), in deren Folge der deutschen 4. Panzerarmee die ukrainische Hauptstadt Kiew am 6. November durch die 3. Gardepanzer- und 38. Armee entrissen wurde, brachte der Roten Armee schwere Verluste. Es gelang der 1. Ukrainischen Front unter Armeegeneral Watutin aber in der Folgezeit, die Stadt zu behaupten und den dort am westlichen Dnepr-Ufer gemachten Geländegewinn erheblich zu vergrössern. Ein ab 13. November durch Generalfeldmarschall Manstein organisierter Gegenschlag des XXXXVIII. Panzerkorps aus dem Raum Schitomir mit dem Ziel, die Stadt für das Deutsche Reich zurückzuerobern, schlug fehl.
Die Operationen um die Erweiterung der Dnjepr-Brückenköpfe brachte der Roten Armee grosse Erfolge, aber erneut sehr hohe Verluste. Die Rote Armee verlor 754.392 Soldaten, was über die Hälfte der sowjetischen Gesamtverluste während der Kämpfe am Dnepr ausmachte.
Verluste und Folgen
Bis Anfang November 1943 gelang es den Truppen der 2. und 3. Ukrainischen Front sich auf 450 Kilometer Breite und bis zu etwa 100 Kilometer Tiefe auf dem westlichen Dnepr-Ufer zu etablieren. Die Rote Armee musste in den Kämpfen sehr hohe Verluste hinnehmen: 1,213 Millionen Soldaten (davon 283.000 Tote), 4.050 Panzer und 824 Flugzeuge. Sie griff auf der 800 Kilometer breiten Front an und stiess 300 Kilometer nach Westen vor. Die Verluste auf Deuscher Seite betrugen ca. 500’000 Gefallene, Verwundete und Vermisste.
Alliierte Invasion in Italien (03.09.1943 – 17.09.1943)
Die Alliierte Invasion in Italien im Zweiten Weltkrieg war eine Landeoperation der Westalliierten auf dem italienischen Festland im September 1943. Sie folgte auf die Landung in Sizilien (Operation Husky). Die Hauptoperation Avalanche fand bei Salerno in Kampanien statt und hatte die Einnahme des Hafens von Neapel zum Ziel. Im Ergebnis führte diese Landung zum Ausscheiden Italiens aus dem Krieg. Süditalien musste von der deutschen Wehrmacht geräumt werden.
Vorgeschichte
Auf der Casablanca-Konferenz Anfang 1943 hatte der britische Premier Winston Churchill versucht, US-Präsident Franklin D. Roosevelt von der Idee zu überzeugen, den Angriff auf die „Festung Europa“ mit einem Angriff von Süden auf Sizilien zu beginnen. Churchill argumentierte, dass für das weitere Vorgehen die Sicherung der Schifffahrtswege im Mittelmeer notwendig war. Ausserdem könne Italien auf diese Weise zum Ausscheren aus der Front der Achsenmächte bewegt werden. Auf der Trident-Konferenz im Mai 1943 einigte man sich grundsätzlich auf eine Fortsetzung der Operationen im Mittelmeerraum im Jahre 1943 mit dem Ziel, das Ausscheiden Italiens aus dem Krieg herbeizuführen. Hierdurch sollten die Aussichten der für 1944 geplanten Operation Roundup verbessert werden, da die deutsche Armee gezwungen sein würde, zusätzliche Divisionen zur Besetzung des Balkan und zur Verteidigung Norditaliens und Südfrankreichs einzusetzen. Der alliierte Oberbefehlshaber im Mediterranean Theater of Operations General Dwight D. Eisenhower wurde daraufhin beauftragt, Optionen für Folgeoperationen für Operation Husky auszuarbeiten. Die Amerikaner favorisierten ursprünglich eine Landung auf Sardinien und Korsika und eine Intensivierung des Luftkriegs, die Briten sprachen sich für eine Landung auf dem italienischen Festland mit der Option, später einen Brückenkopf in Albanien zu errichten, aus.
Die Operation Husky gegen Sizilien begann am 10. Juli 1943 und wurde bis Mitte August erfolgreich abgeschlossen. Auf einen Vorschlag des amerikanischen Generalstabschefs George C. Marshall begannen Mitte Juli unter der Bezeichnung Operation Avalanche die Planungen für eine Unternehmung zur Einnahme des Hafens von Neapel.
Nachdem nach einem Treffen des Grossen Faschistischen Rats am 24. Juli der italienische Diktator Benito Mussolini abgesetzt worden war, begann dessen Nachfolger Pietro Badoglio Verhandlungen über einen Separatfrieden mit den Alliierten. Auf der Quadrant-Konferenz im August 1943 beschlossen Churchill und Roosevelt, die Operationen auf dem italienischen Festland fortzusetzen.
Zuvor hatte das deutsche Oberkommando beschlossen, zusätzliche deutsche Divisionen in Norditalien und bei Rom zu stationieren, um für den Fall eines Separatfriedens der neuen italienischen Regierung die italienische Armee entwaffnen zu können. Die Planungen hierfür und für die Übernahme der italienischen Besatzungsgebiete auf dem Balkan und in Südostfrankreich wurden unter dem Stichwort „Fall Achse“ ausgearbeitet.
Plan
Während die 7. US-Armee auf Sizilien verblieb, wurden die ebenfalls bei Husky beteiligte britische 8. Armee, befehligt von General Bernard Montgomery, und die in Nordafrika aufgestellte 5. US-Armee, befehligt von General Mark W. Clark, für die Landungen ausersehen und in der 15th Army Group zusammengefasst. Den Oberbefehl hatte der britische Feldmarschall Harold Alexander, der gleichzeitig Stellvertreter Eisenhowers war.
Ihnen gegenüber stand die deutsche 10. Armee General Heinrich von Vietinghoffs unter dem Oberbefehlshaber für Süditalien GFM Albert Kesselring. Sie wurde im August durch die aus Sizilien evakuierten Einheiten des XIV. Panzerkorps verstärkt.
Aufgrund des bevorstehenden Ausscheidens Italiens aus dem Krieg beschlossen die alliierten Befehlshaber, die Hauptlandung an der Westküste Italiens durchzuführen. Die Landungen in Kalabrien über die Strasse von Messina und im Golf von Tarent wurden als Nebenoperationen geplant, die die deutsche Abwehr erschweren sollten.
Die britische 8. Armee sollte am 3. September von Messina aus an der gegenüberliegenden Küste Kalabriens bei Reggio Calabria landen (Baytown). Diese Operation konnte aufgrund der geringen Distanz mit leichten Landungsbooten durchgeführt werden.
Als Landepunkt für die eine Woche später geplante Hauptlandung (Avalanche) wurde der Golf von Salerno südlich von Neapel ausgewählt, da dort bessere Bedingungen als im ebenfalls in Erwägung gezogenen Mündungsgebiet des Volturno nordwestlich von Neapel zu erwarten waren. Hierfür wurden die 5. US-Armee, bestehend aus dem amerikanischen VI Corps und dem britischen X Corps mit der 82. US-Luftlandedivision als Reserve ausgewählt, die auf dem Meeresweg von Nordafrika transportiert wurden. Ein Plan, die 82. Division zur Besetzung von Flugplätzen bei Rom einzusetzen (Operation Giant II), wurde kurzfristig fallengelassen, als klar wurde, dass die italienische Armee sich nicht auf die Seite der Alliierten stellen würde.
Die britische 1. Luftlandedivision sollte gleichzeitig als Ablenkungsmanöver für Avalanche die Landung bei Tarent (Slapstick) durchführen.
Verlauf
Die Landung der 8. Armee in Kalabrien am 3. September stiess nur auf geringen Widerstand, da von deutscher Seite eine weitere Landung weiter nördlich vorausgesehen wurde. Das deutsche LXXVI. Panzerkorps versuchte lediglich, den gegnerischen Vormarsch durch die Zerstörung von Brücken zu behindern.
Am 8. September wurde der Waffenstillstand von Cassibile bekanntgegeben, der bereits am 3. September unterzeichnet worden war. Die italienischen Truppen wurden daraufhin von den Deutschen entwaffnet und nahmen an den weiteren Kampfhandlungen nicht mehr teil, ebenso wie die italienische Marine, die sich den Alliierten ergab. Am 9. September konnte Tarent von der 1. Luftlandedivision fast ohne Widerstand eingenommen werden.
Am frühen Morgen des 9. September landeten die Truppen der 5. Armee bei Salerno. Im US-Sektor fand ein vorbereitendes Bombardement durch Schiffe oder Flugzeuge nicht statt. Im Norden der Landungszone sicherten US-Rangers und britische Commandos Amalfi und Salerno. Südlich davon landete das britische X. Korps und bei Paestum das amerikanische VI. Korps. Bis zum Abend des 10. September konnte trotz starker Gegenwehr eine 55 km breite Landezone in einer Tiefe von ca. 10 km gesichert werden.
Vom 12. bis 14. September erfolgte ein heftiger deutscher Gegenangriff von sechs Panzer- und motorisierten Divisionen gegen den Brückenkopf. Mit Unterstützung durch Schiffsartillerie, Bomber und den Absprung von Fallschirmjägern in die Landezone konnte die Kampflinie stabilisiert werden.
Am 16. September ordnete von Vietinghoff die Einstellung der Gegenangriffe und den Rückzug der 10. Armee an. Am gleichen Tag konnte die mittlerweile herangerückte 8. Armee die Verbindung zur 5. Armee herstellen.
Am 19. September setzte die 5. Armee ihren Vormarsch auf Neapel fort und nahm am 28. September Avellino und am 1. Oktober Neapel. Am 27. September wurden von der 8. Armee die Flugplätze bei Foggia gesichert. Im Oktober verlief die Frontlinie am Volturno sowie über Campobasso und Larino zur Adriaküste bei Termoli.
Folgen
Im November 1943 wurde der bisherige Oberbefehlshaber der Heeresgruppe B in Oberitalien GFM Erwin Rommel nach Frankreich abberufen und die weitere Verteidigung Italiens dem OB Süd und Oberbefehlshaber der Heeresgruppe C GFM Kesselring übergeben. Die 10. Armee erhielt im Winter Unterstützung durch die neuaufgestellte 14. Armee.
Im weiteren Verlauf kam es zur Schlacht um Ortona (20. Dezember bis 28. Dezember 1943) und bis zum Januar 1944 zogen sich die deutschen Truppen unter weiteren schweren Kämpfen hinter die Gustav-Linie zurück. Diese blieb bis zum Mai 1944 heftig umkämpft (Schlacht um Monte Cassino).
Dodekanes-Feldzug (08.09.1943 – 22.10.1943)
Der britische Dodekanes-Feldzug vom 8. September 1943 bis 22. Oktober 1943 war eine Operation im Zweiten Weltkrieg und zielte auf eine Eroberung der Italienischen Ägäis-Inseln ab. Ziel dieser Landungsoperation war es, die Dodekanes-Inseln in der südöst-lichen Ägäis nach der Kapitulation Italiens schnellstmöglich zu besetzen, um diese als Ausgangsbasis für Operationen gegen die von Deutschland kontrollierten Balkanländer zu verwenden, insbesondere für Luftangriffe auf die rumänischen Ölfelder von Ploiești.
Verlauf
Durch die alliierten Vorbereitungen wollten die meisten italienischen Soldaten entweder in ihre Heimat zurückkehren oder die Seiten wechseln, weshalb deutsche Kräfte der Heeresgruppe E vom Festland auf die Dodekanes-Inseln verlegt wurden. Die grösste Bedeutung dabei hatte die 7.500 Mann starke Sturm-Division Rhodos unter dem Kommando von Generalleutnant Ulrich Kleemann.
Am 8. September kapitulierte die italienische Garnison auf Kastelorizo gegenüber britischen Truppen. Dies veranlasste den Divisionskommandeur Kleemann, am 9. September den Angriffsbefehl gegen das 40.000 Mann starke italienische Kontingent zu geben, das am 11. September kapitulierte.
Als Antwort auf die alliierten Eroberungen der Inseln Kos, Kalymnos, Samos, Leros, Symi und Astypalea mobilisierte die deutsche Wehrmacht die 22. Infanterie-Division unter dem Kommando von Generalleutnant Friedrich-Wilhelm Müller, die am 19. September bereits Karpathos, Kasos und die italienisch besetzten Inseln der Sporaden und Kykladen kontrollierte.
Im Oktober entdeckte die deutsche Luftwaffe die Basen der britischen Streitkräfte auf Kos und versuchte diese zuerst durch Luftangriffe, dann auch mit einer amphibischen Landungsoperation zu bekämpfen. Diese Operation trug den Decknamen Unternehmen Eisbär und zwang die britischen Truppen zum Rückzug über Nacht. Während dieser Schlacht konnten1388 britische und 3145 noch verbliebene italienische Gefangene gemacht werden. Etwa 100 italienische Offiziere wurden beim Massaker von Kos durch die Wehrmacht ermordet.
Als Folge der Kapitulation der italienischen Kräfte auf Kos ergab sich die italienische Garnison Kalymnos, was eine wesentliche Erleichterung für Operationen gegen das nächste Ziel Leros unter dem Decknamen Unternehmen Leopard bedeutete. Als Angriffsbeginn wurde der 9. Oktober festgesetzt, jedoch verzögerte er sich aufgrund der Versenkung des deutschen Truppenkonvois (Dampfer Olympos mit 5 Fährprähmen) durch die Royal Navy bis zum 12. November.
Durch Landungen geteilt in zwei Invasionsgruppen, eine von Osten und eine von Westen kommend, konnte schnell ein Brücken-kopf durch die Küstenjäger-Abteilung der Division Brandenburg aufgebaut werden. In der folgenden Nacht landeten deutsche Fallschirmjäger in der Inselmitte und die alliierten Kräfte konnten schnell in zwei Teile zerschnitten werden. Daraufhin ergaben sich die alliierten Truppen am 16. November. Die Verluste während dieser Operation betrugen 520 Mann auf deutscher Seite und 3200 britische sowie 5350 italienische Gefangene.
Folgen
Die alliierten Angriffe schlugen auf allen drei angegriffenen Inseln, Rhodos, Leros und Kos, fehl. Unter hohen Verlusten an Menschen und Material mussten sich die Briten wieder von den Inseln der Dodekanesgruppe zurückziehen. Die Inseln wurden daraufhin von deutschen Truppen der 22. Infanterie-Division unter dem Befehl von Generalleutnant Friedrich-Wilhelm Müller von Kreta aus besetzt und bis zur deutschen Gesamtkapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 gehalten.
Operation Avalanche (09.09.1943 – 14.09.1943)
Operation Avalanche war der Codename für die Landung der Alliierten im Golf von Salerno am 9. September 1943, als Teil der Invasion des italienischen Festlands. Diese Operation wurde von der 5. US-Armee unter dem amerikanischen General Mark W. Clark durchgeführt. Die primären Ziele bestanden darin, den Hafen Neapels einzunehmen, um damit die eigenen Versorgungswege herzustellen und gleichzeitig die deutschen Streitkräfte aufzuspalten und nach Süditalien abzudrängen.
Ausgangssituation
Die Alliierten hatten zwischen dem 10. Juli und dem 17. August 1943 Sizilien den Achsenmächten entrissen. Italien hatte am 3. September einen Waffenstillstand mit den Alliierten abgeschlossen und sich am 8. September offiziell aus dem Kriegsgeschehen zurückgezogen. Die Alliierten landeten dennoch in Gebieten, die von der deutschen Wehrmacht kontrolliert wurden. Damit die deutschen Truppen vom geplanten neuen Landungspunkt bei Salerno abgelenkt werden konnten, war die britische 8. Armee (General Bernard Montgomery) in der Operation Baytown bereits am 3. September mit ihrem XIII. Korps (GenLt. Miles Dempsey) bei Reggio an der Südspitze Kalabriens gelandet. Gleichzeitig mit der Landung der 5. US-Armee im Golf von Salerno wurde zusätzlich am 9. September am Hafen von Tarent die Operation Slapstick durch die britische 1. Luftlandedivision durchgeführt. Der deutsche Oberbefehlshaber in Italien, Generalfeldmarschall Albert Kesselring erwartete richtigerweise die alliierte Hauptlandung bei Gaeta oder Salerno und zog starke Streitkräfte aus Kalabrien nach Norden zurück.
Die Landung bei Salerno
Die 5. US-Armee landete am 9. September im Golf von Salerno gleichzeitig an vier Stellen. Die amphibische Leitung der Operation lag in der Hand des Rear Admiral Richard L. Conolly. Vor der Landung wurde von den Alliierten bewusst auf unterstützende Bombardements durch die Luftstreitkräfte verzichtet, das Überraschungsmoment hielt sich dennoch in Grenzen. Deutsche Einheiten waren bereits in den östlich davon gelegenen Hängen mit Artillerie und Maschinengewehrposten postiert. Im Nordabschnitt liess Generalleutnant Clark die US-Ranger Force unter Oberstleutnant William O. Darby bei Maiori und die Britische Commando Brigade unter Brigadegeneral Robert Laycock bei Vietri an Land gehen, um die dort liegende Bahnlinie zwischen Neapel und Salerno in die Hand zu bekommen. Die Hauptlandung aber erfolgte durch das britische X. Korps (Generalleutnant Richard McCreery) mit der 46. (Generalmajor John Hawkesworth) und der 56. Division (Generalmajor Douglas Graham) an der südlichen Küste von Salerno zwischen dem Picentino und Tusciano. Das VI. US-Korps (Generalmajor Ernest J. Dawley) landete im südlicheren Abschnitt die 36. Division (Generalmajor Fred L. Walker) bei Paestum, erst am nächsten Tag folgte die 45. Division (Generalmajor Troy H. Middleton) in den Landungskopf nach.
Das schnelle Voranschreiten der Alliierten wurde durch die starke deutsche Abwehr sehr erschwert, das flachere Strandgebiet und der Flugplatz von Montecorvino wurde aber von den Briten erfolgreich eingenommen. Als sich die ersten Amerikaner an der Küste von Paestum festgesetzt hatten, verkündete ein Sprecher der deutschen Seite in Englisch „Geben Sie auf, Sie sind umzingelt!“ („Come on in and give up. We have you covered“.), was die amerikanischen Truppen jedoch nicht davon abhielt ihre Angriffe planmässig fortzusetzen. Um 7 Uhr morgens führte die deutsche 16. Panzer-Division unter Generalmajor Rudolf Sieckenius aus dem Raum Persano bereits einen ersten Gegenangriff aus, welcher unter schweren Verlusten abgewehrt wurde. Sowohl die Briten als auch die Amerikaner machten trotz Luftüberlegenheit und Einsatz der Schiffsartillerie nur langsam Fortschritte; am Ende des ersten Tages lagen noch mehr als 10 km zwischen ihnen und sie vereinigten sich erst am Ende des zweiten Tages. Die US-Ranger-Brigade rang mit der Panzer-Division „Hermann Göring“ um den Besitz von Amalfi und sicherte sich nördlich davon auch den Chiunzi-Pass.
Zwischen dem 12. und 14. September organisierte die deutsche 10. Armee (Generaloberst Heinrich von Vietinghoff) einen starken Gegenangriff mit sechs Divisionen an motorisierten Truppen (Panzer-Division „Hermann Göring“, 3., 16. und 26. Panzer-Division sowie die 15. und 29. Panzergrenadier-Division) – zusammen fast 600 Panzer und Selbstfahrlafetten und hoffte, sie könnte noch verhindern, dass die amerikanischen und britischen Truppen weiter ins Landesinnere vorstiessen. Die Höhe 424 bei Altavilla und Albanella wurden dabei zurückgewonnen und das VI. US-Korps zeitweilig hart bedrängt.
Der Einsatz der alliierten Bomberstreitkräfte sowie der Artillerie der Kreuzer USS Philadelphia und USS Boise sowie der Schlacht-schiffe HMS Warspite und HMS Valiant unter Flottenadmiral Sir Andrew Cunningham brachte schliesslich die deutschen motorisierten Verbände am 14. September zum Stehen. Auch der Einsatz des deutschen Kampfgeschwaders 100 gegen die alliierten Kriegsschiffe mit den neuen Gleitbomben FX 1400 brachte einige Erfolge, die Kreuzer USS Savannah und HMS Uganda mussten ebenso wie die Warspite schwer beschädigt zu Reparaturen abdrehen.
Die beim VI. US-Korps nachgezogene 82. Luftlande-Division (Generalmajor Matthew B. Ridgway) eroberte noch im Verlauf des Tages die Höhe 140 westlich von Albanella zurück. Der Gegenangriff der britischen 56. Division in Richtung auf Eboli eroberte Battipaglia, die nördlicher angesetzte 46. Division und die Commando-Brigade festigten ihre Positionen bei Salerno. Die alliierten Verluste beliefen sich auf 2100 Tote, 4100 Vermisste und 7400 Verwundete.
Folgen
Von den Alliierten mussten im Landungskopf anfangs schwere Verluste hingenommen werden, da ihre Truppen zu weit verstreut waren, um einem gezielten Angriff standhalten zu können. Bereits am 17. September wurde die Verbindung, zwischen der aus Kalabrien nordwärts vorgehenden britischen 8. Armee mit den Amerikanern bei Paestum erreicht. Salerno selbst war fest in der Hand des britischen X. Korps.
Am 17. September trafen über See weitere Verstärkungen (1. US-Panzer-Division, 3. und 34. US-Division) ein, die bis zum 18. September den Landungskopf festigten und die Voraussetzung für den folgenden Ausbruch bildeten. Das Operationsziel der Alliierten, die Einnahme von Neapel, wurde von der 5. US-Armee am 1. Oktober 1943 erreicht.
Die deutschen Truppen zogen sich bis auf die so genannte „Gustavlinie“, ungefähr 100 Kilometer südlich von Rom, zurück (davor Volturno-, Barbara- und Bernhardt-Line).
Operation Source (11.09.1943 – 20.09.1943)
Operation Source war die Bezeichnung einer während des Zweiten Weltkriegs gegen die deutschen Schiffe Tirpitz, Scharnhorst und Lützow gerichteten und mit Kleinst-U-Booten, sogenannten midgets, durchgeführten Unternehmung der britischen Marine im Jahr 1943. Die Hälfte der eingesetzten Kleinst-U-Boote ging auf der Anfahrt verloren, eines brach die Fahrt wegen technischer Mängel ab, und zwei erreichten das deutsche Schlachtschiff Tirpitz, das durch Sprengminen schwer beschädigt wurde.
Vorgeschichte
Die Tirpitz in der Bogenbucht Die Tirpitz verlegte im Januar 1942 nach Norwegen und bedrohte seitdem, unter anderem vom nord-norwegischen Fættenfjord und später vom Altafjord aus, die Route der alliierten Nordmeergeleitzüge und erschwerte der britischen Admiralität somit sowohl Planung als auch Durchführung der Konvois. Da der Royal Navy kein Kampfschiff zur Verfügung stand, das die Tirpitz herausfordern konnte, musste für jeden Geleitzug eine effiziente und starke Fernsicherung aus mehreren grossen Schiffen organisiert und bereitgestellt werden, was erhebliche Kräfte und Mittel band. Diese effiziente Stellung des deutschen Schiffes – entsprechend dem Konzept der Fleet-in-being – veranlasste den Historiker Roskill später zu der wertenden Frage: „… ob jemals ein einzelnes Schiff durch seine blosse Anwesenheit einen derart grossen Einfluss auf die strategische Planung zur See ausgeübt hatte“. Zusätzlich zu der Bindung der gegnerischen Schiffe, deren Einsatz durch die ständige Bedrohung der Geleitzüge notwendig war, zwang die Anwesenheit der Tirpitz die britischen Streitkräfte, einen weiteren erheblichen Teil ihrer See- und Luftstreitmacht für ihre Zerstörung aufzuwenden. Mit der Verlegung, nach Reparaturen im nahen Lofjord, vom Fættenfjord bei Trondheim in den Kåfjord, einen Seitenarm des Altafjords, gelangte das Schiff im März 1943 schliesslich ausser Reichweite der britischen Flugzeuge.
Planung
Nachdem ein Angriff mit bemannten Torpedos im Sommer des Jahres 1943 fehlgeschlagen war, da diese Gefährte bei Grundkontakt mit dem schroffen Fels des norwegischen Fjords buchstäblich auseinandergefallen waren, plante die britische Admiralität, den nächsten Angriff durch Kleinst-U-Boote der X-Klasse ausführen zu lassen. Aufbauend auf der Konzeption seines Stabschefs, LtCdr Davies, erwog Sir Barry, Befehlshaber der britischen U-Boote, zunächst, die Kleinst-U-Boote entweder durch Kutter zu ihrem Einsatzort schleppen oder den Weg aus eigener Kraft unter Verwendung zusätzlicher Treibstofftanks zurücklegen zu lassen. Schliesslich entschloss er sich für den Einsatz von sechs U-Booten der S- und T-Klasse, von denen jedes jeweils eines der Kleinst-U-Boote in Schlepp nehmen sollten. Barry und Davies waren zudem darin übereingekommen, jedes der eingesetzten X-Boote mit zwei Besatzungen zu bemannen: einer, die für die Überfahrt an Bord war, und einer, die zunächst auf dem schleppenden grossen U-Boot mitfuhr und dann am Einsatzort in das midget wechselte und ausgeruht den Angriff übernahm. Alle Besatzungen der insgesamt zwölf beteiligten Boote zusammengerechnet, kam die eingesetzte Mannstärke der Operation Source auf 400 Mann.
Am Nachmittag des 11. September stach die kleine Flotte von Loch Cairnbawn, einer schmalen Bucht an der schottischen Westküste, wo die X-Boote stationiert waren, aus in See.
Durchführung
Drei der midgets waren zum Angriff auf die Tirpitz bestimmt, zwei weitere sollten die Scharnhorst und eines die Lützow attackieren. Letzteres, das Kleinst-U-Boot mit der Kennung X 8, musste versenkt werden, nachdem die schadhaften Sprengminen beim Versuch sie abzuwerfen überraschend detoniert waren und das midget stark beschädigt hatten. Eines der beiden für den Angriff auf die Scharnhorst vorgesehenen Boote, X 9, ging ebenfalls bereits auf dem Anmarsch verloren, als die Verbindung zum schleppenden U-Boot riss und das Kleinst-U-Boot in der schweren See mit der gesamten Überführungs-Besatzung versank. Das andere midget erreichte zwar den Einsatzort, fand das deutsche Schlachtschiff aber nicht vor. Die Scharnhorst hatte am Vortag den Fjord für ein Übungsschiessen verlassen und nach ihrer Rückkehr nicht den üblichen Ankerplatz aufgesucht. Da die Besatzung des Kleinst-U-Bootes nun zudem mittlerweile zahlreiche technische Ausfälle bemerkt hatte, entschloss sich der britische Kommandant, zum U-Boot zurückzukehren. X 5, eines der auf die Tirpitz angesetzten Kleinst-U-Boote, ging vermutlich durch einen Artillerietreffer des Schlachtschiffes verloren. Nur zwei der ausgesandten midgets erreichten ihr Ziel und drangen in den „Netzkasten“ der Tirpitz ein. Den Besatzungen dieser Kleinst-U-Boote gelang es, Sprengminen, sogenannte Grundminen, unterhalb des Rumpfes abzulegen. Da sich X 6, das von der Besatzung Piker genannt wurde, nach dem Gewichtsverlust durch Ablegen der Minen nun nicht mehr effizient trimmen liess, entschied sich der Kommandant Donald Cameron, die Besatzung aussteigen zu lassen und das Boot aufzugeben. Er und seine Mannschaft ergaben sich dem deutschen Leutnant der Wache, der inzwischen eigenmächtig die Kommandantenbarkasse der Tirpitz unter sein Kommando gestellt und das Kleinst-U-Boot angesteuert hatte. Auch X 7 hatte seine Sprengminen positioniert und versuchte nun durch den „Netzkasten“ zu entkommen, indem es in die Netze steuerte, dann aber mit voller Kraft abdrehte, um so das Gewebe zu zerreissen. Während dieser belastenden Versuche fielen die Kompasse und der Tiefenmesser aus. Als das Boot dann unbeabsichtigt die Wasseroberfläche durchbrach und deutsche Geschosse die Tauchtanks beschädigten, entschied Kommandant Lt Basil Place, das Boot aufzugeben und sich zu ergeben.
Erfolg und Konsequenzen
Inzwischen hatte Kapitän Hans Meyer, Kommandant der Tirpitz, nichts von seinen vier Gefangenen erfahren. Er liess aber den Rumpf nach Haftminen absuchen, und, um die Wirkung eventueller Grundminen abzuschwächen oder zu neutralisieren, das Schiff verholen. Das Kriegstagebuch der Tirpitz erfasste zwei Explosionen, die sich gegen 10 Uhr 12 Minuten ereigneten. Tatsächlich handelte es sich um vier Detonationen, jeweils zwei wurden gleichzeitig ausgelöst. Die Explosionen beschädigten die Antriebs- und die Feuerleitanlage so nachhaltig, dass die Tirpitz erst sechs Monate später wieder eingesetzt werden konnte. Sechs Briten, unter anderem die Kommandanten der Kleinst-U-Boote, welche die Tirpitz angegriffen und die Explosion „ihrer“ Minen nun an Bord miterlebt hatten, gerieten in deutsche Kriegsgefangenschaft. Da keiner der Beteiligten, die unmittelbar Zeuge des Abschlusses der Unternehmung waren, zurückkehrte, war es der britischen Admiralität zunächst nicht bekannt, welchen Erfolg Operation Source gehabt hatte. Die Luftaufklärung lieferte lediglich Fotos des getroffenen Schlachtschiffs: Die Tirpitz lag offensichtlich inmitten einer Öllache an ihrem alten Ankerplatz, obwohl die anderen beiden Schiffe des Verbands, die Lützow und die Scharnhorst, ihre Position gewechselt hatten. Als ein Funkspruch aufgefangen wurde, in dem Kommandant Meyer um die Entsendung des Truppentransporters Monte Rosa mit einer grossen Anzahl Arbeiter zur Reparatur vor Ort bat, wurde der britischen Seite klar, dass die Tirpitz – offensichtlich nicht im Stande Trondheim anzulaufen, geschweige denn nach Deutschland zurückzukehren – erhebliche Schäden erhalten hatte. Lt Cameron und Lt Place, Kommandanten der beiden erfolgreichen midgets wurde im Februar 1944 das Viktoria-Kreuz verliehen.

„Der Ausfall der Tirpitz für so lange Zeit war von grossem militärischem Nachteil“
– Karl Dönitz, Oberbefehlshaber der Kriegsmarine
Schlacht um Kiew (03.11.1943 – 13.11.1943)
Die Zweite Schlacht um Kiew war eine Schlacht an der deutsch-sowjetischen Front im Zweiten Weltkrieg zwischen der Wehrmacht und der Roten Armee um die Hauptstadt der Ukrainischen SSR Kiew. Die Schlacht war Teil der zweiten Phase der Schlacht am Dnepr und fand im November und Dezember 1943 statt.
Vorgeschichte
Armeegeneral Nikolai Watutin, Oberbefehlshaber der Woronescher Front (am 20. Oktober unbenannt in 1. Ukrainische Front), führte am 23. und 24. September 1943 etwa 20 km nördlich und 80 km südöstlich von Kiew separate Operationen zur Gewinnung von Brückenköpfen über den Dnjepr durch. Er plante die Stadt durch eine doppelseitig angesetzte Zangenoperation einzunehmen. Ein am 24. September 1943 in der Dnjepr-Windung von Bukrin durchgeführtes Luftlande-Unternehmen scheiterte zunächst im Bereich des XXXXII. Armeekorps der 8. Armee. Bis zum 30. September konnte einer der gebildeten Brückenköpfe im Raum Bukrin dann doch bis zu 6 Kilometer Tiefe erweitert werden. Gegenangriffe durch das deutsche XXIV. Panzerkorps (19. Panzer- und 10. Panzergrenadier-Division) konnten diese Gefahr aber völlig eindämmen. Gegenüber dem deutschen XIII. Armeekorps gelang es der 38. Armee (General Tschibissow, später Moskalenko) am 26. September die 240. Schützen-Division bei Swaromje überzusetzen. Nach schweren Kämpfen konnten sich sowjetische Truppen am westlichen Ufer des Flusses festzusetzen, nach der Vergrösserung etablierte sich hier später der Brückenkopf von Ljutesch. Watutin verlegte den Schwerpunkt bald nach Norden: Die vor Bukrin zum Übersetzen des Dnjepr bestimmte 3. Gardepanzerarmee wurde ab 16. Oktober zum Brückenkopf Ljutesch verlegt. Nach der Erweiterung des Brückenkopfes von Ljutesch bis zum Irpen-Abschnitt bei Gostomel nahm auch die sowjetische 60. Armee (General Tschernjachowski) diesen Platz als Sprungbrett zum Angriff nach Südwesten. Auf deren rechter Flanke bildete die 13. Armee (General Puchow) einen weiteren Brückenkopf im Raum östlich von Tschernobyl. Bis Anfang November tobten derweil auch im Bereich des Brückenkopfes von Bukrin erbitterte Kämpfe um dessen Erweiterung.
Verlauf
Am Morgen des 3. November 1943 starteten die Truppen der 1. Ukrainischen Front die Kiewer Strategische Offensive. Watutin verfügte über etwa 660.000 Mann, 7000 Geschütze und Mörser, 675 Panzer und Selbstfahrlafetten, dazu etwa 700 Flugzeuge. Die deutsche 4. Panzerarmee unter Generaloberst Hoth verfügte bei der Verteidigung des Umfeldes und der Stadt über folgende Divisionen:
- Armeekorps mit 68., 208. und 340. Infanterie-Division
- Panzerkorps mit 7., 19. und 8. Panzer-Division
- Armeekorps mit 75., 88. Infanterie- und 213. Sicherungs-Division
- Panzerkorps mit 34., 82. und 112. Infanterie-Division und 20. Panzergrenadier-Division
Den Hauptangriff auf Kiew führte die sowjetische 38. Armee (General Moskalenko) aus dem Brückenkopf Ljutesch von Norden her und konnte bis zum Abend 5 bis 12 Kilometer tief in die deutschen Linien einbrechen. Am rechten Flügel konnte die sowjetische 60. Armee die Stellungen der 208. Infanterie- und der 8. Panzer-Division an der Linie Dymer-Gostomel zunächst nicht überwinden. Am Abend des ersten Tages hatte die an der Spitze stehende 240. Schützendivision verstärkt durch Einheiten des 7. Artilleriekorps den nördlichen Kiewer Vorort Pushcha-Wodice erreicht. Aus dem Bukrin-Brückenkopf hatten zur Bindung und Ablenkung des XXIV. Panzerkorps auch die sowjetische 40. (General F. F. Zmatschenko) und 27. Armee (Generalleutnant Trofimenko) anzugreifen. Luftunterstützung leistete die 2. Luftarmee unter Generalleutnant Krasowski. Dem massiven Angriff auf Kiew konnten die Divisionen des deutschen XIII. und VII. Armeekorps nicht lange standhalten. Am 4. November wurde die 3. Garde-Panzerarmee in die Schlacht eingeführt, das 7. Garde-Panzerkorps (Generalmajor K. F. Sulejkow) brach im Kampf mit der deutschen 7. Panzer-Division (von Manteuffel) nach Süden auf Swjatoschino durch und schnitt am folgenden Tag die Strasse zwischen Kiew und Shitomir ab. Das sowjetische 51. Schützenkorps unter Generalmajor Awdejenko drang zusammen mit dem 5. Garde-Panzerkorps unter General Krawtschenko von Norden her in Kiew ein, dabei wurden grosse Teile der 75. und 88. Infanterie-Division in der Stadt abgeschnitten. Teile der von der Roten Armee ausgerüsteten 1. tschechoslowakischen Brigade (Oberst Svoboda), die bereits den Bahnhof der Stadt besetzt hatten, erreichten am Morgen des 6. November den Dnjepr.
Kiew war nach mehrtägigen Kämpfen am 6. November unter schweren Verlusten vollständig eingenommen. Die nach 778 Tagen von deutscher Besatzung befreite Stadt erlitt schwere Zerstörungen. 1943 lebten hier etwa 80.000 Einwohner, was 20 % der Vorkriegs-Einwohnerzahl entsprach. 7.000 Gebäude, darunter 1.000 Fabriken waren geplündert oder zerstört.
Bei der Verfolgung der sich zurückziehenden deutschen Truppen wurde Fastow am 7. November durch das 6. Garde-Panzerkorps (Generalmajor Panfilow) und Schitomir am 12. November durch Teile der 38. Armee (23. Schützenkorps) und durch das 1. Garde-Kavalleriekorps unter Generalleutnant Viktor Baranow zurückerobert. Am 8. November startete die 20. Panzer-Grenadier-Division einen erfolglosen Gegenangriff an der Linie Tripolje-Fastow–Kornyn gegenüber der sich jetzt am westlichen Dnjepr-Ufer festgesetzten sowjetischen 40. Armee. Am 11. November wurden Korostyschew durch das 1. Garde-Kavalleriekorps und Radomyschl durch das 30. Schützenkorps (Generalmajor Gregori S. Lazko), am 12. November Malin und am 17. November Korosten durch Truppen der 60. Armee befreit. Im Norden von Watutins Front gelang es der 13. Armee am 16. November mit dem 15. Schützenkorps (Generalmajor Ljudnikow) die Stadt Tschernobyl einzunehmen, während das 18. Garde-Schützenkorps (Generalmajor Afonin) bis 18. November Owrutsch erreichte und besetzte.
Deutsche Gegenoffensiven im Raum Fastow-Schitomir
Generalfeldmarschall Erich von Manstein überzeugte Adolf Hitler davon, dass durch die Ankunft der 1. Panzer-Division (General Krüger) und der 1. SS-Panzer-Division „Leibstandarte“ verstärkte XXXXVIII. Panzerkorps sofort zu Gegenangriffen anzusetzen, um die bei Fastow einbrechende Front wiederherzustellen. Das zwischen den Fluss Irpen und Wassikow mit der 82., 198. und 75. Infanterie-Division haltende deutsche VII. Armeekorps wurde durch die 2. SS-Panzer-Division „Das Reich“ verstärkt.
Erste Phase ab 13. November
Am 13. November begann aus der Linie Fastow-Pawolotsch-Kasatin der Angriff von fünf deutschen Panzerdivisionen unter Führung des General der Panzertruppe Balck. Gleichzeitig tobte westlich davon der Kampf um Schitomir, das in der Nacht vom 17. auf den 18. November durch die 7. Panzer-Division zurückerobert werden konnte. Zwischen Fastow und Belaja Zerkow wurde die aus Frankreich heran geführte 25. Panzerdivision ausgeladen und sofort eingesetzt. Das Generalkommando XXXXII wurde am 12. November als Armeeabteilung Mattenklott (General der Infanterie Mattenklott) aktiviert, um die getrennt operierenden Korps-gruppen des XIII. und LIX. A.K. zwischen Korosten und Belaja Zerkow einheitlich führen zu können. Dabei wurde das sowjetische 94. Schützenkorps der neu in der Front etablierten 1. Gardearmee im Raum nördlich und östlich der Kleinstadt Brusiłów durch Einsatz zurückgeworfen. Unter dem Druck des XXXXVIII. Panzerkorps musste sich auch die 38. Armee nach Norden zurückziehen, dadurch geriet die weit westlich vorgeschobene linke Flanke der 60. Armee in Gefahr. Sowjetische Gegenstösse, welche am 26. November im Bereich Raewka-Borowka mit drei Schützenkorps einsetzten, verhinderten in südlicher Richtung weitere deutsche Erfolge. Ende November stabilisierte sich die Front vorerst westlich des Teterew-Abschnitts an der Linie Tschernjachow – Radomyschl – Stawischtsche – Jurowka. Die 1. Ukrainische Front verstärkte den westlich Kiew auf bereits 180 Kilometer Breite und 75 Kilometer Tiefe erweiterten Raumgewinn mit Truppen der 18. Armee.
Zweite Phase ab 6. Dezember
Am 6. Dezember startete ein neuer deutscher Gegenangriff aus dem Raum nördlich von Schitomir mit der 1. und 7. Panzer-Division vom Trostjawiza-Abschnitt zwischen Tschernjachow und Drobyn nach Osten zur Rückeroberung des verlorenen Teterew-Abschnitts zwischen Radomyschl und Weprin. Der 7. Panzer-Division erreichte rechts vorgehend bis 15. Dezember den Irscha-Abschnitt und schnitt nach der Einnahme von Malyn die Bahnlinie zwischen Korosten und Kiew ab. In der Mitte erreichte die zwischen Kamenka und Federowka angetretene 1. Panzer-Division nach Verstärkung durch Teile der SS-Division Leibstandarte den Teterew-Fluss bei Weprin, während links die 68. Infanterie-Division vergeblich versuchte die Stellungen der sowjetischen 1. Gardearmee bei Radomyschl zu durchbrechen. Die 1. Panzer-Division wurde herausgezogen um am nördlichen Ufer des Irscha-Abschnitts das im Raum Korosten zurückgedrängte LIX. Armeekorps zu verstärken. Aus dem durch die 291. Infanterie-Division gehaltenen Brückenkopf bei Sloditsch sollte die Vereinigung mit der 7. Panzer-Division bei Malin hergestellt und dabei grosse Teile der sowjetischen 60. Armee abgeschnitten werden. Am 20. Dezember nahm darauf die sowjetische 3. Garde-Panzerarmee ihre Offensive aus dem Raum Brusilow nach Westen wieder auf und durchbrach die Verbindungen des XIII. und XXXXVIII. Korps. Die Truppen General Krügers erreichen noch die Linie Stremigorod und Kosinowka, mussten aber die geplante Umfassung am 23. Dezember sofort abbrechen, weil die eigene Abschneidung drohte. Der Angriff des XXXXVIII. Panzerkorps am nördlichen Irscha-Ufer sowie ein gleichzeitiger Angriff des XIII. Armeekorps mit der 2. Fallschirmjäger-Division von Osten her auf Radomyschl drohten kurzfristig drei sowjetische Panzer- und vier Schützenkorps südostwärts von Korosten im Raum Meleni einzuschliessen. Unter Zuführung der 1. Panzerarmee und der 18. Armee gelang es der sowjetischen Führung jedoch, die deutsche Offensive zu stoppen und die Gefahr abzuwenden. Nach dem allgemeinen deutschen Rückzug auf Schitomir und der am 24. Dezember einsetzenden sowjetischen Grossoffensive, ging es der 1. Panzer-Division nur noch darum, der bereits im Raum Korostyschew abgeschnittenen 8. Panzer-Division einen Rückweg freizukämpfen.
Ausgang
Das am 6. November befreite Kiew wurde von der Rote Armee klar behauptet. Mehrere Versuche General von Mansteins zur Rückeroberung der Stadt durch die Wehrmacht schlugen im November und Dezember fehl. Am 10. Dezember 1943 wurde der Befehlshaber der deutschen 4. Panzerarmee, Generaloberst Hoth durch General Raus ersetzt. Am 24. Dezember wurde die Schlacht in der Schitomir-Berditschewer Operation durch die 1. Ukrainische Front erfolgreich fortgesetzt. Die Sowjets befreiten am 28. Dezember Kasatin, Schitomir fiel am 31. Dezember endgültig in sowjetische Hände. Bis zum 30. Dezember erweiterten die Sowjets den Durchbruch auf die neue Linie Rowno-Schepetowka-Schmerinka-Winniza-Hristinowka-Uman.
Unternehmen Advent (06.11.1943 – 30.11.1943)
Unternehmen Advent war der Deckname einer deutschen Angriffsoperation im Dezember 1943 in der Sowjetunion.
Vorgeschichte
Mit rund 730.000 Soldaten griff die 1. Ukrainische Front der Roten Armee die Heeresgruppe Süd der deutschen Wehrmacht im Abschnitt östlich von Kiew an. Kiew wurde am 6. November1943 von der Roten Armee zurückerobert. Im Rahmen dieser zehntägigen Angriffsoperation drangen sowjetische Truppen rund 150 Kilometer in Richtung Westen vor. Ein deutscher Gegenangriff schlug zunächst fehl. Bis zum 30. November 1943 gelang es jedoch Generalfeldmarschall Erich von Manstein unter Aufbietung aller verfügbaren Reservekräfte, die Front vor Kiew zu stabilisieren.
Das Unternehmen
Am 6. Dezember 1943 befahl Manstein dem XXXXVIII. Panzerkorps, das zu diesem Zeitpunkt nur noch über rund 200 Panzerfahrzeuge verfügte, den Angriff zur Rückeroberung von Kiew. In einer komplexen zick-zackförmigen Angriffsoperation gelang es drei deutschen Panzerdivisionen, die sowjetische Front zu durchbrechen und eine Zangenbewegung zu beginnen, die zu einer Einschliessung von drei sowjetische Panzer- und vier Schützenkorps im Gebiet um den Ort Meleni („Sack von Meleni“) führte. Während dieser Operation wurden bei einem gefallenen sowjetischen Offizier Lagekarten entdeckt, die die Vorbereitung eines sowjetischen Grossangriffs in diesem Abschnitt zeigten. Um die Vernichtung der deutschen Einschliessungstruppen zu verhindern, wurde auf eine Ausräumung des Sackes von Meleni verzichtet und eine Rückzugbewegung eingeleitet. Der Militärhistoriker Friedrich Wilhelm von Mellenthin prägte für diese kühne taktische Angriffsoperation den Begriff Miniatur-Tannenberg in Anlehnung an den operativen Verlauf der Schlacht von Tannenberg in Ostpreussen im Jahre 1914. Es war die letzte taktisch zunächst erfolgreiche Militäroperation von Mansteins im Deutsch-Sowjetischen Krieg.
Schlacht um Ortona (20.12.1943 – 28.12.1943)
Die Schlacht um Ortona (20.–28. Dezember 1943) war eine kleine, aber extrem erbittert gekämpfte Schlacht zwischen den deutschen Fallschirmjägern des III. Bataillons, des Fallschirmjägerregiments 3 der 1. Fallschirmjäger-Division unter Generalleutnant Richard Heidrich und den angreifenden kanadischen Streitkräften der kanadischen 1. Infanteriedivision unter Major General Christopher Vokes während des „blutigen Dezembers“. Die Schlacht, wegen der Tödlichkeit der Häuserkämpfe auch „Klein Stalingrad“ oder „Italienisches Stalingrad“ genannt, fand in der kleinen Stadt Ortona am adriatischen Meer statt, die zu Friedenszeiten 20.000 Einwohner hatte.
Ausgangslage
Nach den Landeoperationen der alliierten Streitkräfte in Süditalien (Operation Avalanche und Baytown) und den Problemen im Landekopf von Salerno, gewannen die Operationen der US- und britischen Streitkräfte – gemessen am späteren Vormarsch in der ersten Jahreshälfte 1944 – relativ schnell an Boden. Während sich die US-Armee entlang der italienischen Westküste vorarbeitete, stiess die britische Armee entlang der Adriaküste vor.
Bereits am 27. September konnte diese die Flugfelder bei Foggia besetzen und damit ein wichtiges Ziel der alliierten Operation erreichen. Allerdings geriet der Vormarsch mit dem Erreichen der ersten Verteidigungsstellungen ins Stocken. Die deutsche Wehrmacht hatte unter Generalfeldmarschall Kesselring mehrere Verteidigungslinien quer durch den italienischen Stiefel errichtet. Der Durchbruch durch die ersten beiden Stellungen – die Volturno- und die Barbara-Linie – gelang den britischen Streitkräften Anfang Oktober bzw. Anfang November 1943. Die dritte Verteidigungslinie – die Gustav- oder Winterlinie – stellte allerdings ein grösseres Hindernis dar. Deren östliche Flanke lehnte sich im Bereich der Mündung des Moro bzw. in der Umgebung Ortonas an die Adria an. Mit der Eroberung Ortonas hätte die 8. Armee nicht nur die Winterlinie durchbrochen und sich einen natürlichen Tiefseehafen sichern können. Durch den weiteren Vormarsch in Richtung Norden lag Pescara mit seiner direkten Verbindung nach Rom in greifbarer Nähe.
Die Offensive der britischen 8. Armee gegen die Winterlinie begann östlich der Berge des Apennin am 23. November 1943 mit dem Antreten britischer Truppenteile gegen die vorderen Verteidigungsstellungen der Gustav-Linie am nördlichen Ufer des Sangro. Nach wenigen Tagen zogen sich die deutschen Verteidiger in Richtung des Moro, dessen Mündung vier Kilometer südlich von Ortona liegt, zurück. Für die Überquerung des Moro wurde die britische 78. Infanterie-Division auf der rechten Flanke der Alliierten durch die kanadische 1. Infanterie-Division abgelöst. Parallel zum weiteren Vorstoss der kanadischen 1. Infanterie-Division sah die Planung Montgomerys das Vordringen der 2. New Zealand Division auf Orsogna vor.
Ortona war auf den ersten Blick von hohem strategischen Wert, da es über einen der wenigen Tiefwasserhäfen an der Ostküste Italiens verfügte. Ihn einzunehmen hätte für die britische 8. Armee unter Field Marshal Bernard Law Montgomery eine erhebliche Verkürzung der Nachschublinien bedeutet, die sich zu der Zeit bis nach Bari und Tarent erstreckten.
Allerdings war der Hafen bereits zu Beginn des Angriffs auf Ortona für die Alliierten von zweifelhaftem Wert, da Anfang Oktober 1943 eine deutsche Pioniereinheit mit der Sprengung der Hafenmole begonnen hatte und mehrere Blockadeschiffe versenkt wurden. Die alliierten Truppen erhielten dennoch den Befehl, die Offensive im Dezember 1943 aufzunehmen und in Richtung Ortona/Pescara vorzurücken. Dabei stiessen die britischen Einheiten der kanadischen 1. Infanterie-Division nicht nur in unmittel-barer Nähe Ortonas auf heftigen Widerstand.
Bereits im Vorfeld der eigentlichen Kämpfe um das Stadtgebiet stellte sich der Vormarsch als äusserst schwierig dar. Die kanadische 1. Infanterie-Division stand bei der Überquerung des Moro südlich Ortonas Teilen der 90. Panzergrenadier-Division (Generalleutnant Carl-Hans Lungershausen) und der 26. Panzer-Division (Generalleutnant Smilo Freiherr von Lüttwitz) gegenüber, welche nicht nur die ab dem 6. Dezember 1943 begonnene Bildung von Brückenköpfen erschwerten, sondern eingesetzte Truppenteile dazu zwangen, den Rückzug aus ihren Brückenköpfen vorzubereiten. Erst am 9. Dezember verdrängten alliierte Truppen die deutschen Verteidiger vom Ufer des Moro in die Tiefe der deutschen Verteidigungsstellungen. Damit stand den Kanadiern der Weg nach Ortona aber noch nicht offen.
Die 1. Infanterie-Division erreichte nach Überquerung des Moro ein Tal, dessen Südflanke die deutschen Verteidiger hervorragend ausgebaut und für die Defensive vorbereitet hatten. Der als „The Gully“ bekannt gewordene Schauplatz verzögerte den Vormarsch auf Ortona erheblich. Hier wehrte die 90. Panzergrenadierdivision Angriffe der 2. kanadischen Infanterie-Brigade und 3. kanadischen Infanterie-Brigade erfolgreich ab. Am Abend des 13. Dezember 1943 wurde die durch Verluste stark geschwächte Division schliesslich von der 1. Fallschirmjägerdivision abgelöst.
Erst nach weiteren Angriffen der Kanadier und deutschen Gegenstössen konnte das Areal am 19. Dezember endgültig gesichert werden. Die sich aus „The Gully“ zurückziehenden deutschen Einheiten bezogen vorbereitete Verteidigungsstellungen in Ortona. Hier hatten deutsche Einheiten zur Vorbereitung eine Vielzahl von geschickt ineinandergreifenden Verteidigungspositionen in der gesamten Stadt errichtet, das Gelände vermint und wichtige Durchfahrtsstrasse durch Sprengungen umliegender Häuser blockiert. Dieses Verteidigungssystem und der Befehl „um jedes letzte Haus und Baum“ zu kämpfen machte die Stadt zu einem erheblichen Hindernis für jeden Angreifer.
Verlauf
Die Kanadier standen bei Ortona den Truppen der berühmten 1. Fallschirmjäger-Division gegenüber. Deren Soldaten waren mehrjährig kampferprobt und erhielten von Adolf Hitler den Befehl, Ortona um jeden Preis zu halten.
Der Angriff der Kanadier auf die Stadt begann am 20. Dezember durch das Loyal Edmonton Regiment der kanadischen 2. Brigade zusammen mit unterstellten Teilen der Seaforth Highlanders of Canada. Unterdessen begannen Teile der 3. Infanteriebrigade der kanadischen 1. Infanteriedivision den Angriff aus dem Norden, um dann auf der Westseite der Stadt mithilfe eines Flankenangriffs den rückwärtigen Raum der Deutschen abzuschneiden, machten aber aufgrund des schwierigen Terrains und der ausgefeilten deutschen Verteidigung nur langsam Fortschritte.
In der Stadt selbst errichteten die Deutschen verschiedene Barrikaden und verteilten Schutt in den engen Seitenstrassen, die die Piazza Municipale umgaben. Der einzig verbleibende Weg für die kanadischen Panzer verlief über den Corso Vittorio Emanuele, der schwer vermint und mit zahlreichen Fallen übersät war; Fallen, die den Deutschen mit tödlicher Effizienz durch die acht Tage dauernden Kämpfe dienten.
Die Deutschen versteckten zudem mehrere Maschinengewehre und Panzerabwehrstellungen in der gesamten Stadt, was das Vorrücken von Panzern und Infanterie erheblich erschwerte. Der brutale Kampf von Haus zu Haus führte die Kanadier zum Einsetzen einer neuen Taktik, dem sogenannten „mouse-holing“ (dabei wird sich Zugang zu Räumen oder Gebäuden mit Hilfe von Sprengungen durch Wände verschafft).
Diese Taktik bediente sich Waffen wie dem PIAT (oder schwerfälligen Panzerabwehrkanonen) um durch die Wand eines Gebäudes zu brechen und vorzustossen, da die Häuser in Ortona zusammenhängend gebaut waren. Nach einem Durchbruch warfen die Soldaten Handgranaten und stürmten danach durch die „Mauselöcher“, klärten die oberen Stockwerke auf und machten sich dann wieder auf den Weg nach unten, wo beide Gegner erneut im Häuserkampf rangen. Das „mouse-holing“ wurde auch genutzt, um angrenzende Wände von Räumen zu durchstossen mit der Absicht die dahinterliegenden feindlichen Truppen zu überraschen. Diese Taktik fand zunehmend Verwendung, da das Vorrücken auf der Strasse mit hohen Verlusten auf kanadischer und deutscher Seite verbunden war. Ein besonders tödliches Ereignis war die Zerstörung eines kompletten, durch die Kanadier besetzen, Hauses durch den deutschen Obergefreiten und Fallschirmpionier Karl Bayerlein (3. Kompanie, Fallschirmjägerpionier-Bataillon 1, 1. Fallschirmjäger-Division). Ein Zug aus 1 Offizier und 22 Mann des Edmonton-Regiments wurden dabei verschüttet und lediglich ein Mann konnte Tage später lebend geborgen werden. Die Kanadier vergalten dies, indem sie ein anderes Gebäude zerstörten, in dem sich zwei deutsche Gruppen befanden, und sie durch den Einsturz töteten.
Nach sechs Tagen erbitterter Kämpfe schloss sich das III. Bataillon, Princess Patricia’s Canadian Light Infantry, 2. Brigade zusammen mit Panzern des Three Rivers Regiments (Régiment de Trois-Rivières), 1st Canadian Armoured Brigade den kämpfenden Truppen an.
Am 28. Dezember zogen sich die dezimierten deutschen Truppen, denen es an Nachschub fehlte, nach acht Tagen des Gefechts zurück. Im Dezember 1943 fielen in ganz Italien rund 1200 kanadische Soldaten.
An den Kämpfen in Ortona nahm auch der Oberleutnant der Fallschirmjäger Harald Quandt teil, Ziehsohn von Joseph Goebbels, aus der ersten Ehe seiner Ehefrau Magda Goebbels. Er geriet einige Monate später bei Bologna in britische Kriegsgefangenschaft.
Operation Dnepr-Karpaten (24.12.1943 – 17.04.1944)
Die Dnepr-Karpaten-Operation war eine grosse Offensive der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg, die vom 24. Dezember 1943 bis zum 17. April 1944 dauerte.
Vorgeschichte
Im südlichen Teil der Ostfront befand sich die Rote Armee seit dem Fehlschlag des deutschen Unternehmens Zitadelle im Juli 1943 ständig in der Offensive gegen die Wehrmacht, die mit ihren dezimierten und desorganisierten Truppen vergeblich versuchte, stabile Verteidigungslinien zu bilden. Innerhalb weniger Monate war die Rote Armee vom Donez und Mius zum Dnepr und zur Molotschna vorgestossen und hatte das Donezbecken befreit. Die an diesen Flüssen im Bau befindliche Panther-Stellung konnte in der Schlacht am Dnepr an mehreren Stellen durchbrochen werden. Zwischen den Heeresgruppen Mitte und Süd hatte sich im Bereich der Pripjetsümpfe eine über 150 Kilometer breite Lücke (das „Wehrmachtsloch“) gebildet, in der sowjetische Partisanen beinahe ungehindert operieren konnten. Ende Oktober/Anfang November gelang es der 4. Ukrainischen Front im Süden, die Linien der deutschen 6. Armee zu durchbrechen und die Mündung des Dnepr bei Cherson zu erreichen, womit die Krim abgeschnitten war. Die 2. Ukrainische Front überschritt im November den Dnepr zwischen Tscherkassy und Dnepropetrowsk auf breiter Front und bedrohte die in einem spitz zulaufenden Frontvorsprung in der grossen Dneprschleife stehenden deutschen Truppen mit der Abschneidung. Die 1. Ukrainische Front schlug zu dieser Zeit die Schlacht um Kiew gegen die deutsche 4. Panzerarmee, die mit der Befreiung der ukrainischen Hauptstadt endete. Ihr weiteres Vordringen nach Westen in Richtung Schitomir und Korosten konnte im Dezember nur mit Mühe aufgehalten werden.
Die Situation an der Ostfront wurde dadurch weiter kompliziert, dass sich die Heeresgruppe Mitte Ende 1943 ebenfalls ständigen sowjetischen Angriffen ausgesetzt sah und dass Hitler in seiner „Weisung Nr. 51“ vom 3. November 1943 eine weitere Schwächung der zur Abwehr einer alliierten Landung im Westen bereitgehaltenen Truppen ausgeschlossen hatte. Dies hatte zur Folge, dass die Heeresgruppen an der Ostfront mit den vorhandenen, stark abgekämpften Divisionen auskommen mussten und Frontlücken kaum noch geschlossen werden konnten. Zudem bestand Hitler immer wieder darauf, aussichtslose Positionen bis zuletzt zu verteidigen, Brückenköpfe an den Flussläufen zu halten und die Krim unter keinen Umständen aufzugeben. Notwendige Rückzüge wurden meist zu spät genehmigt, was zu nicht mehr zu ersetzenden Verlusten an Menschen und Ausrüstung führte.
Verlauf
Gesamtlage der Heeresgruppe Süd
Nach dem Verlust von Kiew an die 1. Ukrainische Front unter Armeegeneral Watutin stand die deutsche 4. Panzerarmee Ende Dezember mit dem rechten Flügel noch am Dnepr. Tscherkassy war erst am 14. Dezember durch das 73. Schützenkorps (Generalmajor Batizki) der 52. Armee befreit worden. Bei Kanew hielt das XXIV. Panzerkorps die Verbindung zum XXXXII. Armeekorps, dem linken Flügel der 8. Armee aufrecht.
Von Kiew etwa 45 km den Dnjepr entlang abwärts, bog die Front scharf nach Westen auf Fastow ab, wo die Front vom VII. und XIII. Armeekorps bis in den Raum nördlich Schitomir gehalten wurde. Nördlich davon abgesetzt, mit Front nach Osten, war das LIX. Armeekorps im Raum Korosten konzentriert. Die 1. Panzerarmee und die 6. Armee standen gegenüber der 3. Ukrainischen Front noch immer weit nach Osten vorgelagert, am unteren Bogen des Dnepr und hielten Brückenköpfe bei Kriwoi Rog und Nikopol. Nach dem Verlust der Nogaischen Steppe waren auch die Truppen der 4. Ukrainischen Front auf breiter Font zum unteren Dnepr aufgeschlossen, der dort befehlenden Heeresgruppe A war dadurch die Landverbindung mit der noch auf der Halbinsel Krim haltenden 17. Armee verloren gegangen.
Schitomir-Berditschewer Operation (24. Dezember 1943 – 14. Januar 1944)
Die sowjetische Grossoffensive wurde am 24. Dezember 1943 durch die 1. Ukrainische Front im Westen und Südwesten von Kiew aus dem grossen Brückenkopf am rechten Ufer des Dnepr zwischen Radomyschl und Brusiłów eingeleitet. Watutins Front zählte etwa 800.000 Mann, 11.400 Geschütze und Granatwerfer, 1125 Panzer und Selbstfahrlafetten. Im Einzelnen führten den Angriff nach Nordwesten auf Korosten die 13. und 60. Armee, die 1. Gardearmee und die 18. Armee stiess in westlicher Richtung auf Schitomir, die 27., 38. und 40. Armee operierte nach Süden, während die 1. Panzer- und die 3. Gardepanzerarmee erst am zweiten Tag der Offensive in der Hauptstossrichtung eingeführt wurden.
Am 25. Dezember gelang den Sowjets der operative Durchbruch, die 1. Gardearmee (Gretschko) und die 1. Panzerarmee (Katukow) brachen mit 14 Schützendivisionen, vier Panzer- und einem mechanischen Korps unterhalb der Strasse Schitomir-Kiew in süd-westlicher Richtung auf Berditschew und Kasatin durch. Die strategische Bedrohung am linken Flügel der Heeresgruppe Süd war stärker als je zuvor. Beim Glücken des sowjetischen Angriffplanes drohte die Abschneidung aller deutschen Truppenteile zwischen Dnjepr und Dnjestr. Nach einem drohenden Ausfall der verbündeten Rumänen wäre auch die Versorgung der Heeres-gruppe A unmöglich zu bewerkstelligen gewesen. Die Eisenbahnstrecken Lublin-Kowel-Schepetowka-Berditschew-Kasatin und etwa fünfzig Meilen weiter südlich, die etwa parallel verlaufende Strecke Lemberg-Tarnopol-Proskurow-Schmerinka waren bedroht. Watutin erweiterte den Angriff auch im Norden bis in den Raum nördlich von Schitomir.
Bis zum 26. Dezember glaubte der Befehlshaber der Heeresgruppe Süd, Generalfeldmarschall von Manstein noch daran, durch Gegenangriffe des XXXXVIII. Panzerkorps, den sowjetischen Durchbruch in Richtung Berditschew und Kasatin stoppen können. General der Panzertruppen Raus, der Oberbefehlshaber der 4. Panzerarmee, trat dafür ein, den sowjetischen Stoss im Norden zum Pripjet vorerst zu ignorieren und zuerst die sowjetischen Angriffsspitzen nach Fastow aufzuhalten. Am 27. Dezember wollte Manstein seine Truppen zurückziehen; dies wurde von Hitler abgelehnt. Die 60. Armee unter General Tschernjachowski war bei Radomyschl durchgebrochen und wurde nördlich von Korostyschew durch deutsche Gegenangriffe festgehalten. Drei deutsche Panzerdivisionen – die 8., 19. Panzer-Division und die 2. SS-Panzer-Division „Das Reich“ versuchten am 28. Dezember vergeblich den Durchbruch auf Schitomir zu verhindern. Derweil riss die sowjetische 1. Gardearmee im Zusammenwirken mit der 18. Armee (General Leselidze) eine 30 Kilometer breite Lücke im Abschnitt zum westlich haltenden XIII. Armeekorps auf. Die Sowjets befreiten am 28. Dezember Kasatin, Korosten fiel am 29. Dezember an die 13. Armee und Schitomir am 31. Dezember. Bis zum 30. Dezember erweiterten die Sowjets den Durchbruch auf 300 km Breite und 100 km Tiefe und konnten die neue Linie Rowno-Schepetowka-Schmerinka-Winniza-Hristinowka-Uman erreichen. Eine zweite Lücke zwischen dem VII. und XXXXII. Armeekorps war aufgerissen. Am 3. Januar 1944 befreiten die Sowjets Nowograd-Wolynski, am 4. Januar Belaja Zerkow und am 5. Januar Berditschew.
Anfang Januar 1944 war an der am nördlichen Abschnitt klaffenden Lücke zur Heeresgruppe Mitte das schwache LIX. Armeekorps bis an die ehemalige polnische Grenze beiderseits Nowograd-Wolynski zurückgedrängt worden. Von Schepetowka nordwärts bis zum Pripjet klaffte eine weitere Lücke beim dort eingesetzten XIII. Armeekorps, das bei der verlustreichen Abwehr auf die Stärke einer schwachen Division zusammengeschmolzen war. Manstein flog zu einer direkten Aussprache in Hitlers Hauptquartier in Berchtesgaden, konnte aber seine Vorschläge auf gründliche Änderung der Kriegsführung nicht durchsetzen. Der Umgruppierung der 1. Panzerarmee mit drei Panzerdivisionen vom südlichen Abschnitt der Heeresgruppe Süd nach Schitomir wurde aber stattgegeben. Die Krise der Heeresgruppe Süd wurde noch katastrophaler, als die Sowjets auch am unteren Dneprbogen (Nikopol und Kriwoi Rog) zum Angriff übergingen.
Kirowograder Operation (5.–16. Januar 1944)
Die 2. Ukrainische Front unter Iwan Konew sollte gegen die deutsche 8. Armee im Raum Kirowograd angreifen. Insgesamt verfügte die sowjetische Front über 59 Schützen- und 3 Kavallerie-Divisionen mit 550.000. Mann, 265 Panzer und 127 Selbstfahrlafetten, 7.136 Geschütze und 777 Flak sowie 500 Kampfflugzeuge. Unterstützt von einem Kavallerie- und drei mechanischen Korps sowie zwei Panzerkorps.
Am 5. Januar 1944 begann die Offensive gegen das deutsche III. und XXXXVII. Panzerkorps. Auf dem rechten Flügel unterstützten die sowjetische 52. Armee (Generalleutnant K. A Korotejew) und die 4. Garde-Armee (General Ryschow) die Operation. Gegen das nördliche Vorfeld der Stadt wurde im Abschnitt der 53. Armee (Generalleutnant I. V. Galanin) das 5. Garde-Kavalleriekorps eingesetzt. Vom Nordwesten her, stiess das 7. mechanische Korps (Generalmajor Fjodor G. Katkow) im Verband der 5. Gardearmee unter Generalleutnant Schadow frontal gegen die Stadt vor. Im Süden erfolgte zusätzlich der Hauptstoss durch die 5. Garde-Panzerarmee welche im Abschnitt der 7. Garde-Armee (General Schumilow) eingeführt wurde. Die 53. und 5. Gardearmee, die aus dem Gebiet südwestlich von Znamenka angegriffen, konnten bereits am Abend des ersten Tages zwischen 4 und 24 km tief in die deutschen Linien eindringen. Die Front der 2. Fallschirmjäger-Division und der 10. Panzergrenadier-Division wurde durchbrochen und deren Reste mit der 14. Panzerdivision und der 376. Infanterie-Division nördlich von Kirowograd abgedrängt und eingeschlossen. Im Süden entwickelten sich der Angriffe der 7. Gardearmee langsamer, erst nach dem Einführen des 18. und 29. Panzerkorps wurde der Durchbruch beim deutschen LII. Armeekorps erzwungen. Die Eingreifreserven der deutschen 11. und 13. Panzerdivision stoppten die sowjetischen Panzerspitzen durch Gegenangriffe.
Bis zum 7. Januar wurde Kirowograd vom Norden, Süden und Westen umgangen und die Rückzugswege für die deutsche Truppen wurden abgeschnitten. Am Morgen des nächsten Tages wurde die Stadt von drei sowjetischen Armeen im Zusammenwirken mit dem 29. Panzerkorps (Generalmajor I. F. Kiritschenko) nach erbitterten Kämpfen eingenommen. Das 18. Panzerkorps stiess derweil über Fedorowka weiter westlich nach Nowo-Pawlowka durch. Mit den Panzern drangen Teile der 297. Schützendivision (Oberst A. I. Kowtun-Stankewitsch) und die 50. Schützendivision (Generalmajor N. F. Lebedenko) in die Stadt ein. In den folgenden Tagen mussten die deutschen Truppen weiter zurückweichen. Deutsche Gegenschläge der Panzer-Grenadier-Division Grossdeutschland und die 3. und 11. Panzer-Division konnten den Vorstoss der Roten Armee am 10. Januar endlich stoppen und konnten westlich der Stadt die Front stabilisieren. Zum Ende der Operation am 16. Januar verlief die Front auf der Linie östlich von Smela, westlich von Kirowograd und nördlich von Nowgorodka. Die Rote Armee war rund 40–50 km vorgestossen und hatte die Voraussetzungen für den Kessel bei Tscherkassy geschaffen.
Korsun-Schewtschenkowsker Operation: (24. Januar bis 17. Februar 1944)
Der linke Flügel der 1. Ukrainische Front unter Armeegeneral Nikolai Fjodorowitsch Watutin und die Masse der 2. Ukrainischen Front unter Generaloberst Iwan Stepanowitsch Konew stellten zusammen etwa 336.000 Soldaten (in der ersten Angriffsphase befanden sich nach sowjetischen Quellen etwa 255.000 Mann im Kampf) bereit, dazu ein Mechanisiertes Korps und vier Panzerkorps mit etwa 600 Panzer und Selbstfahrlafetten, 5.300 Geschütze und Granatwerfer sowie 772. Flugzeuge unterstützen den Doppelangriff. Ihnen gegenüber stand die deutsche 8. Armee unter General der Infanterie Otto Wöhler. Sie bestand aus 14 Divisionen (davon drei Panzer-Divisionen und eine motorisierte Brigade) mit etwa 170.000 Soldaten, 2.600 Geschütze und 310 Panzer, darunter die die 5. SS-Panzer-Division „Wiking“ und die 5. SS-Freiwilligen-Sturmbrigade „Wallonien“.
Am 24. Januar 1944 griff die 2. Ukrainische Front mit der 4. Gardearmee und der 5. Gardepanzerarmee aus dem Osten in Richtung auf Schpola an, der Angriff der 1. Ukrainische Front vom Westen her erfolgte am 26. Januar mit der 6. Panzerarmee (General Krawtschenko) in südwestlicher Richtung auf Swenigorodka. Vor dem Angriff der 6. Panzerarmee musste die 27. und 40. Armee die Front durchbrechen. Die 4. Garde- und 53. Armee erhielten im Osten die gleiche Aufgabe, dann wurde die 5. Garde-Panzerarmee eingeführt. Die sowjetische 52. Armee sicherte an der nördlichen Flanke des sowjetischen Angriffskeiles, nach dem Durchbruch der Truppen des Generals Korotejew wurde das 5. Garde-Kavalleriekorps (General Seliwanow) zum Nachstossen eingesetzt. Die deutsche 389. Infanterie-Division wurde bei diesem Angriff grossteils zerschlagen, deren Reste von der am Tjasmyn-Abschnitt bei Smela haltenden 72. Infanterie-Division aufgenommen. Auch im Westen gelang den sowjetischen Truppen bei Bojarka der Durchbruch, die beiderseits des Gniloj Tikisch eingesetzte deutsche 198. Infanterie-Division wurde geschlagen und das deutsche VII. Armeekorps nach Südwesten abgedrängt. Die deutsche 88. Infanterie-Division wurde nach Osten auf Boguslaw zurück-geworfen, Medwin und Bojarka fielen am 26. Januar in sowjetische Hände. Ab 27. Januar begannen von Süden her, erste ungenügend angesetzte Gegenangriffe des III. (General Breith) und XXXXVII. Panzerkorps (General Vormann) gegen die Flanke der Roten Armee, um den Durchbruch aufzuhalten. Vor Beginn der sowjetischen Offensive waren die 11. und 14. Panzerdivision aus dem Kampfraum abgezogen worden und südlicher in den Raum von Nowomirgorod verlegt worden.
Am Morgen des 28. Januar erfolgte die Vereinigung der sowjetischen Angriffskeile: Die Vorhut der 6. Panzerarmee, die 233. Panzer-brigade des 5. mechanisierten Korps (Generalleutnant M. W. Wolkow) traf nördlich von Swenigorodka auf Einheiten des 20. Panzerkorps (Generalleutnant Laszarew) der 5. Garde-Panzerarmee. Es gelang etwa sechs deutsche Divisionen (XI. und XXXXII. A.K.) in einem Kessel westlich von Tscherkassy im Raum, um Korsun und Boguslaw einzuschliessen. Nach sowjetischen Angaben befanden sich 80.000 Soldaten im Kessel, nach deutschen Angaben waren es 56.000 Mann.
Anfang Februar war im Süden des Kessel die neue Front der 1. Panzerarmee und 8. Armee mit zehn Divisionen entstanden, darunter die 3., 17., 11. und 13. Panzerdivision, die 34., 198., 167., 320. und 376. Infanterie-Division sowie 4 Sturmgeschütz-Brigaden. Zwischen dem 4. und 10. Februar waren auch die 1. und 16. Panzerdivision, die 1. SS-Panzerdivision, die 106. Infanteriedivision sowie 4 Panzerbataillone und 3 Sturmgeschütz-Brigaden eingetroffen. Vom Brückenkopf Nikopol war auch die kampfkräftige 24. Panzerdivision am 29. Januar in Nowo Ukrainka eingetroffen. General der Artillerie Wilhelm Stemmermann, Kommandierender General des XI. Armeekorps erhielt das Kommando über die Anfang Februar zwischen Schenderowka und Korsun zusammengedrängten Truppen.
In den folgenden Tagen konnten die sowjetischen Truppen alle deutschen Angriffe abwehren und ihrerseits den Kessel immer weiter zusammendrücken. Ab 6. Februar griff im Westen auch die 2. Panzerarmee an der Seite der Panzerarmee Krawtschenko in die Schlacht ein. Dennoch lehnte Stemmermann am 8. Februar den sowjetischen Aufruf zur Kapitulation ab. Diesem waren intensive Appelle des Nationalkomitees Freies Deutschland und des Bundes Deutscher Offiziere an die eingeschlossenen Truppen und ihre Führer vorangegangen, die aber weitgehend wirkungslos blieben.
Am 11. Februar begann der deutsche Entsatzangriff mit bis zu acht Divisionen (darunter die 1., 16. und 17. Panzer-Division) auf Lysjanka; auf Befehl Hitlers sollte allerdings nur eine Verbindung zum Kessel hergestellt werden, während dieser selbst vollständig zu halten war. Als sich abzeichnete, dass sich der deutsche Angriff wenige Kilometer vor dem Kessel festlaufen würde, befahl Manstein am 15. Februar ohne vorherige Verständigung mit Hitler den Ausbruch. Die eingeschlossenen Divisionen wurden nach Südwesten umgruppiert, um bei Lysjanka über den Gniloi Tikisch auszubrechen. Südöstlich von Chilki und nördlich des Dorfes Komarowka wurde die Korps-Abteilung B, 72. Infanterie-Division und SS Wiking zum Angriff bestimmt. Die Nachhut bildete östlich von Schenderowka die 88. Infanterie-Division, 57. Infanterie-Division und die 5. SS-Freiwilligen-Sturmbrigade „Wallonien“.
Nach deutschen Angaben gelang 40.000 Soldaten der Ausbruch, 19.000 Soldaten starben oder blieben im Kessel zurück, wo sie in Gefangenschaft gerieten. Nach sowjetischen Angaben wurden hingegen 55.000 deutsche Soldaten im Kessel getötet und 18.000 gerieten in Gefangenschaft; während der ganzen Operation waren es demnach nach sowjetischen Angaben 82.000 Tote und 20.000 Gefangene. Insgesamt mussten die sechs eingeschlossenen deutschen Divisionen grosse Verluste hinnehmen und bei ihrem Ausbruch das gesamte schwere Kriegsgerät zurückgelassen.
Iwan Konew wurde für seine Verdienste in dieser Schlacht zum Marschall der Sowjetunion ernannt.
Rowno-Luzker Operation (27. Januar bis 11. Februar 1944)
Nach der Schitomir-Berditschewer Operation sollte die rechte Flanke der 1. Ukrainischen Front unter Nikolai Watutin gegen sechs Infanterie- und vier Panzer-Divisionen der 4. Panzerarmee unter General Raus vorrücken. Die deutsche Verteidigung gegenüber der sowjetischen 13. und 60. Armee war schwach, weil eine Offensive in dieser Gegend mit zahlreichen Wäldern und Sümpfen und in schlechten Wetterverhältnissen (Schlammwetter und Hochwasser) unmöglich schien. Das deutsche LIX. Armeekorps (291. und 96. Infanteriedivision) hatte nach Rückzug aus dem Raum Korosten am 3. Januar auch den Strassenknoten Nowograd Wolynski räumen müssen, so dass den Sowjets jetzt zwei Hauptstrassen offenstanden, eine nach Westen auf Rowno, die andere nach Südwesten, nach Schepetowka. Die deutsche Verteidigung am Goryn-Abschnitt und im Raum Rowno war dem XIII. Armeekorps übertragen worden, welches aus der 208. und 340. Infanterie-Division, der Korps-Abteilung C (Kampfgruppen 183., 217. und 339. Inf.Div.) und der 454. Sicherungs-Division gebildet war. Im Raum Ljubar bis Starokonstantinow war das XXXXVIII. Panzerkorps mit der 2. SS-Division, der 371. Infanterie- sowie der 8. und 19. Panzerdivision konzentriert. Die 7. Panzerdivision fungierte als Reserve der 4. Panzerarmee im Raum Dubno.
Die Hauptrolle des sowjetischen Angriffes wurde der 13. Armee unter Generalleutnant Puchow zugewiesen, zusammen 8 Schützen- und 6 Kavallerie-Divisionen. Den Hauptschlag sollte das 76. Schützenkorps aus dem Raum Sarny nach Westen führen, das 1. und 6. Garde-Kavalleriekorps hatten eine weitreichende Umfassung durchzuführen und die Städte Luzk und Rowno vom Nordwesten her zu erobern. Auf der rechten Flanke der 13. Armee hatte das 77. Schützenkorps die Aufgabe mit der 397. Schützendivision auf Stolin vorzurücken, während die 143. Schützendivision zusammen mit den 76. Schützenkorps den Goryn-Abschnitt überschreiten sollte. Die südlich davon angreifende 60. Armee (General Tschernjachowski) verfügte über zusammen 9 Schützendivisionen sowie das 4. Garde- und 25. Panzerkorps. Das am rechten Flügel eingesetzte 23. Schützenkorps sollte Ostrog einnehmen. Der linke Flügel der 60. Armee (15. und 30. Schützenkorps, 4. Garde- und 25. Panzer-Korps) hatte die im Raum Ljubar liegenden deutschen Truppen, samt den dort festgestellten starken Panzerkräften, zu binden.
Am 27. Januar begann die Offensive. Sowjetische Kavallerie drang schnell 40–50 km in die gegnerische Verteidigung ein und rückte fast unauffällig ins deutsche Hinterland vor. Mit Hilfe von Partisanen passierten die Reiter die fast unzugänglichen Waldwege und Sümpfe und erreichten im Raum Rawalowka den Styr-Abschnitt. Das 1. Garde- Kavalleriekorps unter Generalleutnant Baranow wurde in den Bezirk Rafalowka und Czartorijsk von der nachgezogenen 143. Schützendivision freigemacht. Etwas später wurde auch die 181. Schützendivision dem nachgezogenen 77. Infanteriekorps unterstellt, um die erreichte Styr-Linie zwischen Czartorijsk und Kolki zu sichern.
Das 6. Garde-Kavallerie-Korps unter Generalleutnant Sokolow hatte die Aufgabe, südwestlich in Richtung auf Klewan durchzu-brechen und Rowno von Nordwesten her anzugreifen. Auf der linken Flanke der 13. Armee bei Tutschin überquerte das 24. Schützenkorps (Generalleutnant Kirjuchin) erfolgreich den Goryn-Abschnitt, drang 4 bis 6 Kilometer tief vor, um von Südosten her in Rowno einzudringen. Der 287. Schützendivision (Generalmajor Josif N. Pankratow) gelang noch am ersten Tag der Offensive die Befreiung der Stadt Ostrog. Teile der 226. Schützen-Division (Oberst W. J. Petrenko) befreiten Slawuta.
Am 2. Februar musste das deutsche XIII. Armeekorps Rowno vor dem 6. Garde-Kavallerie-Korps räumen, die 6. Garde-Schützendivision war zusätzlich aus dem Osten und die 112. Schützendivision vom Süden her, in die Stadt eingedrungen. Am gleichen Tag befreite das 1. Garde-Kavalleriekorps zusammen mit Einheiten des 76. Schützenkorps die Stadt Luzk. Am 3. Februar nahm die 13. Armee den wichtigen Eisenbahn-Knotenpunkt Sdolbunow ein, und am 11. Februar wurde Schepetowka von Truppen der 60. Armee befreit. Ab dem 9. Februar begannen schwere Kämpfe um Dubno, die sowjetische Führung hatte dazu das 25. Panzerkorps herangeführt, die Stadt wurde aber noch bis zum 17. März von den deutschen Truppen behauptet. Die sowjetischen Truppen fügten der Wehrmacht eine schwere Niederlage zu und schufen die Voraussetzungen für den Angriff ins Hinterland der Heeresgruppe Süd und für den Angriff auf Kowel.
Am 25. Februar wurde Armeegeneral Watutin bei einem Überfall der Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA) schwer verwundet, daraufhin übernahm Schukow die Führung der 1. Ukrainischen Front.
Nikopol-Kriwoi Roger Operation (30. Januar bis 29. Februar 1944)
Die 6. Armee der Heeresgruppe Süd (seit 2. Februar die Heeresgruppe A) hatte 540.000 Mann, 2.416 Geschütze und Mörser, 327 Panzer und 700 Flugzeuge. Zwei sowjetische Fronten (die 3. Ukrainische unter Rodion Malinowski und die 4. Ukrainische unter Fjodor Tolbuchin) hatten 705.000 Mann, 7.796 Geschütze und Mörser, 238 Panzer und 1.333 Flugzeuge. Das deutsche IV., XVII. und XXIX. Armeekorps befand sich noch in einem östlichen Frontvorsprung an der Dnjepr-Linie.
Um die Wehrmacht von der Richtung eines Hauptangriffes aus dem Raum 40 Kilometer nordwestlich von Saporoschje abzulenken, begann am 30. Januar von Süden her durch die 5. Stossarmee eine neue Offensive gegen den Nikopoler Brückenkopf. Um diesen Stoss aufzuhalten, wurden zwei deutsche Panzerdivisionen dorthin verlegt, ein Umstand, der bald dem sowjetischen Hauptangriff nützte. Nachdem der Fehler erkannt wurde, wurden die 9. Panzer-Division zurückverlegt, doch der sowjetische Hauptstoss hatte derweil die Verbindung zu dem bei Kriwoi Rog stehenden XXX. Armeekorps abgeschnitten. Am 5. Februar befreite die sowjetische 46. Armee (General Glagolew) die Kleinstadt Apostolowo, rechts von ihr spaltete die 8. Gardearmee (General Tschuikow) die 6. Armee in zwei Teile. General Hollidt befahl daraufhin seinen abgeschnittenen Armeeteilen den Rückzug. Die 4. Ukrainische Front, die am 31. Januar eine Offensive begann, eroberte mit der 3. Gardearmee (General Leljuschenko) den Nikopoler Brückenkopf und befreite am 8. Februar zusammen mit Teilen der 6. Armee der 3. Ukrainischen Front die am nördlichen Dnjepr-Ufer liegende Stadt Nikopol. Am 11. Februar begann ein Gegenschlag des XXXX. Panzerkorps in Richtung auf Apostolowo, um den noch offenen Korridor entlang des rechten Dneprufers für die zurückweichenden deutsche Truppen zu halten. Die sowjetische Truppen wurden zwar verlangsamt, aber die zurückgehenden Einheiten der Wehrmacht erlitten hohe Verluste. Am 17. Februar setzte die 3. Ukrainische Front ihre Offensive fort, die sowjetische 37. und 46. Armee befreiten am 22. Februar Kriwoi Rog und erreichte zum 29. Februar den Fluss Ingulez.
Die Rote Armee zerschlug zwölf deutsche Divisionen (darunter drei Panzer-Divisionen und eine motorisierte) und eroberte die Mangan- und Eisenerzvorkommen.
Proskurow-Czernowitzer Operation (4. März bis 17. April 1944)
Nachdem Marschall Watutin Ende Februar bei den Kämpfen tödlich verwundet wurde, übernahm Marschall Schukow auf Anweisung der Stawka den Oberbefehl der 1. Ukrainischen Front, welche über 56 Schützen-Divisionen, 6 Kavallerie-Divisionen, 7 Panzer- und 3 mechanisierte Korps verfügte und aus etwa 800.000 Mann, 11.900 Geschütze, 1.400 Panzer und 477 Flugzeuge bestand. Am 4. März begann die 1. Ukrainische Front eine neue Offensive gegen die deutsche Heeresgruppe Süd (ab 1. April umbenannt in Heeresgruppe Nordukraine) unter Erich von Manstein (ab 31. März unter Walter Model). Zum 7.–10. März erreichte die Rote Armee die Linie Ternopol–Proskurow und unterbrach die wichtigste Versorgungslinie im Süden der deutschen Ostfront – die Eisenbahnlinie Lemberg–Odessa. Die Wehrmacht führte hier einige Gegenschläge durch und setzte dabei neun Panzer- und sechs Infanterie-Divisionen ein. Die STAWKA stoppte ihre Truppen, um die Gegenangriffe abzuwehren. Zum 21. März befreiten sowjetische Truppen Proskurow, Winniza und Schmerinka und warfen die deutschen Truppen nach Kamenez-Podolski zurück. Die 13. Armee erreichte die Zugänge nach Brody.
Am 21. März wurde die Offensive in die Hauptrichtung fortgeführt, wobei zum ersten Mal während des Krieges drei sowjetische Panzerarmeen eingesetzt wurden. Am 23. März wurde Czortków befreit, am 24. März überquerten die sowjetischen Truppen den Dnestr und betraten zum ersten Mal ausländischen Boden (Rumänien), am 29. März überquerten sie den Pruth und besetzten am gleichen Tag Czernowitz. Am 26. März befreite die sowjetische 4. Panzerarmee Kamenez-Podolski. Nördlich dieser Stadt wurde die deutsche 1. Panzerarmee eingeschlossen (Kessel von Kamenez-Podolski). Entgegen allen Erwartungen wendete sich die Armee als „wandernder Kessel“ westwärts. Bei Buczacz in Galizien wurde der Kessel am 7. April von aussen aufgebrochen und die Armee wieder in die Abwehrfront eingegliedert. Es waren deutsche Verbände, die südöstlich von Lemberg einen Gegenstoss durchführten. Das OKW verlegte dazu Truppen aus Frankreich (II. SS-Panzerkorps), dem Reich, Jugoslawien und Ungarn (die 1. ungarische Armee). Am 17. April, nach dem Stillstand der deutschen Gegenangriffe, schlossen auch die sowjetischen Truppen die Operation ab. Während des Ausbruchs der deutschen 1. Panzerarmee wurden 399 sowjetische Panzer und Sturmgeschütze, sowie 280 Geschütze zerstört. Die Verluste der deutschen Truppen beliefen sich auf 2311 Gefallene, 3567 Vermisste und 8364 Verwundete.
Die Rote Armee stiess bei dieser Operation 80–350 km nach Westen und Süden vor, erreichte die Karpaten und zerschnitt somit die deutsche Ostfront in zwei Teile. Die Heeresgruppe Süd, inzwischen Heeresgruppe Nordukraine, erlitt ungeachtet der gelungenen Befreiung der 1. Panzerarmee insgesamt eine schwere Niederlage (20 Divisionen verloren zum Teil mehr als die Hälfte ihres Bestandes).
Uman-Botoșaner Operation (5. März bis 17. April 1944)
Die 2. Ukrainische Front unter Marschall Iwan Konew begann gleichzeitig zur westlicher laufenden Proskurow-Czernowitzer Operation einen Angriff gegen die deutsche 8. Armee unter General der Infanterie Otto Wöhler. Konews Truppen zählten 691.000 Mann, 8.890 Geschütze und Granatwerfer (einschliesslich 836 Flak), 670 Panzer und Selbstfahrlafetten sowie 551 Flugzeuge. Marschall Konews Absicht war es die neue Offensive mit vier Armeen (27., 40., 52., und 4. Gardearmee) und drei Panzerarmeen (5. Garde-, 2. und 6 Panzerarmee) im Raum Uman auf Gaissin durchzubrechen. Daneben war auch das 5. Garde-Kavalleriekorps, das 7. und 8. mechanisierte Korps verfügbar. Der Südliche Bug sollte dabei überwunden und der Dnjestr erreicht werden. Als Nebenangriff war geplant, den linken Flügel der Front mit der 53. Armee, sowie die 5. und 7. Gardearmee über Nowo-Ukrainka von Norden und Süden vorgehen zu lassen.
Am 5. März begann die Offensive. Am Abend des zweiten Angriffstages war die deutsche Verteidigung auf 60 km Breite durch-brochen und die vorgehenden Formationen bis 25 km Tiefe vorgedrungen. Am 7. März überquerten sowjetische Truppen den Fluss Gorni Tikitsch. Erst am 8. März begannen Truppen der 5. und 7. Gardearmee (General Schumilow) ihre Offensive aus dem Raum südwestlich von Kirowograd und konnten im Kampf mit dem deutschen LII. Armeekorps vorerst auf 12 km Breite bis zu 7 km Tiefe vordringen.
Am Abend des 10. März brach das 29. Panzerkorps der 5. Garde-Panzerarmee (General Rotmistrow) den Widerstand des deutschen VII. Armeekorps und drang in den südöstlichen Stadtrand von Uman ein. Am selben Tag eroberten die Truppen der 2. Panzerarmee (General Bogdanow) in Zusammenwirken mit dem 5. Garde-Panzerarmee und der 52. Armee (Generalleutnant Korotejew) die Stadt Uman vollständig, wobei fast 350 Geschütze vernichtet oder erbeutet werden konnten.
Die am rechten Flügel der 2. Ukrainischen Front anschliessende 38. Armee der 1. Ukrainischen Front gelang es am 15. März den Südlichen Bug bei Winniza zu überschreiten und südlich davon einen Brückenkopf anzulegen. Dieser Erfolg erleichterte der südlicher vorgehenden 40. Armee das parallel dazu angestrebte Vordringen über den Fluss. Sowjetische Truppen überquerten infolge den Südlichen Bug auf breiter Front. In der Nacht des 19. März überquerte die Vorhut der 6. Panzerarmee (General Krawtschenko) in der Gegend von Serebrja bereits den Dnestr, wo es der 4. Gardearmee (General Ryschow) am 17. März gelang, einen Brückenkopf bei Jampol zu errichten. Mogilow-Podolski wurde am 19. März durch Einheiten des 35. Schützenkorps (Generalmajor Viktor G. Sholudew) der 27. Armee im Zusammenwirken mit dem 5. Panzerkorps (Generalleutnant Wolkow) der 6. Panzerarmee befreit.
Am 17. März konnten Teile der 5. Gardearmee und die 16. mechanisierte Brigade des 7. mechanisierte Korps Nowo-Ukrainka befreien. Nach drei Tagen schwerer Kämpfe drangen Teilen des 32. Garde-Schützenkorps (Generalleutnant A. I. Rodimtzev) in Perwomaisk ein und errichteten einen Brückenkopf am westlichen Bug-Ufer. Erfolgreich entwickelte sich nördlich davon auch die Offensive der 53. Armee (Generalleutnant I.M. Managarow), Teile der 25. und 94. Garde-Schützendivision überschritten den Kodyma-Abschnitt und befreiten am 29. März die Stadt Balta. Am gleichen Tag hatten die Armeen des linken Flügels der 2. Ukrainischen Front (53., 5. und 7. Garde-Armee) den Befehl erhalten, die Dnjestr-Übergänge bei Rybniza und Dubăsari zu besetzen und weiter direkt auf Bender vorzudringen. Angriffstruppen der 6. Panzerarmee drangen währenddessen über Mogilow-Podolski am südlichen Dnjestr-Ufer weiter nach Westen bis Chotyn vor und versperrten der deutschen Korpsgruppe Gollnick der 1. Panzerarmee erfolgreich den Rückzugsweg nach Süden über den Dnjestr.
Infolge dieser Offensive die gleichzeitig mit der Proskurow-Czernowitzer Operation der 1. Ukrainischen Front durchführt wurde, konnte die deutsche 8. Armee erfolgreich von der 1. Panzerarmee getrennt werden. In der Nacht zum 28. März überquerten Teile der 2. Ukrainischen Front (40. und 27. Armee, 7. Gardearmee) den Pruth auf breiter Front. Bis zum 17. April erreichten sowjetische Truppen nach dem Sereth-Übergang die Ostkarpaten, die 40. Armee eroberte Botoșani und die 52. Armee erlangte am Pruth die Zugänge zu Jassy und Kischinew. Die Rote Armee stiess 200–250 km vor, zerschlug die 8. Armee sowie Teile der 1. Panzerarmee (10 Divisionen verloren 50–75 % ihrer Männer und fast das gesamte schwere Kriegsgerät). Nach sowjetischen Angaben fielen 62.000 Mann der Achsenmächte und weitere 18.763 wurden gefangen genommen. Die sowjetischen Truppen verloren 266.000 Mann (66.000 davon Tote, Vermisste und Gefangene).
Beresnegowatoje-Snigirjower Operation (6. bis 18. März 1944)
Die 3. Ukrainische Front unter Rodion Malinowski hatte gegen die 6. Armee und die rumänische 3. Armee der Heeresgruppe A unter Ewald von Kleist vorzugehen.
Am 6. März begann die Offensive gegen den Abschnitt des deutschen XXX. Armeekorps. Im Verband der sowjetischen 8. Garde-armee (General Tschuikow) wurde die Mechanische Kavalleriegruppe des Generalleutnant Plijew mit dem 4. Garde mechanischen Korps (100 Panzer und 23 Selbstfahrlafetten) und dem 4. Garde-Kavallerie-Korps eingeführt, welche den Hauptstoss über Nowy Bug in den Rücken der deutschen Verteidigung vortrug. Nördlich davon operierte im Verband der sowjetischen 46. Armee (Generalleutnant Glagolew) das 23. Panzerkorps (102 Panzer und 16 Selbstfahrlafetten) unter General Puschkin. Das deutsche LVII. Panzerkorps und das XXIX. Armeekorps konnte den sowjetischen Druck am Fluss Ingulez nicht lange standhalten. Sechs Tage lang konnte die 3. Gebirgsdivision im Raum Gorodowatka feindliche Angriffe abweisen. Ein Stoss der sowjetischen 46. Armee brach in die Front der 16. Panzergrenadier-Division ein. Die zur Hilfe eilende 24. Panzerdivision wurde ebenfalls nach Westen abgedrängt. Bei diesen schweren Kämpfen wurden auch die Reste der 23. Panzerdivision und 15. Infanterie-Division zerschlagen.
Bis zum 12. März erreichten sowjetische Truppen den Raum südlich von Snigirjowka und schnitten dadurch die Rückzugswege der deutschen 6. Armee nach Westen ab. Zugleich wurden die deutsche Truppen von Osten und Südosten heftig angegriffen. Etwa 13 Divisionen des deutschen XXIX., XVII., LII., IV. und XXXXIV. Armeekorps sahen sich im Raum westlich von Beresnegowatoe–Snigirjowka zwischen Ingulez und Ingul abgeschnitten. Während von Osten der sowjetische Druck durch die 8. Gardearmee, die 6. Armee und 5. Stossarmee aufrecht blieb, konnte im Westen die Kavalleriegruppe Plijew ihre Linien nicht vollständig verstärken. Generaloberst Hollidt befahl der Masse seiner 6. Armee rechtzeitig den Ausbruch nach Westen. Die Masse rettete sich hinter den Fluss Südlicher Bug in Richtung auf Nikolajew, der Grossteil der Artillerie und wichtiges Kriegsmaterial ging verloren.
Auch der rechte Flügel der 3. Ukrainischen Front hatte erfolgreich operiert. Am 12. März wurde der Bahnknotenpunkt Dolinskaja und am 16. März Bobrinez besetzt. Am 16.–18. März erreichten sowjetische Truppen die Zugänge nach Nikolajew, überquerten den Südlichen Bug und bildeten Brückenköpfe. Das 31. Garde-Schützenkorps ging westlich von Nowaja Odessa über den Fluss, das nachgezogene 27. Schützenkorps ging erst am 26. März bei Beloussowka auf das westliche Ufer. Die Rote Armee stiess auf der 200 km breiten Front bis zu 140 km vor, zerschlug acht deutsche Divisionen (diese verloren 50 % ihres Personals und fast die gesamte Technik) und erreichten günstige Positionen für die folgende Odessaer Operation.
Polesier Operation (15. März bis 5. April 1944) und Odessaer Operation (26. März bis 14. April 1944)
Die 3. Ukrainische Front unter Malinowski verfügte Ende März über 57 Schützen- und 3 Kavallerie-Divisionen, dazu mehrere Panzer- und mechanisierte Korps – zusammen etwa 470.000 Menschen, 12.678 Geschütze und Granatwerfer, 435 Panzer und Selbstfahrlafetten sowie 436 Kampfflugzeuge. Die Front sollte zusammen mit der Schwarzmeerflotte zwei deutsche Armeen der Heeresgruppe A (6. Armee und rumänische 3. Armee) zerschlagen und die Stadt Odessa zurückerobern. Die Heeresgruppe A wurde ab dem 1. April 1944 in Heeresgruppe Südukraine umbenannt, neuer Befehlshaber wurde Generaloberst Schörner.
Die 3. Ukrainische Front begann in der Nacht zum 27. März 1944, die Brückenköpfe am Fluss Südlicher Bug zu erweitern. Die mechanische Kavallerie Gruppe des General Issa Plijew (4. Garde- Kavalleriekorps und 4. Garde-mechanisches Korps) ging zunächst im Verband der 46. Armee zusammen mit dem 23. Panzerkorps im Raum nordöstlich von Odessa vor. Vom 20. bis 23. März verteidigte die deutsche 15. Infanterie-Division noch einen östlichen Bug-Brückenkopf bei Wosnessensk. Die Truppen der 57. und 37. Armee konnten den feindlichen Widerstand am rechten Ufer des Südlichen Bugs schnell überwinden und den eigenen 45 km breiten Brückenkopf bis 28. März auf 4 bis 25 km Tiefe erweitern. Darauf wurde beschlossen die Gruppe Plijew sofort bei der 57. und 37. Armee in der Nähe von Alexsandrowka zu konzentrieren und den Fluss bei Wosnessensk zu überqueren.
Gleichzeitig kämpften sich die Truppen der 6. Armee (General Schlemin), der 5. Stossarmee und der 28. Armee (Generalleutnant A. A. Gretshkin) nach Nikolajew vor. Am Abend des 28. März konnte die 61. Garde-Schützendivision (Generalmajor L. N. Lozanowitsch) und die 243. Schützen-Division (Oberst M. I. Togolew) unter schweren feindlichen Feuer den Ingul überqueren und vom Norden her in Nikolajew eindringen. Zur gleichen Zeit überquerte auch die 5. Stossarmee (General Zwetajew) mit der 130. Schützen-Division (Oberst K. V. Sychew) den Fluss Ingul und drang zusammen mit anderen Divisionen der Armee vom Osten her in die Stadt ein, vom Süden rückten auch Teile der 28. Armee vor. Im Hafen der Stadt wurde vorher zusätzlich ein 67 Mann starkes Marinekommando unter Oberleutnant K. F. Olshansky abgesetzt, welche bei der Befreiung unterstützte. Die deutsche 5. Luftwaffen-Felddivision, die 302. und 304. Infanterie-Division wurden unter schweren Verlusten am Westufer des Bug zurückgeworfen. Am 28. März war Nikolajew vollständig von den sowjetischen Truppen befreit.
Die deutsche 6. Armee und die rumänische 3. Armee zogen sich auf den Dnjestr zurück, um nicht abgeschnitten zu werden. Bei diesen Rückzugskämpfen wurde das deutsche XXIX. Armeekorps im Raum zwischen Ponjatowka und Bakalowo durch den Durchbruch der sowjetischen 37. Armee auf Rasdelnaja kurzfristig eingekesselt. Unter Führung der Gruppe Wittmann (3. Gebirgsdivision) gelang der deutschen 258., 294., 17. und 302. Infanterie-Division (General Bleyer, von Eichstädt, Brückner und von Bogen) der Ausbruch über den Kutschurgan-Abschnitt zum Dnjestr.
Am 30. März wurde Otschakow durch Landungskräfte der Schwarzmeer-Flotte und Teilen der 5. Stossarmee befreit und der sowjetische Angriff auf Odessa begann. Der Dnister-Liman wurde erreicht und die Odessaer Besatzung begann zu flüchten, um der Einkesselung zu entgehen, und wurde dabei von der Schwarzmeerflotte angegriffen. Die 8. Gardearmee unter Generaloberst Tschuikow umging Odessa von Nordwesten. Am 9. April drang die 6. Armee und 5. Stossarmee vom Norden her nach Odessa ein und befreite zusammen mit Partisanen die Stadt. Bis zum Morgen des 10. April 1944 drangen die 86. Garde-, die 248, 320. und die 416. Schützen-Division in Odessa ein. Der Rückzug der rumänischen 14. und 21. Division und der deutschen 370. Infanterie-Division erfolgte nach Akkermann und weiter zum Pruth.
Das 57. Schützenkorps (Generalmajor Ostashenko) der 37. Armee und das 82. Schützenkorps (Generalmajor Pawel G. Kusnezow) befreiten im Kampf mit dem XXXXIV. Armeekorps am 12. April Tiraspol und eroberten am 14. einen Brückenkopf am westlichen Dnjestr-Ufer.
Die Rote Armee zerschlug die deutsche 6. Armee und die rumänische 3. Armee und befreite die Oblast Nikolajew, die Oblast Odessa und besetzte grosse Teile Moldawiens.
Folgen und Verluste
Die Heeresgruppe Süd wurde wegen neuer Lokalitäten am 1. April in Heeresgruppe Nordukraine umbenannt, der Generalfeldmarschall von Manstein war bereits ab 31. März auf Weisung Hitlers durch Generaloberst Walter Model abgelöst worden. Die Rote Armee stiess auf der 1300 bis 1400 km breiten Front etwa 250 bis 450 km nach Westen vor, betrat nach dem Übergang über den Dnestr mit Rumänien zum ersten Mal ausländischen Boden und hatte mit etwa 1.110.000 Soldaten (270.000 Tote), 7.500 Geschützen, 4.700 Panzern und 700 Flugzeugen beinahe so hohe Verluste an Menschen wie in der Schlacht am Dnepr. 34 Divisionen und 4 Brigaden der Wehrmacht wurden vom Westen nach Osten verlegt. Zehn Divisionen und eine Brigade der Wehrmacht wurden vollständig vernichtet, weitere sechzig, darunter 12 Panzer- und 3 motorisierte Divisionen, verloren 50 % ihrer Personalstärke, weitere zehn Divisionen verloren 70 % und fünf wurden wegen hoher Verluste aufgelöst. Die deutschen Verluste betrugen insgesamt 500.000 Mann.