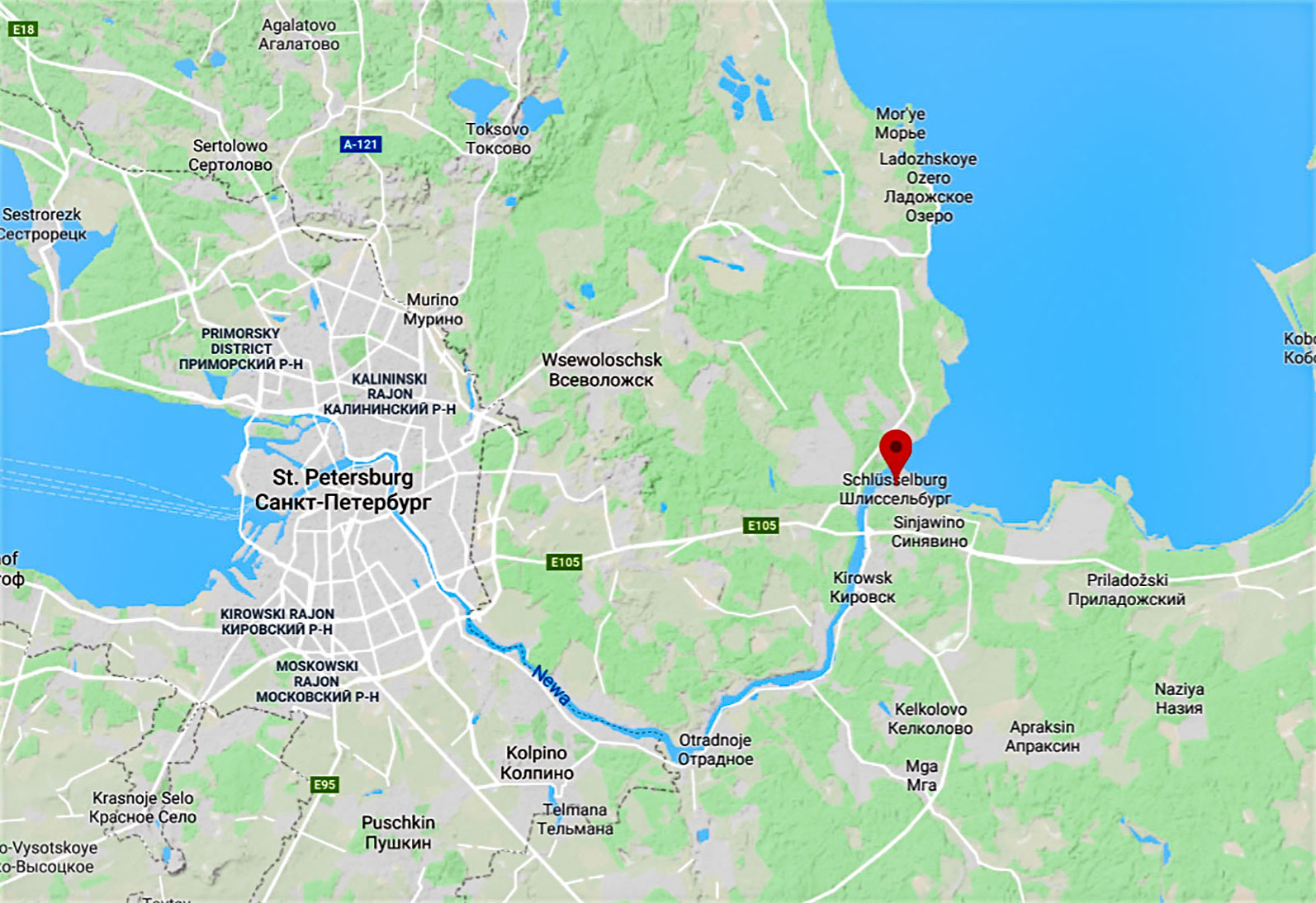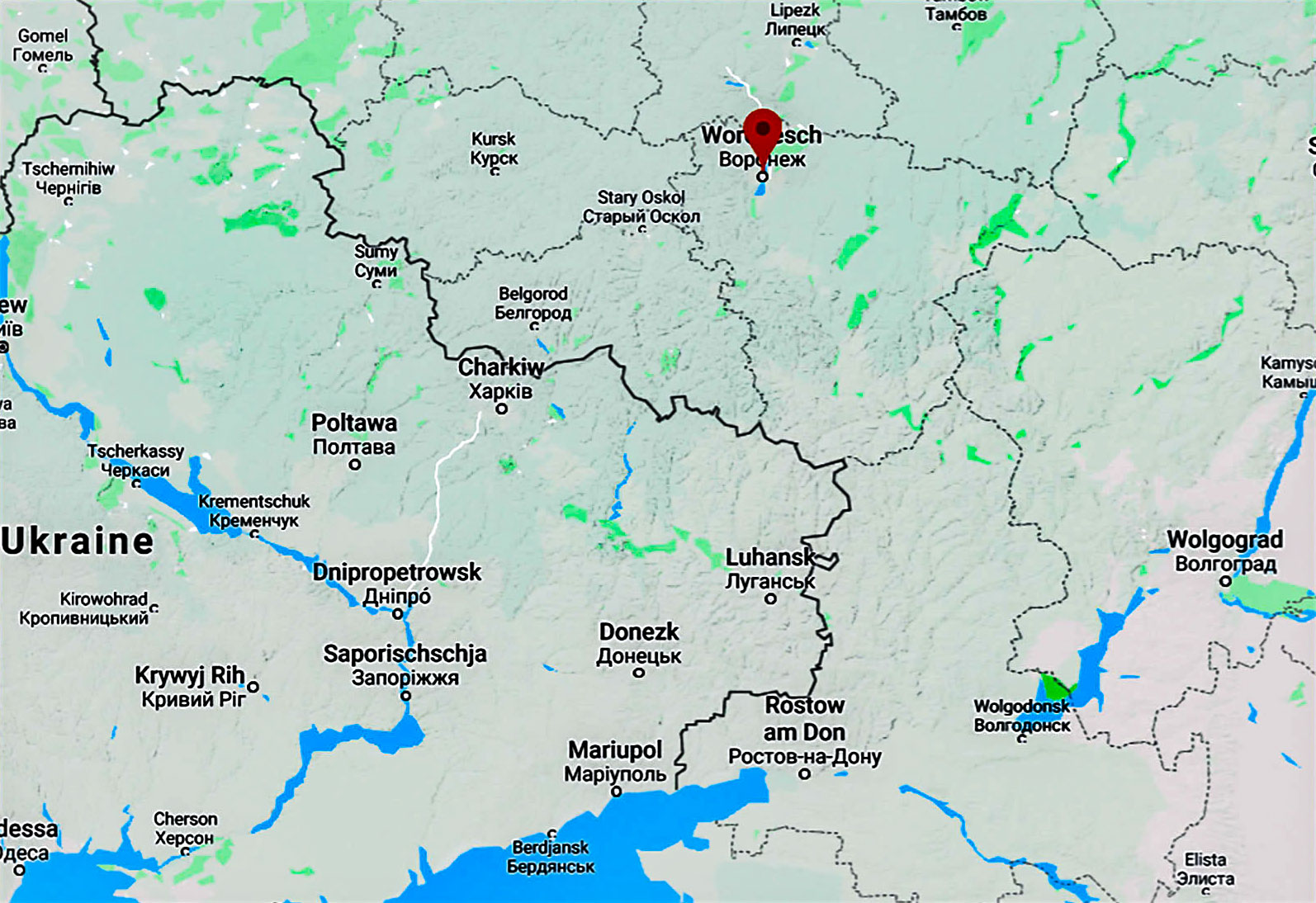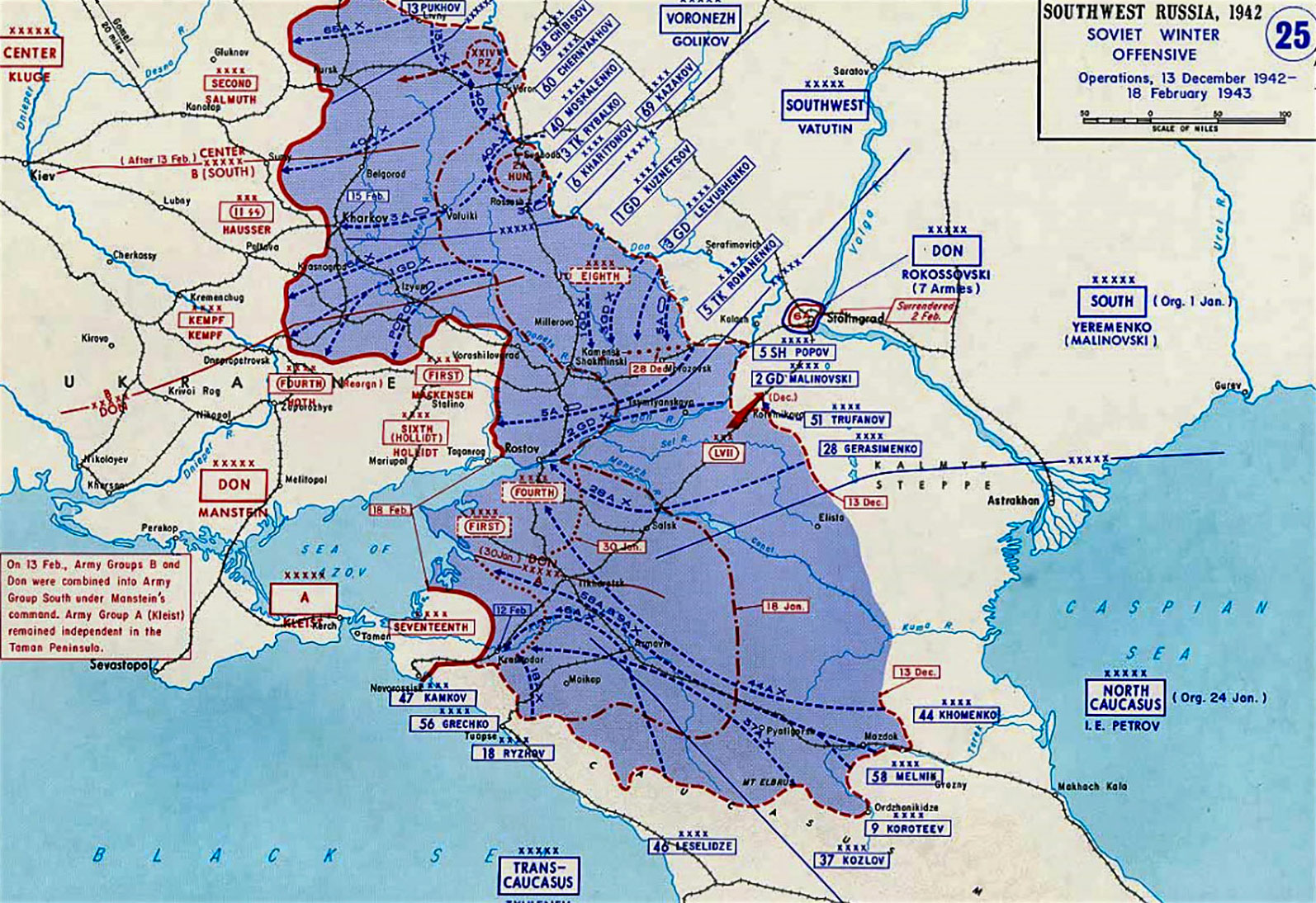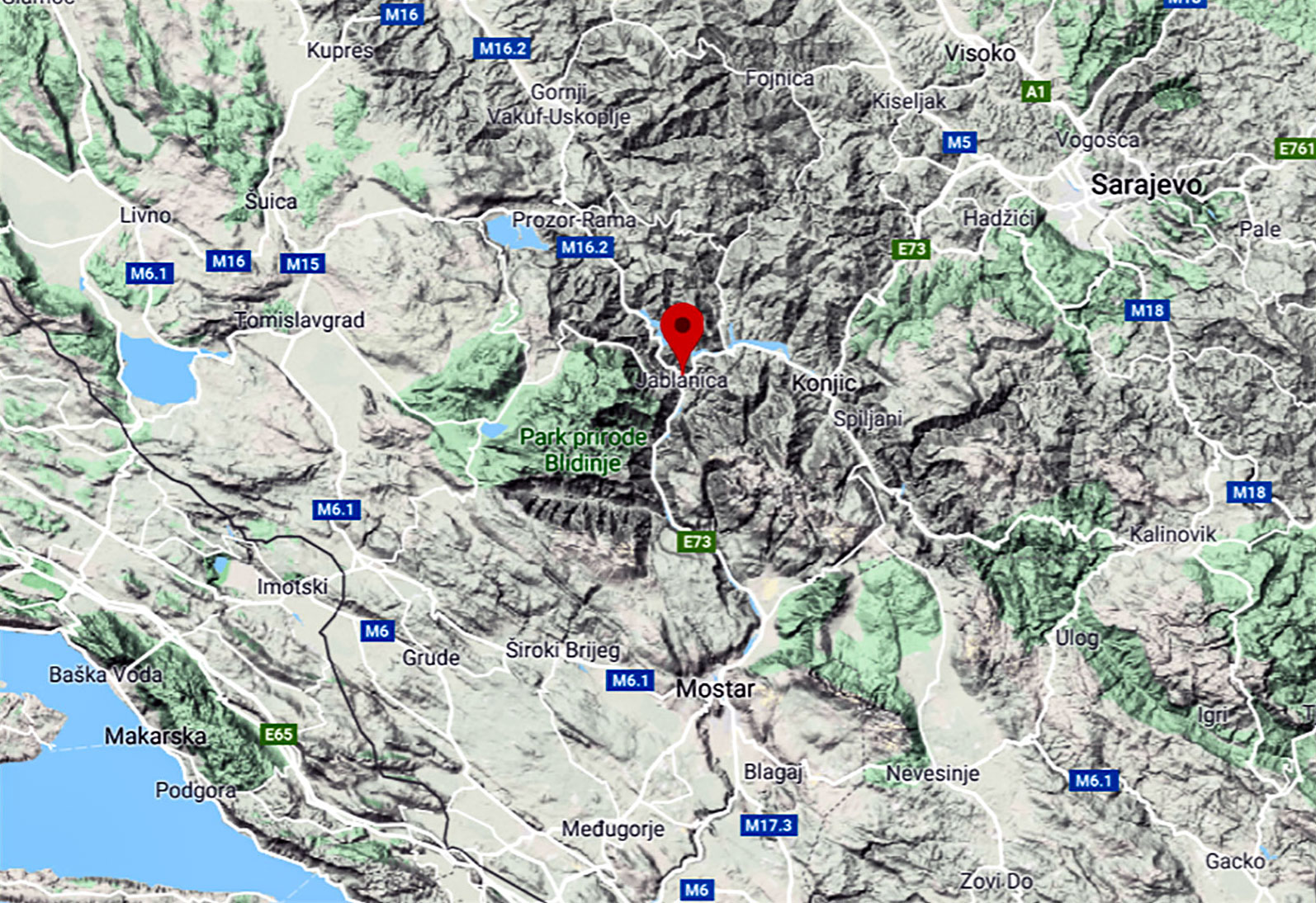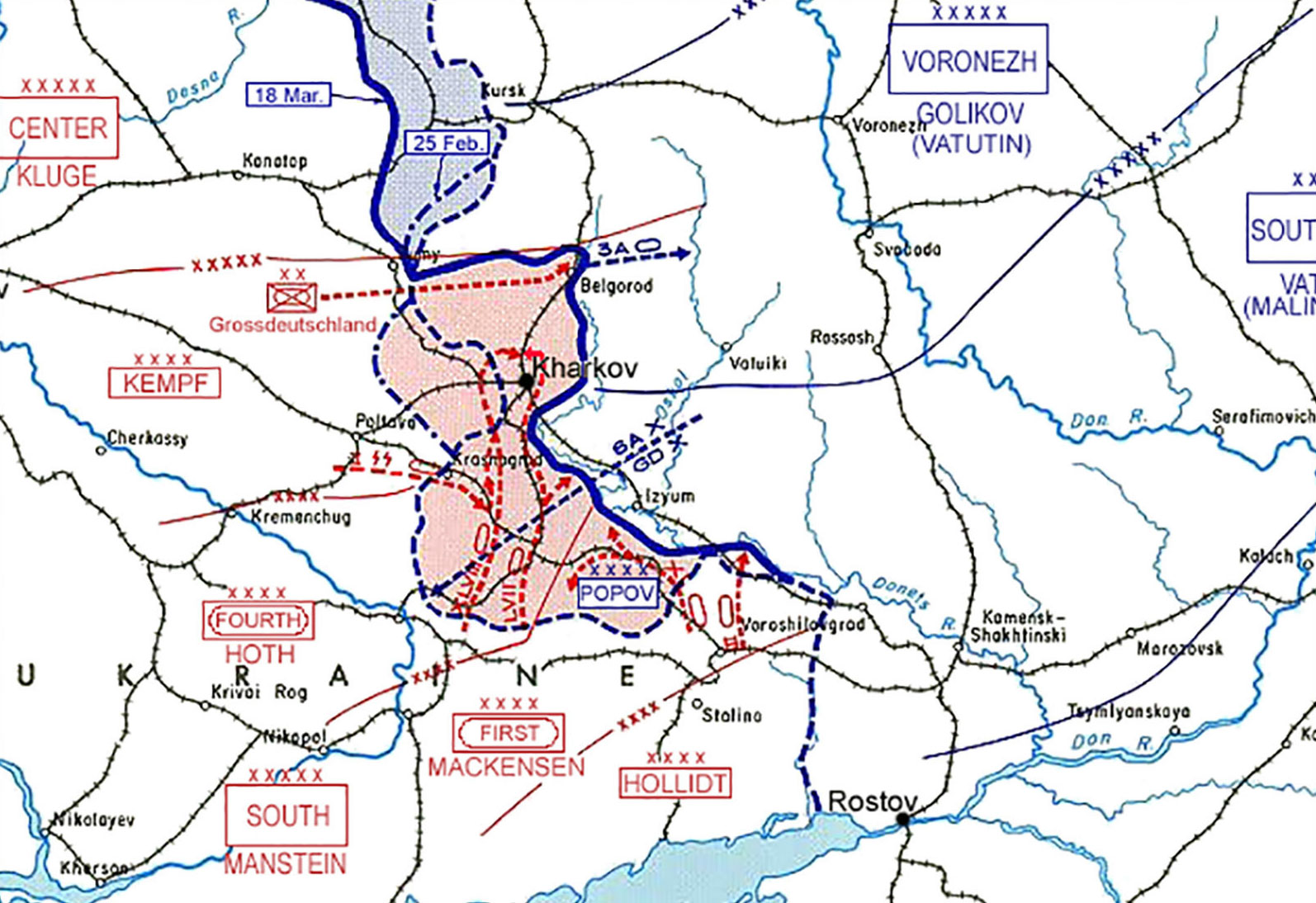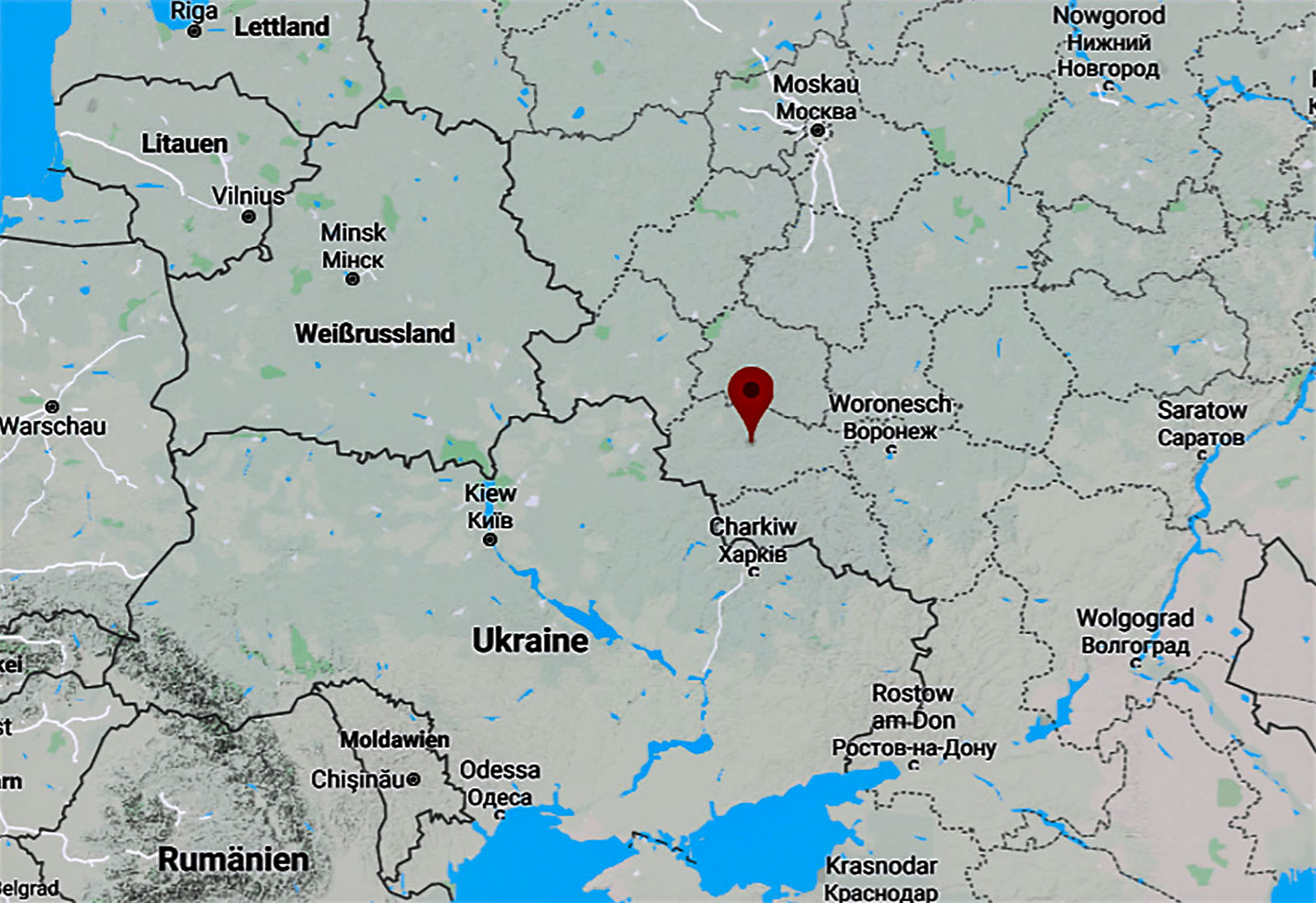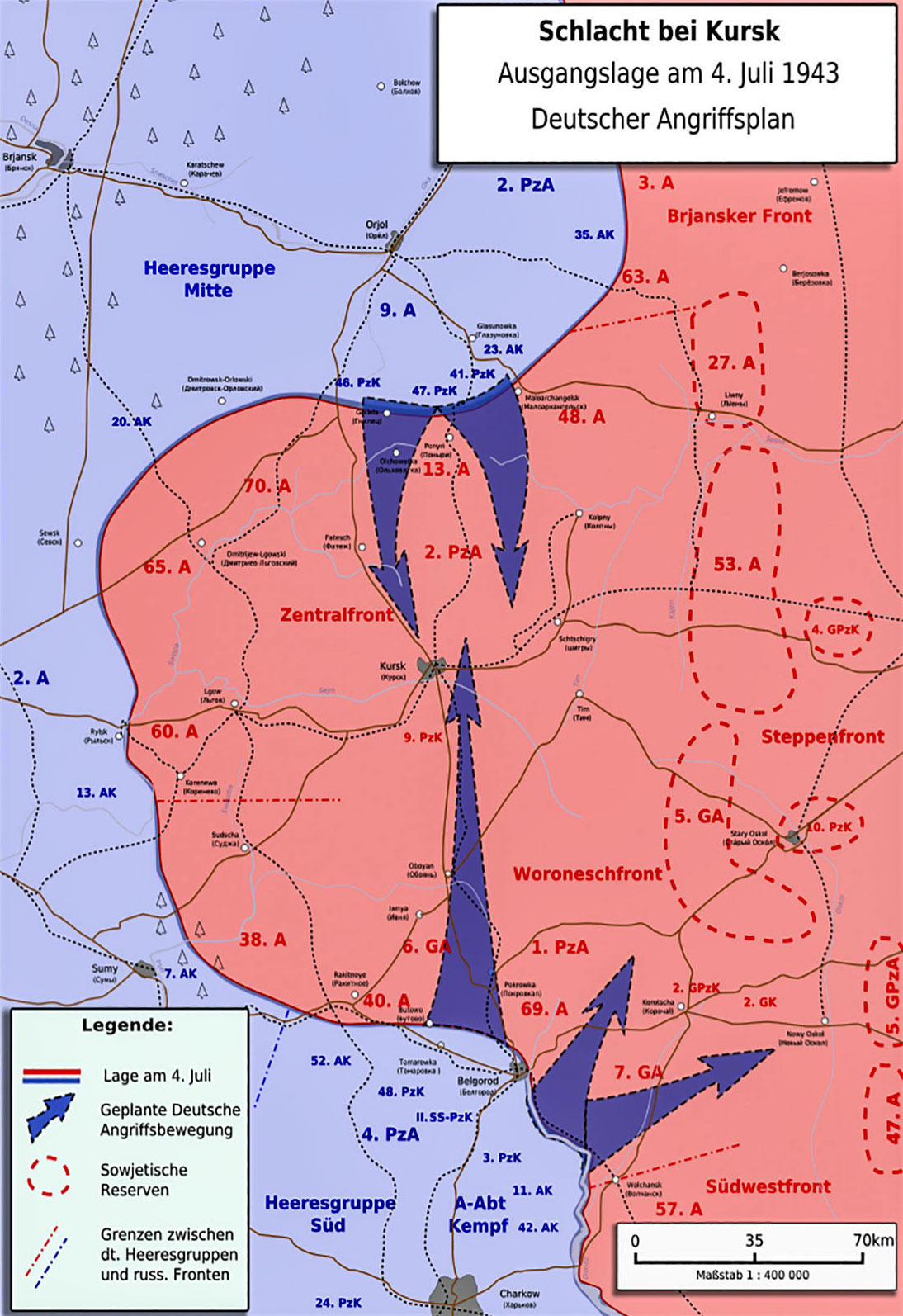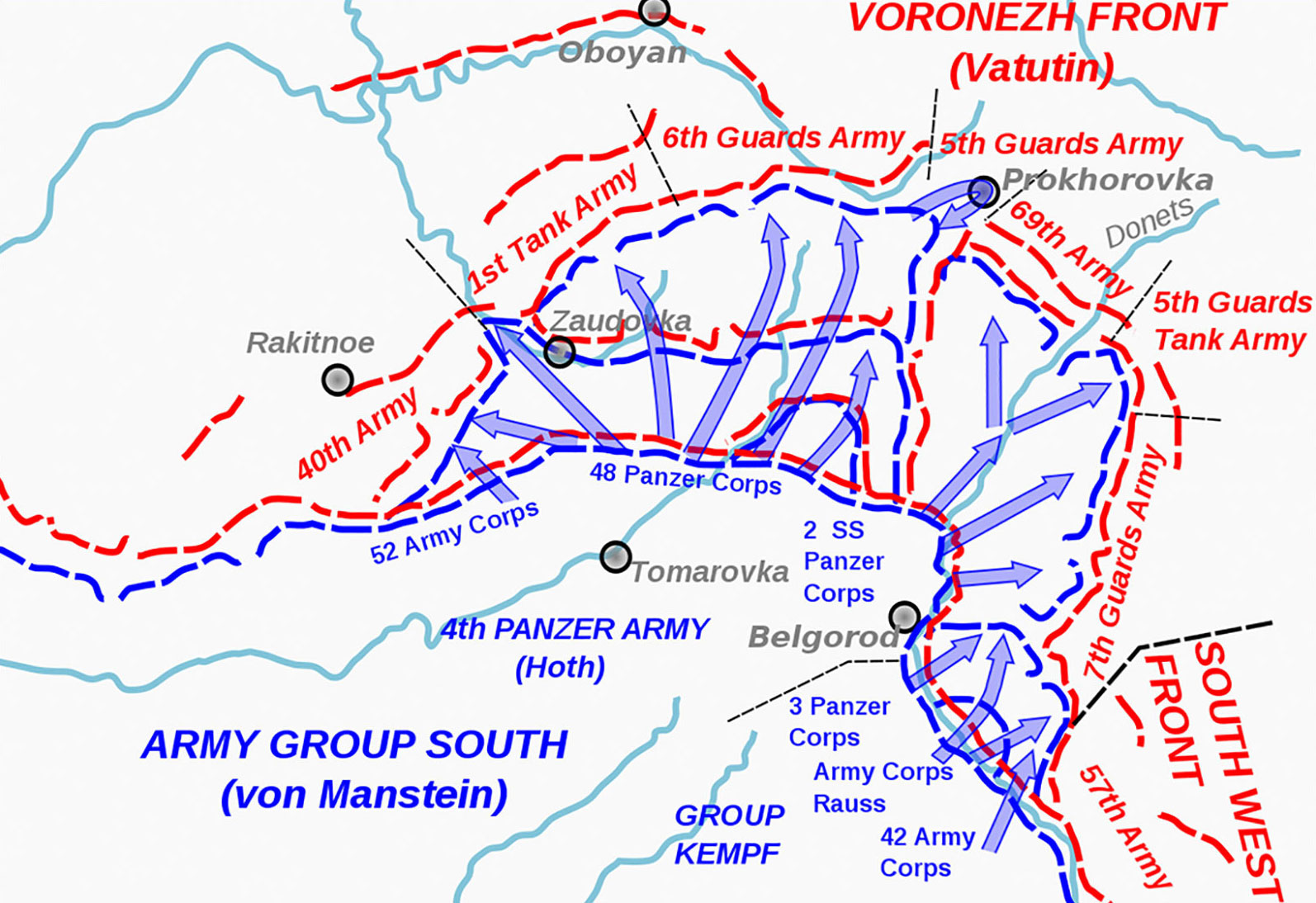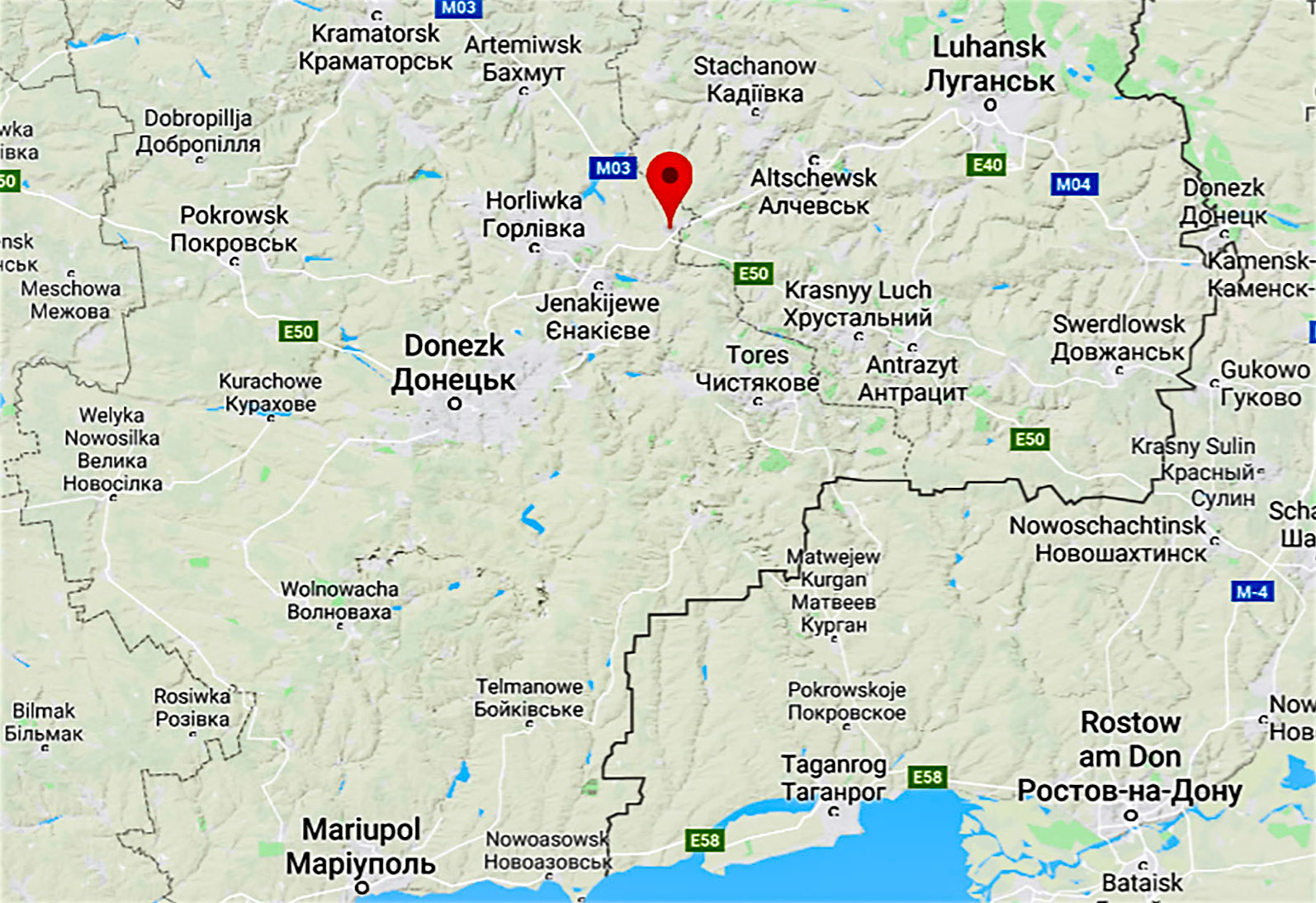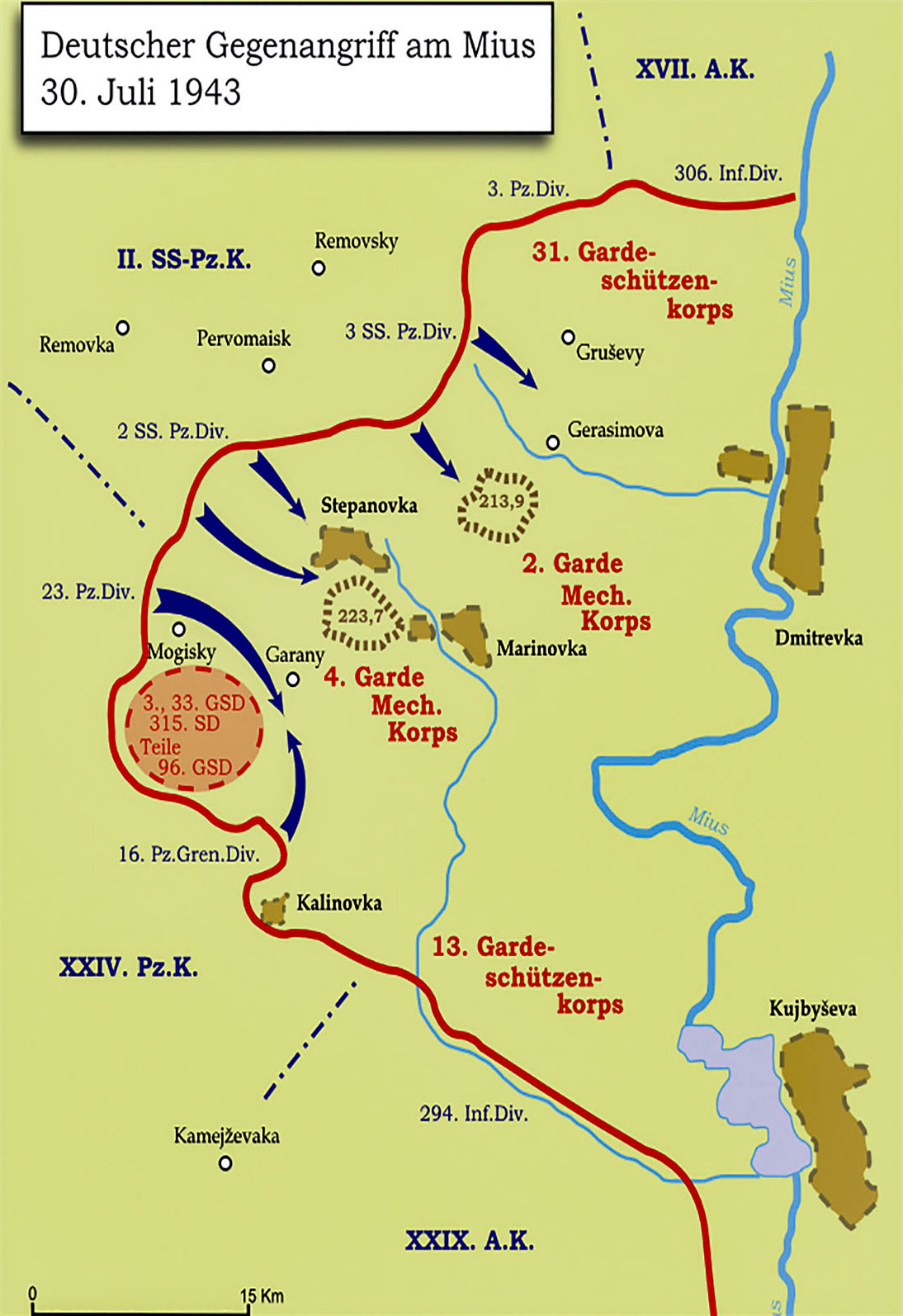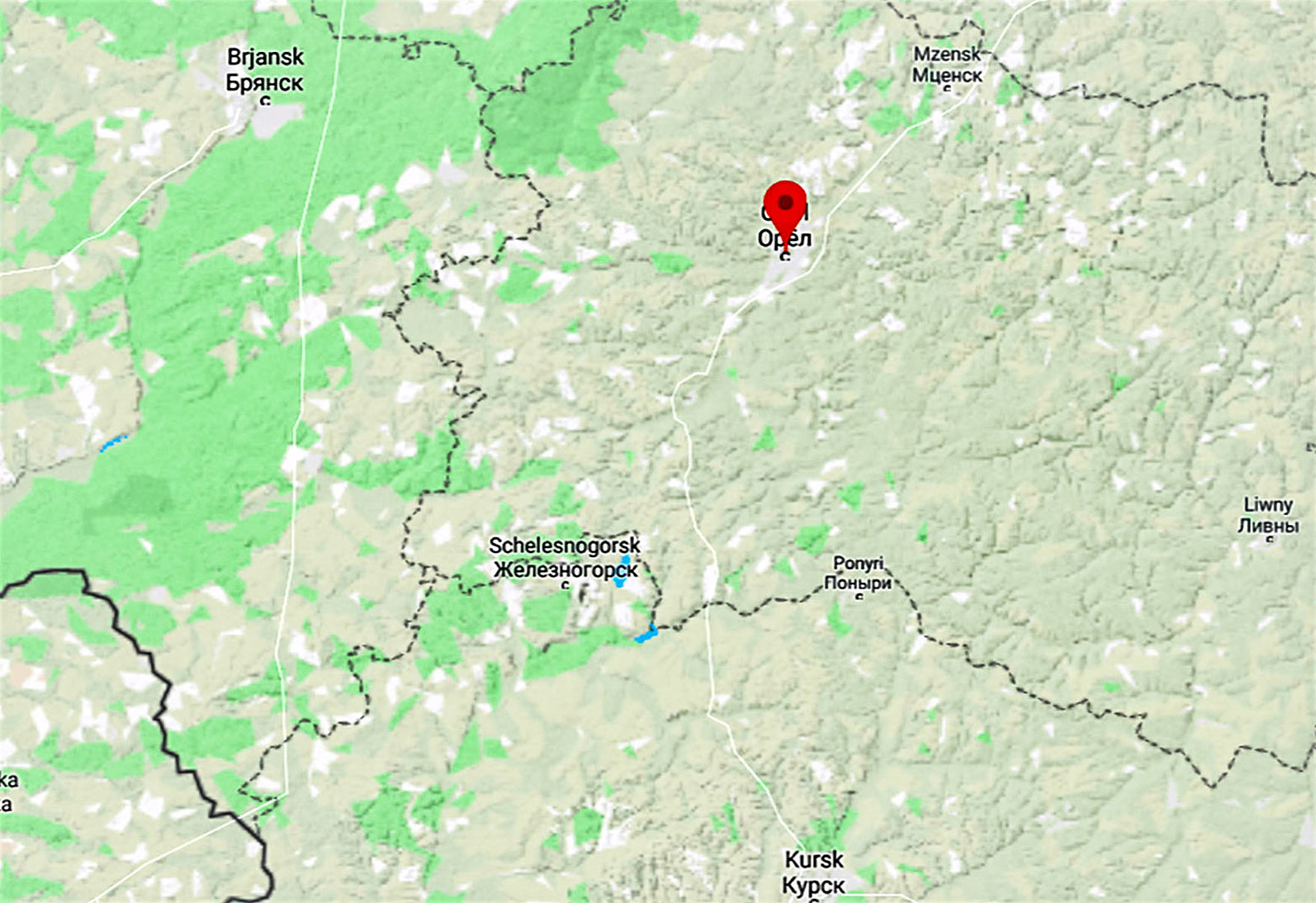Schlachten im Jahr 1943, Teil 1 bis 12.07.1943
Datenherkunft: (Wikipedia)
aus-der-zeit.site > Kriegsverlauf 1943
- Nordkaukasische Operation (01.01.1943 – 04.02.1943)
- Zweite Ladoga-Schlacht (12.01.1943 – 30.01.1943)
- Woronesch-Charkiwer Operation (13.01.1943 – 03.03.1943)
- Schlacht an der Neretva (20.01.1943 – 15.03.1943)
- Schlacht am Kasserinpass (19.02.1943 – 22.02.1943)
- Schlacht bei Charkow (19.02.1943 – 15.03.1943)
- Schlacht von Ksar Ghilane (23.02.1943 – 10.03.1943)
- Schlacht an der Sutjeska (15.05.1943 – 16.06.1943)
- Operation Corkscrew (10.06.1943)
- Unternehmen Zitadelle (05.07.1943 – 16.07.1943)
- Operation Husky (10.07.1943 – 17.08.1943)
- Donez-Mius-Offensive (17.06.1943 – 02.08.1943)
- Orjoler Operation (12.07.1943 – 18.08.1943)
Nordkaukasische Operation (01.01.1943 – 04.02.1943)
Die Nordkaukasische Operation (auch Operation Don genannt; russisch Северо-Кавказская операция) war eine Offensive der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg, die vom 1. Januar bis zum 4. Februar 1943 dauerte. Im Laufe dieser Operation wurden vier Unteroperationen durchgeführt.
Vorgeschichte
Das Unternehmen Wintergewitter zum Entsatz des Kessels von Stalingrad musste am 25. Dezember 1942 von der deutschen 4. Panzerarmee auf Grund eines sowjetischen Frontdurchbruches bei der nördlicher eingesetzten italienischen 8. Armee abgebrochen werden. Durch den Vormarsch der sowjetischen 5. Stossarmee und der 2. Gardearmee (General Malinowski) nach Rostow, drohte im Kaukasus der gesamten Heeresgruppe A die Abschneidung. Am 29. Dezember wurde eiligst der Rückzug für die deutsche 1. Panzerarmee aus dem Raum Mosdok – Naltschik – Prochladny angeordnet. Das OKW versuchte Kräfte für die Verteidigung des bedrohten Tschir-Abschnittes bzw. den Entsatz des Kessels in Stalingrad freizubekommen. Die in der Kalmückensteppe operierende sowjetische 28. Armee (General W. F. Gerassimenko) hatte der deutschen 16. Infanterie-Division (mot.) am 31. Dezember Elista entrissen, wurde am folgenden Tag der Südfront unterstellt und eröffnete mit der nördlicher vorgehenden 51. Armee (General Trufanow) den Vormarsch zum Manytsch.
Truppenstärke
Zwei sowjetische Fronten, die Südfront unter Andrei Jerjomenko (ab 2. Februar unter Rodion Malinowski) und die Transkaukasusfront unter Iwan Tjulenew, mit einer Gesamtstärke von 1.000.000 Soldaten, 11.341 Geschützen, 1.278 Panzern und 900 Flugzeugen, sollten den Südflügel der (Heeresgruppe Don (GFM von Manstein) und die gesamte Heeresgruppe A unter Ewald von Kleist) mit zusammen etwa 764.000 Soldaten, 5.290 Geschützen, 700 Panzern und 530 Flugzeugen (insgesamt 43 Divisionen) zwischen zwei Flüssen (Kuban und Manytsch) einschliessen und vernichten.
Verlauf
Am 1. Januar 1943 wurde der sowjetische Angriff durch die sowjetische 9. und 37. Armee (General P. Koslow) am Terek-Abschnitt eröffnet, am 4. Januar wurde Naltschik durch das 2. Schützenkorps (Generalmajor Fedor Sacharow) befreit. Am 3. Januar hatte die sowjetische 44. Armee unter General Chomenko die Verfolgung des bereits zurückgehenden deutschen XXXX. Panzerkorps in Richtung auf Stawropol aufgenommen. Für den Durchbruch der 44. Armee wurden im zweiten Treffen die Panzergruppe des Generalmajor G.P. Lobanow gebildet, sie umfasste 106 Panzer und 24 Selbstfahrlafetten, bestehend aus der 2., 15. und 63. Panzer-Brigade sowie dem 225. Panzerregiment.
Eine weitere Panzerabteilung, im Rahmen der 9. Armee eingesetzt war, wurde durch Oberstleutnant W. I. Filippow befehligt und umfasste 123 Panzer, sie wurde aus der 52., 140. und 207. Panzer-Brigade gebildet. Die Städte Malgobek und Mosdok wurden am 3. Januar durch die vorgezogene sowjetische 58. Armee (General Melinjow) besetzt. Am 7. Januar wurde das sowjetischen 4. und 5. Garde-Kavalleriekorps mit der Panzergruppe des Oberstleutnant Filippow vereinigt und zur mechanischen Kavalleriegruppe unter Generalleutnant Kiritschenko zusammengefasst. Vom 8. bis 10. Januar tobten heftige Kämpfe an den Flüssen Kuma und Solka, am 11. Januar befreite die 37. Armee Pjatigorsk. Das 11. Schützenkorps (Generalmajor Rubanjuk) der sowjetischen 9. Armee besetzte am 12. Januar Mineralnyje Wody.
Die Kräfte der sowjetischen Schwarzmeer Gruppe (18., 46., 56. und 56. Armee sowie 5. Luftarmee) begannen am 11. Januar im Raum nordöstlich von Tuapse gegenüber der zurückgehenden deutschen 17. Armee den Vormarsch durch den Waldkaukasus. Mitte Januar erreichte die sowjetische 51. Armee im Norden die Don-Schleife, die 28. Armee den Manytsch-Kanal und bedrohten damit die Rückzugswege nach Rostow. Währenddessen wurden im Süden die Städte Prochladny, Georgijewsk, Jessentuki und Kislowodsk befreit. Am 21. Januar nahm die sowjetische 44. Armee gemeinsam mit Partisanen Woroschilowsk (Stawropol) ein. Bis zum 24. Januar wurden die deutschen Truppen auf die Linie Siwerskyj Donez – Salsk – Belaja Glina – Armawir – Labinskaja zurückgeworfen.
Am 28. Januar nahmen Truppen der sowjetischen 9. Armee Kropotkin ein, die 58. Armee besetzte am 30. Januar Tichorezk und erreichte die südlichen Zugänge zu Rostow und zum Asowschen Meer. Währenddessen erreichte die im Nordkaukasus vorgehende Südfront die östlichen Zugänge zu Schachty, Nowotscherkassk und Rostow. Die 46. Armee der Schwarzmeergruppe befreite am 29. Januar Maikop und erreichte bis 4. Februar den Fluss Kuban.
Die Masse der deutschen 1. Panzerarmee (III. und XXXX. Panzerkorps) hatte rechtzeitig den Rückzug über Rostow erreicht, das bisher unterstellte LII. Armeekorps verblieb weiterhin im Kaukasus. Die 17. Armee hatte sich auf Befehl Hitlers mit dem V., XXXXIV. und dem XXXXIX. Korps auf der Taman-Halbinsel zu halten, um nach Wiedererlangung der strategischen Wende erneut den Vormarsch zu den Erdölfeldern von Grosny antreten zu können. Der Oberbefehlshaber Generaloberst Ruoff organisierte dafür eine starke Auffangstellung am Unterlauf des Flusses Kuban, wo neue Angriffe der sowjetischen Nordkaukasusfront abgeschlagen werden konnten.
Folgen
Die Rote Armee rückte auf der 840 km breiten Front 300–600 km vor und befreite Tschetscheno-Inguschetien, Nordossetien-Alanien, Kabardino-Balkarien, die Region Stawropol, Teile der Oblast Rostow und der Region Krasnodar. Dabei verlor sie ungefähr 155.000 Soldaten (davon 70.000 Tote).
Obwohl es der Wehrmacht gelang, der Einkesselung und Zerschlagung zu entgehen, hatte diese Operation grosse militärpolitische Bedeutung. Der sowjetischen 56. Armee unter General Gretschko gelang am 12. Februar noch die Befreiung von Krasnodar. Die deutsche 17. Armee konnte dann die neuen Stellungen während der Kämpfe im Kubanbrückenkopf behaupten und wurde im Oktober 1943 beim „Unternehmen Brunhild“ über die Halbinsel Kertsch auf die Krim zurückgezogen. Die deutschen Pläne zur Eroberung des Kaukasus mussten endgültig aufgegeben werden.
Zweite Ladoga-Schlacht (12.01.1943 – 30.01.1943)
Die Zweite Ladoga-Schlacht (auch Operation Iskra, russisch Операция „Искра“ – deutsch „Funke“) war ein von Marschall Schukow geplantes militärisches Unternehmen der Leningrader (heute St. Petersburg) und der Wolchow-Front der Roten Armee vom 12. bis zum 30. Januar 1943 mit dem Ziel, die Blockade Leningrads aufzuheben.
Vorgeschichte
Nach dem Ende des deutschen Vormarsches Ende 1941 war es den sowjetischen Truppen in der Schlacht am Wolchow Anfang 1942 und in der Ersten Ladoga-Schlacht (August – Oktober 1942) nicht gelungen, die Leningrader Blockade zu beenden.
Den sowjetischen Fronten unter der Führung der Generäle Leonid Goworow und Kirill Merezkow standen 21 Divisionen mit 302.800 Mann für das Unternehmen zur Verfügung. In schweren Kämpfen gegen die deutsche 18. Armee gelang es, den Belagerungsring zu durchbrechen und einen schmalen Korridor am Südufer des Ladogasees zu öffnen.
Am 12. Januar wurde der Angriff durch die 67. Armee unter General M. P. Duchanow aus dem Westen und Truppen der 2. Stossarmee unter General W.S. Romanowski aus dem Osten eröffnet. Am ersten Tag konnte am linken Ufer der Newa bei Marjino im Abschnitt der deutschen 170. Infanterie-Division ein kleiner Brückenkopf erkämpft werden. Im Osten südlich des Dorfes Lipa und beidseitig von Gaitolowo gelangen der sowjetischen 128. und 256. Schützendivision am ersten Angriffstag grössere Fronteinbrüche bei der deutschen 1. und 227. Infanterie-Division. Der Oberbefehlshaber der 18. Armee, General Lindemann verstärkte das angegriffene XXVI. Armeekorps (General von Leyser) sofort mit der 96. Infanterie-Division, welche aus dem Abschnitt des südlicher stehenden XXVIII. Armeekorps abgezogen worden war.
Bis zum 18. Januar wurde die Stadt Schlüsselburg von der Roten Armee zurückerobert. Am gleichen Tag trafen Einheiten der 18. (vom Osten) und der 136. Schützendivision (vom Westen) um 9:30 Uhr beim Arbeitslager Nr. 1 (auf der nebenstehenden Karte WS No1) aufeinander und durchbrachen damit die Leningrader Blockade. Auch das Arbeitslager Nr. 5 wurde besetzt. Die im Norden abgeschnittene deutsche 61. Infanterie-Division liess ihre schwere Ausrüstung zurück und brach unter Generalleutnant Hühner nach Sinjawino durch. Bis zum 21. Januar versuchte die Rote Armee im Süden weiter in Richtung Sinjawino vorzustossen, konnte aber nur das Arbeitslager Nr. 6 unmittelbar westlich der Siedlung erobern. Danach gab es keine Frontverschiebungen mehr, die Operation endete am 30. Januar.
Folgen
An der Südküste des Ladoga-See war durch die Sowjets ein 8 bis 11 Kilometer breiter Korridor freigekämpft, über den die direkte Landverbindung zu Leningrad wiederhergestellt werden konnte. Bereits am 22. Januar begann die sowjetische Seite mit der Wiederherstellung der Bahnlinie nach Leningrad.
Leningrad konnte ab dem 6. Februar wieder mit der Eisenbahn versorgt werden, das verbesserte die Versorgungslage in der Stadt enorm. Der schmale Korridor lag jedoch weiterhin in der Reichweite deutscher Artillerie, die auf den Sinjawino-Höhen ausgezeichnete Schusspositionen bezogen hatte. Im Rahmen der Operation Polarstern (10. Februar – 1. April 1943) und in der Dritten Ladoga-Schlacht (22. Juli – 25. September 1943) versuchte die Rote Armee erfolglos, die Blockade endgültig zu sprengen. Dies gelang erst in der Leningrad-Nowgoroder Operation von Januar bis März 1944.
Die sowjetischen Verluste während der Operation werden mit 115.082 Mann (davon 33.940 Gefallene und Vermisste) angegeben. Einige im Verlauf der Operation erbeutete Panzer des Typs Tiger dienten dem sowjetischen Verteidigungsministerium zur Entwicklung einer wirksameren Abwehrtaktik gegen deutsche Panzer.
Woronesch-Charkiwer Operation (13.01.1943 – 03.03.1943)
Die Woronesch-Charkower Operation (russisch Воронежско-Харьковская операция) war eine Angriffsoperation der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg gegen die seit dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges (Juni 1941) im Land stehenden deutschen Truppen. Im Laufe der sowjetischen Offensive, die vom 13. Januar bis zum 3. März 1943 dauerte, wurden drei Unteroperationen durchgeführt, welche die Wiedereinnahme von Woronesch und Kursk und eine kurzfristige Befreiung von Charkow brachte.
Vorgeschichte
Im Winter 1942/43 startete die Rote Armee am südlichen Teil der Ostfront im Zuge der Kesselschlacht um Stalingrad, im Nordkaukasus und am Don–Abschnitt stärkere Offensiven. Die Front der deutschen Heeresgruppe Don unter Generalfeldmarschall von Manstein wurde im Januar 1943 mehrfach von Truppen der sowjetischen Südfront durchbrochen, gleichzeitig wurde die deutsche 6. Armee in Stalingrad von Truppen Rokossowskis immer enger umschlossen. Ende Dezember besiegten die Truppen der Südwestfront im Rahmen der Operation am mittleren Don die italienische 8. Armee und erreichten die Linie Nowaja Kalitwa – Markowka – Woloschino – Tschernikowskij.
Die Stawka plante im Zuge dieser Erfolge eine grosse strategische Operation, welche als Ziel die Abschneidung aller deutschen Kräfte im Kaukasus beinhaltete, dafür sollte die 3. Panzerarmee in Richtung auf Pawlograd und die 5. Panzerarmee der Südfront auf Rostow am Don zum Meer durchbrechen. Gleichzeitig wurde die Woronesch-Front (Generalleutnant Golikow) im Zusammenwirken mit dem linken Flügel der Brjansker Front mit einer starken Offensive in Richtung auf Woronesch und Kursk beauftragt, welche sich die Wiedereinnahme von Charkow als Ziel setzte.
Verlauf
Auf dem 260 km breiten Abschnitt der Woronesch-Front wurden von General Golikow drei Hauptstossgruppen geschaffen – Am nördlichen Frontabschnitt wurde die 13. Armee der Brjansker Front am Angriff beteiligt. Am mittleren Don zwischen Woronesch und Pawlowsk wurde die 38., 60. und 40. Armee (Generalleutnant K. S. Moskalenko) angesetzt. In der Mitte hatte die 3. Panzer-armee (ab 19. Januar unter Generalleutnant Rybalko) unterstützt vom 18 separaten Schützenkorps (Generalmajor P. Sykow), von Teilen der 40. Armee und dem 7. Kavalleriekorps (General Sokolow) den Durchbruch zum Fluss Oskol zu erreichen und für eine Umfassungsoperation über Rossoch nach Norden einzudrehen. Im Süden begleitete die 6. Armee (Generalleutnant F. M. Charitonow) der Südwestfront den Angriff in Richtung auf Kantemirowka.
Beteiligte Truppenteile
Die von der Offensive betroffene deutsche Heeresgruppe B unter Generalfeldmarschall von Weichs umfasste Anfang Januar 1943 ohne die Armeeabteilung Fretter-Pico etwa 30 Divisionen:
- Ungarische 2. Armee – Generaloberst Gusztáv Jány
- Italienische 8. Armee – Armeegeneral Italo Gariboldi
- Reste ital. XXXV. Korps (Divisionen: Pasubio, Torino, Cosseria)
- Deutsche 19. Panzer- und 298. Infanterie-Division
- Panzerkorps (27. Panzer-Division und 385., 387. Infanterie- und 213. Sicherungs-Division)
- Alpinikorps (Mit den Divisionen: Cuneense, Vicenca und Tridentina)
Operation Ostrogoschsk-Rossosch (13. bis 27. Januar)
Am 13. Januar 1943 ging die 40. Armee aus den Don-Brückenköpfen bei Storoschewoje zum Angriff über. Die ungarischen Truppen konnten die Front noch 24 Stunden halten, ehe sie zurückweichen mussten. Am 14. Januar traten die sowjetischen Truppen auch aus dem Brückenkopf Schtschutschje zum Angriff aufs ungarische VII. Armeekorps an. Am Abend des 14. Januar drangen die sowjetischen Panzer 12–23 km weiter vorwärts, bei Shilin wurde das Hauptquartier des deutschen XXIV. Panzerkorps überrannt. Am Morgen des 15. Januar wurde die Offensive auch gegen Norden und Nordwesten erweitert und auch das am linken Flügel stehende ungarische III. Armeekorps angegriffen.
Am gleichen Tag wurde das selbständige 18. Schützenkorps in die Offensive eingeführt, unterstützt durch Artilleriefeuer und Luftangriffe brach der deutsche Widerstand im Raum Korotojak am Abend des 15. Januar in einer nächtlichen Schlacht bei – 25 Grad zusammen. Vom Süden her, aus dem Raum Kantemirowka trat die 3. Panzerarmee unter Pawel Rybalko zur Umfassung an. Das 12. Panzerkorps (Generalmajor Mitrofanow) drängte am Morgen des 16. Januar mit der Vorhut der 106. Panzerbrigade in Rossosch ein. Nach dem Durchbruch bei Nowaja Kalitwa, befreiten Rybalkos Truppen im Rücken der überrollten feindlichen Einheiten im Zusammenwirken mit Teilen der 40. Armee am 19. Januar Alexejewka. Das 7. Kavalleriekorps besetzte am 19. Januar Waluiki und beschlagnahmte grosse Lager mit Kriegsmaterial. Für die erfolgreichen Kämpfe vom 15. bis 19. Januar wurde das 7. Kavalleriekorps (Generalmajor General S. Sokolow) in 6. Garde-Kavallerie-Korps umbenannt. Der Rückzugsbefehl für die ungarische 2. Armee kam am 17. Januar zu spät, grosse Truppenteile wurden eingekesselt, darunter 70.000 Ungarn und Italiener sowie etwa 10.000 Deutsche. Die eingekesselten Truppenteile versuchten nach Westen zum Oskol auszubrechen. Am 22. Januar wurde die ungarische 2. Armee aufgelöst, die restlichen Truppen wurden dem deutschen Generalkommando z. b. V. Cramer unterstellt. Nur das ungarische III. Armeekorps unter FML Stomm hielt am Nordflügel bis zum 26. Januar seine Stellungen am Don und sicherte damit die Südflanke des deutschen VII. Armeekorps unter General Siebert. Bei strengem Frost folgten verlustreiche Durchbruchskämpfe bei Postojalij, Warwarowka und Scheljakino, bei Waluiki musste dann die Masse des Alpinikorps kapitulieren. Die ungarische 2. Armee und das Alpinikorps der italienische 8. Armee wurden in der Operation Ostrogoschsk-Rossosch fast vollständig vernichtet.
Woronesch-Kastornoje-Operation (24. Januar bis 17. Februar)
Die sowjetische 40. Armee nahm die neue Stossrichtung nach Nordwest auf Stary Oskol ein, die 60. Armee unter General Tschernjachowski wurde frontal gegen Woronesch angesetzt, das am 25. Januar befreit wurde. Vom Norden her, aus dem Raum Liwny drang die sowjetische 13. Armee (General Puchow) nach Westen vor und drängte das deutsche LV. Armeekorps über den Tim-Abschnitt zurück, während gleichzeitig die 38. Armee (General Tschibisow) südwärts stossend, die Front des deutschen XIII. Armeekorps durchbrach.
Am 24. Januar erfolgte die Vereinigung mit dem vom Süden kommenden 4. Panzerkorps (General Krawtschenko) der 40. Armee. Der gesamte Südflügel der deutschen 2. Armee wurde im Raum Kastornoje abgeschnitten. Die Einschliessung der im Raum südwestlich Kastornoje eingeschlossenen Truppen wurde durch die Masse der sowjetischen 38. Armee durchgeführt. Die Sowjets hatten dafür etwa 27.500 Soldaten eingesetzt, im Kessel befanden sich Anfang Februar etwa 35.000 Soldaten, welche den folgenden Ausbruch in drei Gruppen über Bykowa und Swatowo nach Südwesten auf Stary Oskol führten. Die deutsche 2. Armee verlor in der Woronesch-Kastornoje-Operation bis 15. Februar 6.476 Tote, 14.129 Verwundete, 4.568 Mann durch Erfrierung und 13.225 Vermisste dazu den Grossteil des Kriegsmaterials.
Die sowjetische 60. Armee überwand infolge den Tim-Abschnitt und besetzte am 4. Februar die Kleinstadt Tim. Die sowjetische 13. Armee riss durch ihren Durchbruch südlich von Maloarchangelsk eine 50 km breite Frontlücke auf und schnitt die Bahnlinie zwischen Kursk und Orel ab. Die deutsche 45. Infanterie-Division wurde nördlich des Flusses Sosna zurückgedrängt, das nach Norden abgedrängt LV. Armeekorps wurde am 4. Februar der 2. Panzerarmee der Heeresgruppe Mitte unterstellt. Gleichzeitig musste die zum Schutz von Kursk eingesetzte 4. Panzerdivision Schtschigry aufgeben und zum Sejm-Abschnitt zurückgehen. Einheiten der sowjetischen 60. Armee befreite am 8. Februar die wichtige Bezirksstadt Kursk.
Charkower Angriffsoperation (2. bis 15. Februar)
Am 2. Februar leitete die Woronescher Front gegenüber der neu etablierten deutschen Armeeabteilung Lanz den weiteren Angriff auf Charkow ein. Die sowjetische 40. Armee (Generalleutnant Moskalenko), die neu aufgestellte 69. Armee (Generalleutnant Kasakow) und die 3. Panzerarmee (Generalleutnant Rybalko) griffen in Richtung Charkow an. Dabei sollte die 40. Armee die Stadt nördlich umgehen und die 69. Armee Charkow über Woltschansk direkt angreifen, während die 3. Panzerarmee die Stadt südlich umgehen sollte. Am Südflügel sicherte bei Kupjansk die deutsche 298. Infanterie-Division, weiter rechts bis nach Isjum am Fluss Donez die 320. Infanterie-Division (General Postel) gegenüber dem Vorgehen des 15. Schützenkorps (Generalmajor Athanasi S. Grjaznow) der sowjetischen 6. Armee. Am 5. Februar fiel Isjum in die Hände der sowjetischen 6. Armee, die am nördlichen Donezufer abgeschnittene 320. Infanterie-Division erkämpfte den Ausbruch in Richtung auf Balakleja und erreichte am 12. Februar nach dem Donez-Übergang bei Smijow den Anschluss an die zurückgegangene deutsche Front.
Am 3. Februar ging am Mittelsabschnitt Kupjansk verloren, das sowjetische 3., 12. und 15. Panzerkorps der 3. Panzerarmee riss die deutsche Verteidigung auf 35 Kilometer Breite zwischen Woltschansk und Isjum auf und überschritt den Donez-Abschnitt. Am 4. Februar erreichte die 3. Panzerarmee bei Tschugajew den Donez, konnte jedoch gegen die am gegenüberliegenden Flussufer liegende SS-Panzergrenadier-Division „Leibstandarte SS Adolf Hitler“ nicht über den gefrorenen Fluss vordringen. Ein Entlastungsangriff nördlich gegen Belj Kolodez scheiterte vor Prikolodnoje, als das 15. Panzerkorps auf Verteidigungsstellungen der SS-Panzergrenadier-Division „Das Reich“ stiess. Die Division Grossdeutschland gab am 6. Februar im Kampf mit dem selbstständigen 18. Schützenkorps Woltschansk auf, die 40. Armee besetzte am 7. Februar Korotscha. Am 9. Februar befreite die 40. und 69. Armee im Kampf mit dem deutschen Korps Cramer (Division Grossdeutschland, 26., Teile 88. und 168. Infanterie-Division) Belgorod und formte einen Brückenkopf über den Donez. Südlich davon hatte das 6. Gardekavalleriekorps über Andejewka den Feind umgangen und stiess auf Merefa vor. Am 14. Februar gelang es dem 12. und 15. Panzerkorps sowie der 160. Schützen- und der 48. Garde-Schützendivision der 3. Panzerarmee, in die östlichen Vororte der Stadt einzudringen. Das II. SS-Korps unter General Hausser und die 6. Panzer-Division des Korps Raus mussten Charkow am 15. Februar vor dem überlegenen sowjetischen Druck aufgeben. Von Norden und Nordwesten drang das 5. Garde-Panzerkorps (Generalmajor Krawtschenko), die 340., 25. Garde-, 183., 309., und 100. Schützendivision der Generale S. S. Martirosjan, P. M. Schafarenko, A. S. Kostitsyn, M. I. Menschikow und F. I. Perchorowitsch in die Stadt ein.
Folgen
Die sowjetische Woronescher Front und die Südwestfront stiessen 360–520 km vor und fügten der deutschen Heeresgruppe B in mehreren Kesselschlachten schwere Niederlagen zu. Durch die am 25. Februar eingeleitete Gegenoffensive der deutschen 4. Panzerarmee zwischen Pawlograd und Krasnograd und der deutschen 1. Panzerarmee im Raum Slawjansk gegen die Flanken der durchgebrochenen Panzergruppe Popow (4. Garde- und 3., 10. und 18. Panzerkorps) konnte eine gefährliche Frontlücke geschlossen werden. Der Siegeslauf der nördlicher vorgehenden Woronesch-Front kam dadurch bis Anfang März zum Stehen.
Die Achsenmächte verloren 160.000 Mann (77.000 Tote, 49.000 davon deutsch). Die Verluste der Roten Armee beliefen sich auf 154.000 Mann (55.000 Tote). In der folgenden Schlacht um Charkow konnte Charkow (16. März) und Belgorod (18. März) von deutschen Truppen zurückerobert werden.
Schlacht an der Neretva (20.01.1943 – 15.03.1943)
Die Schlacht an der Neretva (serbokroatisch Bitka na Neretvi / Битка на Неретви) war ein unter dem Decknamen Operation Weiss getarnter strategischer Plan des Deutschen Reichs im Zweiten Weltkrieg für einen gemeinsamen Angriff der Achsenmächte auf die jugoslawischen Partisanen. Zu Beginn des Jahres 1943 befürchteten die Achsenmächte eine Invasion der Alliierten auf dem Balkan.
Deshalb sollten die jugoslawischen Partisanen möglichst vollständig vernichtet werden, insbesondere auch das Oberkommando der Partisanenbewegung, das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Jugoslawiens. Es war damit auch geplant, das Hauptlazarett der Partisanen zu zerstören. Der Beginn der Offensive war für den 20. Januar 1943 angesetzt und konzentrierte sich auf das Gebiet Bosnien-Herzegowinas. Die Militäraktion endete im April 1943. Sie wurde nach dem nahegelegenen Fluss Neretva benannt. Die Operation ist in Quellen der ehemaligen Republik Jugoslawien auch bekannt als Vierte Anti-Partisanen-Offensive, ebenfalls als Vierte-Feind-Offensive (Četvrta neprijateljska ofenziva/ofanziva) oder Schlacht für die Verwundeten (Bitka za ranjenike).
Operation
Die Achsenmächte boten neun Divisionen auf, sechs deutsche und drei italienische. Diese wurden unterstützt von zwei kroatischen Divisionen und einer Anzahl von Tschetnik- und Ustascha-Verbänden. Etwa 150.000 Soldaten auf Seiten der Achse standen einer wesentlich kleineren Streitmacht der Partisanen gegenüber.
Die Militäroperation wurde in drei Phasen durchgeführt:
- Weiss I begann am 20. Januar 1943 mit dem Angriff auf die von den Partisanen gehaltenen Gebiete westlich von Bosnien und zentralen Teilen von Kroatien.
- Weiss II schloss sich am 25. Februar an. Es gab Gefechte im Westen und Südwesten von Bosnien und die Partisanen wichen so weit nach Südosten aus, bis sie das Ufer der Neretva im Rücken hatten.
- Weiss III begann im März 1943 und konzentrierte sich auf die Gebiete der nördlichen Herzegowina, aber es gelang den bedrängten Partisanen, sich aus ihrer Einkesselung zu befreien und ins nördliche Montenegro durchzubrechen, so dass die dritte Phase der Militäroperation aus Sicht der Achsenmächte nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte.
Im Verlauf der Schlacht wurden die Partisanen dicht ans westliche Ufer der Neretva gedrängt. Dabei standen sie deutschen Streitkräften gegenüber, die von Panzerbrigaden unterstützt wurden. Das den Partisanen gegenüberliegende östlichen Ufer der Neretva wurde lediglich von Formationen der Tschetniks überwacht, die in Abstimmung mit den Deutschen handelten. Die durch das tiefliegende Flussbett der Neretva getrennten Ufer waren nur durch die Brücke der Narentabahn verbunden. Wäre es den Partisanen rechtzeitig gelungen, den Fluss mit Hilfe der Brücke zu überqueren und ans östliche Ufer zu gelangen, dann wären sie in relativer Sicherheit gewesen. Allerdings fehlte ihnen angesichts der militärischen Überlegenheit der Achsenstreitkräfte die Zeit, alle Leute über die Brücke zu bringen. Um der drohenden Vernichtung zu entgehen, plante der Partisanenführer Marschall Tito nun ein ausgeklügeltes Täuschungsmanöver. Er befahl seinen Pionieren, die Brücke über die Neretva, also die einzige offensichtliche Fluchtmöglichkeit, zu sprengen. Als die Luftaufklärung die Fotos von der zerstörten Brücke General Löhr vorlegte, zog dieser den Schluss, dass die Partisanen ausgehend von ihrer aktuellen Position einen Vorstoss nach Norden planten (entlang des westlichen Ufers der Neretva). Die Sprengung der Brücke wurde auf deutscher Seite als moralisches Druckmittel von Tito interpretiert, um seine Kämpfer anzuspornen und möglicher Desertion vorzubeugen. Aus diesem Grund wurde eine Umgruppierung der Truppen der Achsenmächte vorgenommen, so dass Titos Einheiten im erwarteten Kampfgebiet vernichtet werden konnten, sobald sie angriffen. Stattdessen verschafften diese Massnahmen den Pionieren der Partisanen kostbare Zeit, um die Brücke behelfsmässig zu reparieren. Es gelang den Partisanen, die Truppen der Tschetniks am gegenüberliegenden Ufer der Neretva einzukreisen und auszuschalten. Zwar durchschauten die Deutschen schliesslich Titos Finte, waren dann aber nicht mehr in der Lage, rechtzeitig einen ernsthaften Angriff vorzubereiten, da sie die Umgruppierungsbefehle nicht rasch genug zurückdrehen konnten. Die Nachhut der Partisanen kämpfte gegen den wieder zunehmenden Druck durch deutsche Truppen. Letztlich retteten die Partisanen den Grossteil ihrer Leute ans östliche Ufer der Neretva. Der Übergang vollzog sich jedoch unter heftigem Bombardement der Luftwaffe. Lediglich die gebirgige Landschaft verhinderte die hinreichende Zerstörung der provisorischen Brücke. Nachdem den Partisanen die Flucht gelungen war, wurde die schwache Brücke wieder unbrauchbar gemacht, um die weitere Verfolgung zu unterbinden. Die Absetzbewegung wurde von Tito propagandistisch aufgewertet, da es ihm doch gelungen war, sein gegebenes Versprechen einzulösen, auch die Verwundeten aus dem Hauptlazarett der Partisanen zu evakuieren, denen im Falle einer Gefangennahme durch die Achsenmächte die Hinrichtung gedroht hätte. Später kam es zu den befürchteten Exekutionen tatsächlich infolge der Schlacht an der Sutjeska.
Folgen
Ende März hatten die Streitkräfte der Achse etwa 8.000 Partisanen getötet und dazu noch 2.000 Gefangene gemacht. Abgesehen von diesen schweren Verlusten für die Jugoslawische Volksbefreiungsarmee und einem taktischen Sieg der Achsenmächte konnten die Partisanen ihr Oberkommando und ihr Lazarettwesen sichern und waren in der Lage, ihre militärischen Operationen fortzusetzen. Tatsächlich mussten die Partisanen, nachdem sie die östlichen Gebiete von Bosnien und Herzegowina erreicht hatten, sich nur noch den Tschetniks stellen. Die Tito-Partisanen konnten die Tschetniks im Gebiet westlich der Drina fast vollständig ausser Gefecht setzten. Die nächste grosse Militäroperation in Jugoslawien war die Operation Schwarz, die als Schlacht an der Sutjeska bekannt wurde.
Die Vertreibung Titos aus seinem Gebiet in Nordwest-Bosnien erwies sich langfristig ungünstig für die deutsche Wehrmacht und ihre Verbündeten, denn nun konnten die Partisanen sich in den unwegsameren Bergen Montenegros festsetzen. Der Übergang an der Neretva erregte internationales Aufsehen, dessen Bedeutung darin lag, dass nun der britische Premierminister Winston Churchill begann, die Partisanen Titos zu unterstützen.
Schlacht am Kasserinpass (19.02.1943 – 22.02.1943)
Die Schlacht am Kasserinpass war eine Schlacht zwischen deutsch-italienischen und alliierten Truppen im Rahmen des Tunesien-Feldzugs und das erste grössere Aufeinandertreffen deutscher und amerikanischer Verbände während des Zweiten Weltkriegs. Trotz hoher alliierter Verluste wurde der auf das US-amerikanische Nachschublager im ostalgerischen Tebessa zielende Vorstoss der Achsenmächte abgewiesen.
Vorgeschichte
Nach der Niederlage der Panzerarmee Afrika unter Erwin Rommel in der zweiten Schlacht von El Alamein und den britisch-US-amerikanischen Landungen in Marokko und Algerien (Operation Torch) im November 1942 befanden sich die italienischen und deutschen Truppen in einem Zweifrontenkrieg. Nach dem Fall von Tripolis (Ende Januar 1943) besetzte die sich zurückziehende Armee Rommels die Mareth-Linie in Südtunesien, um sie gegen Montgomerys Angriffe zu verteidigen. Um den alliierten Vormarsch der britischen 1. Armee im Westen zu stoppen, war zuvor in Tunesien die 5. Panzerarmee unter Hans-Jürgen von Arnim aufgestellt worden.
Dem II. US-Korps der britischen 1. Armee war es Anfang 1943 gelungen, die Ausläufer des Tellatlas in Westtunesien zu besetzen, von wo aus es die Nachschublinien Rommels bedrohte. Am 30. Januar begannen Truppen der 5. Panzerarmee unter Führung von Generalleutnant Heinz Ziegler einen Angriff auf den von französischen Truppen verteidigten Faïd-Pass, den sie trotz des Eingreifens von Teilen der 1. US-Panzerdivision einnehmen konnten. Am 14. Februar begannen die deutschen Truppen das Unternehmen „Frühlingswind“ mit einem Angriff der 10. und 21. Panzer-Division auf Sidi Bouzid, etwa 15 km westlich vom Faïd-Pass. In den Kämpfen vom 14. bis zum 17. Februar verlor die 1. US-Panzerdivision über 100 Panzer und musste sich zurückziehen. Die dadurch gewarnten Alliierten zogen eilig weitere Truppen in das bedrohte Gebiet und nahmen ihre Truppen aus Gafsa zurück.
Am 17. Februar erreichte die 21. Panzer-Division Sbeitla. In dieser Situation übernahm Rommel persönlich den Befehl über die Operation, die beiden Panzerdivisionen wurden ihm direkt unterstellt. Damit verbunden war der Auftrag des italienischen Comando Supremo, nicht auf Tebessa, die Hauptbasis des II. US-Korps, sondern auf El Kef, in den Rücken des britischen V. Korps, vorzu-stossen. Hierfür kamen die Sbiba-Lücke und der Weg durch den Kasserinpass und über Thala in Frage. Die divisionsstarke Kampfgruppe Deutsches Afrikakorps sowie die Panzerdivision Centauro und das 7. Bersaglieri-Regiment waren bereits von Gafsa aus in Marsch gesetzt worden, um Rommels Angriffsgruppe zu verstärken. Aufklärungseinheiten der Kampfgruppe DAK erreichten den Ort Kasserine am 18. Februar.
Verlauf
Am 19. Februar führte die Kampfgruppe DAK zunächst testweise Angriffe auf den Eingang zum Kasserinpass durch, bei denen sie in einem Minenfeld steckenblieb. Die 21. Panzer-Division, bei der Rommel sich an diesem Tag aufhielt, traf währenddessen bei Sbiba auf die britische 1st Guards Brigade und Teile der 34. US-Infanteriedivision und wurde in ihrem Vormarsch gestoppt. Rommel entschied daraufhin, den Erfolg am Kasserinpass zu suchen und die 10. Panzer-Division, die von der 5. Panzerarmee in den Raum Kairouan befohlen worden war, hierfür einzusetzen.
In der Nacht vom 20. zum 21. durchbrachen die deutschen Verbände die von der Task Force Stark gehaltene Verteidigungslinie am Kasserinpass. Die von General Lloyd Fredendall schlecht geführten US-Truppen wurden zerschlagen, 3000 ihrer Soldaten fielen oder wurden verwundet, 4000 gerieten in Gefangenschaft, der Grossteil der US-Truppen floh in Panik. Bei ihrer Flucht liessen die US-Truppen grosse Mengen an Waffen, Fahrzeugen und Ausrüstung zurück. Die 10. Panzer-Division erbeutete während der Kämpfe am Kasserinpass u. a. 95 M3 Halbkettenfahrzeuge.
Die 10. Panzer-Division wandte sich daraufhin nach Thala, wo sie auf die 26. britische Panzerbrigade traf, die mit starker Artillerie- und Luftunterstützung ihre Stellung verteidigte. Die Kampfgruppe DAK ging in nordwestlicher Richtung im Bahiret Foussana vor, wobei sich ihr das noch frische Combat Command B der 1. US-Panzerdivision und Teile der 1. US-Infanteriedivision entgegenstellten.
Nach erfolglosen Angriffen auf die amerikanischen Stellungen am 22. und nach Rücksprache mit dem OB Süd Kesselring entschied sich Rommel, die Angriffe abzubrechen und die Kampfgruppe DAK sowie die 10. Panzer-Division unter Verminung des Rückzugswegs auf den Kasserinpass zurückzuziehen. Nach der Ernennung zum Oberbefehlshaber der neuen Heeresgruppe Afrika am 23. Februar erhielt er den Befehl des Comando Supremo, die Offensive einzustellen und seine mobilen Verbände auf eine spätere Aktion gegen die Spitzen der 8. Armee an der Mareth-Linie vorzubereiten.
Folgen
Als Folge seiner nicht überzeugenden Führung während der Schlacht wurde Anfang März Lloyd Fredendall als Kommandierender General des II. US-Korps von George S. Patton abgelöst, dem Omar N. Bradley als Stellvertreter zugeteilt wurde. Die Niederlage der US-Truppen und ihre Flucht trugen dazu bei, die Geringschätzung der britischen Soldaten bezüglich der Kampfkraft ihrer Verbündeten zu verstärken.
Schlacht bei Charkow (19.02.1943 – 15.03.1943)
Die dritte Schlacht um Charkow fand während des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Februar und März 1943 statt. Nach der Niederlage in der Schlacht von Stalingrad drohte der gesamten südlichen deutschen Ostfront der Zusammenbruch. Im Zuge der Woronesch-Charkower Operation konnte die Rote Armee die Stadt Charkow (Charkiw) Anfang 1943 vorübergehend einnehmen. Generalfeldmarschall Erich von Manstein gelang es jedoch, mit einem strategischen Manöver, das oft mit einer Rochade verglichen wird, die Südflanke zu stabilisieren und die Stadt zurückzuerobern. Dies war der letzte bedeutende Erfolg der Wehrmacht im Krieg gegen die Sowjetunion; der Sieg verzögerte den Zusammenbruch der deutschen Ostfront um mehr als ein Jahr.
Hintergrund
Die Situation am mittleren Don
Das zum Entsatz der in Stalingrad eingeschlossenen 6. Armee durchgeführte Unternehmen Wintergewitter musste am 23. Dezember 1942 abgebrochen werden, da drei sowjetische Fronten am mittleren Don durchgebrochen waren und nach Süden vorstiessen (→ Mittlere Don-Operation). Das sowjetische Oberkommando plante, durch diese und folgende Operationen mehrere Grossverbände der Wehrmacht einzukesseln und zu zerschlagen:
- Heeresgruppe B unter Maximilian von Weichs am oberen und mittleren Don
- Heeresgruppe Don unter Erich von Manstein bei Stalingrad
- Heeresgruppe A unter Ewald von Kleist im Kaukasus
Dies hätte für das Deutsche Reich den Verlust von über einer Million Soldaten bedeutet. Die Rote Armee hatte zunächst Erfolg, da ihr am mittleren Don nur die italienische 8. Armee gegenüberstand. So gelang es dem XXIV. Panzerkorps unter General Wassili Badanow, in fünf Tagen 240 km weit vorzustossen. Am 24. Dezember 1942 eroberte das Korps Tazinskaja, das mit seinem Feldflughafen und den dortigen Vorratslagern wichtig für die Versorgung der in Stalingrad eingeschlossenen deutschen Soldaten war. Damit waren die Verbände der am Tschir kämpfenden Armeeabteilung Hollidt von der Einschliessung bedroht, denn Badanows Korps war nur noch 130 km von Rostow entfernt.
Die Generäle Hoth und Hollidt mussten ihre schlagkräftigsten Divisionen abgeben, da Manstein diese benötigte, um Badanows Einheiten zu stoppen. Die sowjetischen Befehlshaber rechneten nicht mehr mit Widerstand und waren deshalb überrascht, als die 11. Panzer-Division, die 6. Panzer-Division sowie die 306. Infanterie-Division der Wehrmacht das sowjetische Korps einkesselten und aufrieben. An der Bistraja verlor das sowjetische XXV. Panzerkorps kurz darauf 90 T-34, so dass es seinen Angriff ebenfalls einstellen musste. Als die 1. und 6. Gardearmee von der Armeeabteilung Fretter-Pico aufgehalten wurden, waren die nördlichen Angriffsspitzen gekappt.
Die Situation am Südflügel der Ostfront
Die Situation weiter südlich war nicht minder bedrohlich für die deutschen Verbände: Die 51. Armee sowie die 2. Gardearmee hatten eine Lücke zwischen der 4. Panzerarmee Hoths und der Armeeabteilung Hollidt entdeckt und waren durch sie hindurch-gestossen. Ziel war es, durch die Einnahme Rostows der 1. Panzerarmee den Rückzug aus dem Kaukasus abzuschneiden sowie Hoths Armee einzuschliessen. Zwar war der Abzug aus dem Kaukasus zu diesem Zeitpunkt bereits eingeleitet worden, die 1. Panzerarmee war jedoch noch immer über 600 km von Rostow entfernt. Die sowjetischen Panzerspitzen waren hingegen am 20. Januar bereits 30 km vor Rostow. Wegen Erschöpfung und Treibstoffmangels verlangsamten sich jedoch die Operationen der Roten Armee, so dass es den Deutschen gelang, Verstärkung heranzuführen und damit einen „Flaschenhals“ für die 1. Panzerarmee offenzuhalten.
Eroberung Charkows durch die Rote Armee
Nach dem erfolgreichen Durchbruch im Abschnitt der deutschen Heeresgruppe B im Zuge der Operationen Ostrogoschsk-Rossosch und Woronesch-Kastornoje leitete die Woronescher Front unter Filipp Iwanowitsch Golikow am 2. Februar die Operation Stern („Звезда“) ein. Während zwei Armeen der Front den Vorstoss der Brjansker Front auf Kursk unterstützen sollten, griffen die 40. Armee (Generalleutnant Kirill Moskalenko), die neu aufgestellte 69. Armee (Generalleutnant Michail Kasakow) und die 3. Panzerarmee (Generalleutnant Pawel Rybalko) in Richtung Charkow an. Dabei sollte die 40. Armee die Stadt nördlich umgehen und die 69. Armee Charkow über Woltschansk direkt angreifen, während die 3. Panzerarmee die Stadt südlich umgehen sollte. Verantwortlich für die Koordination der drei Armeen war General Alexander Wassilewski.
Am 4. Februar erreichte die 3. Panzerarmee als erste den Donez etwa 20 km östlich von Charkow bei Tschugujew, konnte jedoch gegen die am gegenüberliegenden Flussufer liegende SS-Panzergrenadier-Division Leibstandarte SS Adolf Hitler nicht über den gefrorenen Fluss vordringen. Ein Entlastungsangriff nördlich gegen Belij Kolodez scheitert vor Prikolodnoje, als das XV. Panzerkorps der 3. Panzerarmee auf Verteidigungsstellungen der SS-Panzergrenadier-Division „Das Reich“ stiess. Am 9. Februar erreichte die 40. Armee gegen den Widerstand der 168. Infanterie-Division Belgorod und formte einen Brückenkopf über den Donez. Die 69. Armee erreichte gegen die verzögernd kämpfende Division Grossdeutschland Woltschansk. Südlich davon hatte das VI. Gardekavallerie-korps der 3. Panzerarmee über Andrejewka den Feind umgangen und stiess kurz vor Charkow auf Merefa vor. Dadurch war General der Gebirgstruppe Hubert Lanz, dem am 6. Februar als Führer der Armeeabteilung Lanz die Reste der zwischen Don und Donez zurückweichenden Truppen der Heeresgruppe B sowie das aus Frankreich herangeführte SS-Panzerkorps unterstellt worden waren, gezwungen, die deutschen Divisionen am östlichen Donezufer auf Charkow zurückzunehmen. Sie sollten nun Charkow aus dem unmittelbaren Vorfeld der Stadt verteidigen, während die 168. Infanterie-Division versuchte, die offene Flanke zur 2. Armee zu decken.
Bereits bei seiner Befehlsübernahme war Lanz vom Führerhauptquartier ausdrücklich befohlen worden, nicht nur das zur Festung erklärte Charkow, um jeden Preis zu verteidigen, sondern auch mit dem unterstellten SS-Panzerkorps nach Süden zur Unterstüt-zung der Heeresgruppe Don anzugreifen. Obwohl Lanz überzeugt war, unmöglich beide Aufgaben erfüllen zu können, gab er schliesslich, gedrängt von deren Befehlshaber Generalfeldmarschall von Manstein, am 10. Februar den SS-Truppen den Befehl zum Angriff. Somit trat die SS-Panzergrenadier-Division LSSAH bei Merefa südlich Charkow zum Angriff an (die Division liess ein verstärktes Panzergrenadier-Regiment zurück, erhielt dafür allerdings ein Panzergrenadier-Regiment von der SS-Panzergrenadier-Division „Das Reich“). Trotz der Behinderung durch hohen Schnee gelang es bis zum 15. Februar, etwa 30 km weit vorzudringen und dabei starke Kräfte des VI. Gardekavalleriekorps zu zerschlagen. Nach der Unterstellung der Armeeabteilung Lanz unter die von Manstein neu aufgestellte Heeresgruppe Süd wurde der Auftrag jedoch geändert. Die Armeeabteilung sollte sich nunmehr gänzlich auf die Verteidigung Charkows konzentrieren.
Währenddessen setzten die angreifenden Verbände der Roten Armee ihren Vormarsch fort. Die 69. Armee stiess am 10. Februar über den Donez vor, wurde jedoch 15 km vor der Stadt von Truppen der SS-Panzergrenadier-Division „Das Reich“ gestoppt. In den folgenden Tagen konnte sie nur noch kleinere Angriffserfolge erzielen. Der 3. Panzerarmee gelang der Übergang über den Donez bei Petschenegi und Tschugujew erst in der Nacht zum 10. Februar. Bis zum 11. Februar wurde die Armee jedoch bei Rogan – 10 km vor Charkow – ebenfalls durch Kräfte der SS-Panzergrenadier-Division „Das Reich“ aufgehalten und konnte erst am 12. Februar langsam weiter vordringen. Am 14. Februar gelang es dem XII. und XV. Panzerkorps sowie der 160. Schützen- und der 48. Gardeschützendivision der 3. Panzerarmee, in die östlichen Vororte der Stadt vorzudringen.
Schneller als im Süden war der Vormarsch der 40. Armee, die am 10. Februar die 168. Infanterie-Division und die Division Grossdeutschland zum Rückzug zwang und daraufhin mit vier Schützendivisionen und dem V. Gardepanzerkorps (vormals IV. Panzerkorps) von Norden auf Charkow zustiess. Bereits am 13. Februar erreichte die 340. Schützendivision mit Panzerunterstützung die innere Verteidigungslinie Charkows. Sie stiess am folgenden Tag weiter vor und drang in die nordwestlichen Vororte ein. Am gleichen Tag gelangte die 183. Schützendivision bis Sokolniki am nördlichen Stadtrand und stiess gegen Abend bereits auf das Stadtzentrum vor. Die Hauptkräfte der 40. Armee, bestehend aus dem VI. Gardepanzerkorps, der 305. Schützendivision und der 6. motorisierten Gardeschützenbrigade, umgingen unterdessen die Stadt und besetzten bei Ljubotin die Hauptausfallstrasse der deutschen Verteidiger nach Westen. Von Süden drangen gleichzeitig Kräfte der 3. Panzerarmee auf Osnowo vor und drohten die in Charkow kämpfenden deutschen Kräfte, bestehend aus der Division Grossdeutschland (im Westteil der Stadt), der SS-Panzergrenadier-Division „Das Reich“ (im Norden), dem verstärkten Panzergrenadier-Regiment der Leibstandarte (im Westteil) und der 320. Infanterie-Division (im Südosten) einzuschliessen.
In dieser bedrängten Situation und angesichts von Berichten über Aufstände bewaffneter Zivilisten in Charkow drohte der Führer des SS-Panzerkorps Paul Hausser seinem Befehlshaber General Lanz, bis 16:30 Uhr eigenständig aus Charkow abzuziehen, sollte dieser nicht einen entsprechenden Befehl geben. Erst nach einem zweimal wiederholten ausdrücklichen Befehl Lanz’ und Mansteins, dem Führerbefehl gemäss Charkow zu verteidigen, erklärte sich Hausser um 21:30 Uhr bereit, die Stellungen in Charkow zu halten. Doch damit war die Führungskrise in Charkow keineswegs bereinigt. Während die Rote Armee den Ausfallkorridor aus Charkow immer weiter zuschnürte, hatten am Morgen des 15. Februar Einheiten der SS-Panzergrenadier-Division „Das Reich“ eigenmächtig ihre Stellungen am Nordrand der Stadt verlassen, die daraufhin unverzüglich von Kräften der sowjetischen 69. Armee besetzt wurden. Ebenso gelang es dem XV. Panzerkorps, unterstützt durch die 160. Schützendivision, am Ostrand der Stadt weiter vorzudringen. In dieser Situation gab Hausser wiederum eigenmächtig den Befehl zum Rückzug aus Charkow. Die deutsche Verteidigung brach daraufhin zusammen und bis zum Mittag des 16. Februar war die Stadt fest in der Hand der Roten Armee. Obwohl er offensichtlich gegen einen Führerbefehl verstossen hatte, wurde letztendlich nicht Hausser für den Verlust des Prestigeobjektes Charkow zur Verantwortung gezogen, sondern General Lanz, der durch General der Panzertruppe Werner Kempf ersetzt wurde, obwohl er darauf bestanden hatte, dass Haussers SS-Panzerkorps den Kampf um die Stadt fortsetzte.
Erneute Eroberung durch die Wehrmacht
Deutsche Strategie
Die Strategie, mit der Manstein den Gegenschlag auszuführen gedachte, wurde von ihm „Schlagen aus der Nachhand“ genannt. Dieses sah folgendes vor: Der Feind sollte zunächst weit vorstossen, sich in Sicherheit wiegen und dann (unter Ausnutzung der bei einem derartig schnellen Vormarsch zumeist auftretenden Nachschubprobleme) von den Flanken her geschlagen werden.
Hitler, wütend wegen Haussers Befehlsverweigerung, flog am 17. Februar in Mansteins Hauptquartier, wo der Feldmarschall dem Oberbefehlshaber seine Strategie erläuterte. Hitler bestand zunächst auf einer baldigen erneuten Eroberung Charkows, doch gelang es ihm nicht, sich durchzusetzen.
Durch die mehr als 150 Kilometer breite Lücke zwischen der Armeeabteilung Kempf und der 1. Panzerarmee waren Truppen der sowjetischen Südwestfront (1. Gardearmee, 6. Armee sowie die „Gruppe Popow“) weit ins Hinterland der Heeresgruppe Süd durchgebrochen und hatten die Eisenbahnstrecke östlich von Dnepropetrowsk unterbrochen. Da die sowjetischen Truppen zu diesem Zeitpunkt nur noch 60 km vom Dnjepr entfernt waren, beschloss Manstein – sehr zum Ärger Hitlers – die am Mius stationierten Panzerverbände abzuziehen und gegen Markian Popows Stosskeile einzusetzen. Ausserdem standen die sowjetischen Panzerspitzen nur noch 60 km vor Saporoschje, wo sich Mansteins Hauptquartier befand. Als Hitler dies erfuhr, flog er zurück, und somit hatte Manstein die Möglichkeit, seinen Plan umzusetzen.
Der deutsche Gegenschlag
Den deutschen Soldaten wurde befohlen, Popows Einheiten in den Rücken zu fallen und deren Nachschubwege zu unterbinden. Zu diesem Zweck war das Panzerarmeeoberkommando 4 (General Hoth) von der Miusfront abgezogen und – verstärkt durch das SS-Panzerkorps sowie zwei weitere Panzerkorps – nach Dnepropetrowsk verlegt worden. Seine Aufgabe war es, den tiefen sowjetischen Einbruch durch Angriffe auf beiden Flanken zu bereinigen. Da sich Erschöpfung und Nachschubprobleme auf sowjetischer Seite bereits bemerkbar machten, bat General Popow am 20. Februar darum, seine Panzergruppe zurücknehmen zu dürfen, was ihm jedoch vom Kommandeur der Südwestfront Nikolai Watutin, dessen Optimismus nach wie vor ungebrochen war, verweigert wurde. Zu diesem Zeitpunkt nahm das sowjetische Hauptquartier immer noch an, die Deutschen hätten vor, auf den Dnepr zurückzuweichen, und verkannte die deutschen Absichten.
Am 22. Februar begann der Angriff der Wehrmacht gegen die sowjetische Woronescher und Südwestfront. Da Manstein seine Panzerdivisionen erst kurz zuvor in die Bereitstellungsräume befohlen hatte, gelang ihm eine Täuschung des Gegners; die Sowjets glaubten bis dahin, dass die Wehrmacht sich auf hinhaltenden Widerstand beschränken würde. Die Panzergruppe Popow sowie die sowjetische 6. Armee wurden vom deutschen Angriff daher völlig überrascht, eingekesselt und aufgerieben. Die Wehrmacht stand dadurch am 28. Februar wieder am Donez. Nun klaffte in der sowjetischen Front eine 200 km breite Lücke, so dass die Stawka die Angriffsoperationen bei Woroschilowgrad einstellen musste. Am 2. März eroberten die Deutschen Slawjansk und Bogoroditschno und bildeten bei Balakleja einen Brückenkopf über den Donez.
Das SS-Panzerkorps dringt in Charkow ein
Am 6. März traten die deutsche 4. Panzerarmee (zu der Haussers SS-Panzerkorps gehörte) und die Armeeabteilung Kempf zur Offensive gegen die sowjetische 3. Panzer- sowie die 69. Armee an. Am 11. März 1943 begann der Angriff des SS-Panzerkorps auf Charkow. Zunächst wurden die sowjetischen Stellungen überrannt, doch gerieten die Deutschen bald darauf in Gefahr, selbst eingeschlossen zu werden. Anstatt den Angriff abzubrechen, entschied man sich, die Stadt nördlich zu umgehen. In den Morgen-stunden des 12. März 1943 drohte der deutsche Vormarsch infolge eines Panzerangriffs seitens der Roten Armee in die offene Flanke zu scheitern. Die Sowjets wollten einen Keil zwischen Voraustruppen und das Gros des SS-Verbandes treiben. Der Versuch, den erneuten Verlust der viertgrössten Stadt des Landes mit allen verfügbaren Kräften zu verhindern, scheiterte jedoch am hartnäckigen deutschen Widerstand. Am 15. März wurde Charkow durch die SS-Divisionen Leibstandarte SS Adolf Hitler und Das Reich unter dem Befehl von Josef Dietrich besetzt, am 18. März fiel Belgorod wieder in deutsche Hand. Durch den von Manstein erdachten Gegenschlag waren vier sowjetische Armeen aufgerieben worden.
Folgen
Die Rote Armee verlor vom 4. bis zum 25. März 1943 in der Charkiwer Verteidigungsoperation 86.496 Mann (darunter 45.219 Tote und Vermisste), nachdem die vorangegangenen Angriffsoperationen im Rahmen der Woronesch-Charkower Operation bereits einen Blutzoll von 153.561 Soldaten (darunter 55.475 Tote und Vermisste) gefordert hatten.
Durch diese Gegenoffensive konnte die Wehrmacht den Südabschnitt der Front stabilisieren und einen drohenden Zusammenbruch verhindern, der selbst die Niederlage von Stalingrad in den Schatten gestellt hätte.
Mit der erneuten Eroberung Belgorods ergab sich für die deutsche Führung die Gelegenheit, die im Frontbogen bei Kursk stehenden sowjetischen Kräfte abzuschnüren und zu zerschlagen. Generalfeldmarschall von Manstein wollte den Erfolg unmittelbar im Anschluss ausnutzen und die Verbände der Roten Armee bei Kursk sofort einschliessen. Der Angriff auf Kursk wurde von Hitler jedoch mehrmals verschoben und fand letztlich erst im Juli 1943 unter dem Decknamen Unternehmen Zitadelle statt, was der Roten Armee genug Zeit verschaffte, um den Frontbogen zu verstärken und ihre Stellungen auszubauen. Dies hatte zur Folge, dass der deutsche Angriffsplan scheiterte. Bei ihrer Gegenoffensive, der Belgorod-Charkower Operation, konnte die Rote Armee am 23. August Charkow erneut einnehmen – diesmal endgültig.
Schlacht von Ksar Ghilane (23.02.1943 – 10.03.1943)
Die Schlacht von Ksar Ghilane (auch: Ksar Rhilane) war eine militärische Auseinandersetzung, die während des Zweiten Weltkriegs auf dem afrikanischen Kontinent zwischen dem Deutschen Afrikakorps (DAK) und den alliierten Streitkräften stattfand. Ksar Ghilane, eine bereits in römischer Zeit mit einer kleinen Garnison belegte Wüstenoase (Kleinkastell Tisavar), die unmittelbar am nördlichen Rand der zur Sahara gehörenden Östlichen Grossen Sandwüste liegt, befindet sich rund 75 Kilometer westlich von Tataouine in Südtunesien.
Am 10. März 1943 griffen zwei deutsche Panzerdivisionen des DAK die an der Oase verschanzten Freien französischen Streitkräfte des damaligen Brigadegenerals Jacques-Philippe Leclerc de Hauteclocque (1902–1947) an. Bf 109 des Jagdgeschwaders 77 der Luftwaffe, die als Begleitschutz für die ebenfalls in den Raum Ksar Rhilane beorderten Ju 87 des Sturzkampfgeschwaders 3 fungierten, wurden dabei in Kämpfe gegen 20 Curtiss Kittyhawk und sechs Spitfires der britischen Royal Air Force verwickelt. Die Alliierten konnten zwar vor allem durch ihre Luftunterstützung – insbesondere durch Hurricane Mk.IIB mit panzerbrechenden Waffen – den kampfentscheidenden Bodenangriff aufhalten und abweisen, dem Jagdgeschwader 77 gelang es jedoch, zehn feindliche Flugzeuge abzuschiessen und ohne eigene Verluste das Gefecht zu beenden.
Ungewöhnlicherweise blieben die Spuren der Panzerketten bis mindestens 1979 im Sand sichtbar und zwei hier etablierte Wüstenpflanzen wurden nach dem Krieg nicht mehr gesichtet. Dies wertete ein Bericht der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen 1985 im Kontext mit anderen afrikanischen Kriegsschauplätzen als ein Zeichen, wie schnell das Ökosystem in Trockenzonen selbst durch scheinbar kleine Störungen aus dem Gleichgewicht gebracht werden kann.
Schlacht an der Sutjeska (15.05.1943 – 16.06.1943)
Die Schlacht an der Sutjeska (serbokroatisch Bitka na Sutjesci/Битка на Сутјесци) bezeichnet die vom 15. Mai bis 16. Juni 1943 durchgeführte Offensive der Achsenmächte mit Unterstützung des unabhängigen Staates Kroatien gegen die Jugoslawische Volksbefreiungsarmee in der Nähe des Flusses Sutjeska in Südost-Bosnien während des Zweiten Weltkriegs. Der Ausgang der Schlacht war der Wendepunkt für Jugoslawien im Zweiten Weltkrieg. Das deutsche Heereskommando nannte diese Offensive Operation Schwarz, sie folgte auf die zuvor durchgeführte Operation Fall Weiss, deren Ziel, die Vernichtung der jugoslawischen Partisanen und die Gefangennahme ihres Anführers Josip Broz Tito, fehlgeschlagen war.
Verlauf
Die Achsenmächte mobilisierten für diese Offensive rund 127.000 Soldaten mit über 300 Kampfflugzeugen zur Unterstützung. Ihnen gegenüber stand eine Armee von 18.000 Soldaten der jugoslawischen Volksbefreiungsarmee, die in 16 Brigaden gegliedert war. Nachdem sich die Truppen versammelt hatten, begann der deutsche Angriff am 15. Mai 1943. Die Angreifer nutzten ihren Vorteil in der Anfangsposition, um die Partisanen im Bereich des Durmitor-Massivs im gebirgigen Teil des Nordens von Montenegro einzukreisen. Sie verwickelten die Partisanen auf felsigem Terrain einen Monat lang in schwere Gefechte.
Ausgang
Kurz vor der vollständigen Einkreisung gelang dem Grossteil der jugoslawischen Volksbefreiungsarmee der Durchbruch durch die Reihen der deutschen 118. und 104. JägerDivision sowie der 369. (kroatischen) Infanterie-Division über die Sutjeska, in Richtung Ost-Bosnien. Drei Brigaden konnten nicht entkommen, auch das Feldlazarett der Partisanen blieb eingeschlossen. Wegen Mangels an Nahrung und Medikamenten in der jugoslawischen Volksbefreiungsarmee starben viele Partisanen an Typhus. Die Partisanen verloren 6391 Mann (mehr als ein Drittel ihrer Kämpfer), die Verluste der Gegenseite waren deutlich geringer. Die jugoslawische Volksbefreiungsarmee konnte sich jedoch im Osten Bosniens neu formieren und eroberte innerhalb der nächsten 20 Tage die Orte Olovo, Srebrenica und Zvornik zurück.
Folgen
Aus deutscher Sicht ist diese Operation nicht als Sieg zu werten, da es weder gelang, den Anführer der Partisanen, Josip Broz Tito, noch die Partisanenverbände als Ganzes zu vernichten. Die Operation ist sogar als moralische Niederlage der Achsenmächte anzusehen, da nach Bekanntwerden des Misserfolgs alle jugoslawischen Völker die Partisanen unterstützten und auch die Alliierten ihnen Munition und Waffen lieferten.
Im Nachkriegsjugoslawien wurde die Schlacht als Wendepunkt im gesamten Krieg angesehen. Der während des Durchbruchs gefallene Kommandant der dritten Sturmdivision der jugoslawischen Volksbefreiungsarmee, Sava Kovačević, wurde postum als Volksheld Jugoslawiens ausgezeichnet. In der Dolina heroja („Tal der Helden“) in Tjentište steht ein Denkmal und ein Museum zu Ehren der gefallenen jugoslawischen Kämpfer in der Schlacht an der Sutjeska. Die Schlacht gilt auch als Symbol für die Befreiung Jugoslawiens „aus eigener Kraft“, also ohne die Rote Armee.
Operation Corkscrew (10.06.1943)
Operation Corkscrew bezeichnet die während des Zweiten Weltkriegs am 10. Juni 1943 erfolgte Invasion der Alliierten auf die italienische Insel Pantelleria (zwischen Sizilien und Tunesien gelegen). Es gab schon Ende 1940 Pläne, die Insel einzunehmen (Operation Workshop), allerdings wurden diese wieder verworfen, da die Luftwaffen der Achsenmächte die Luftherrschaft in dieser Region innehatte.
Die Insel rückte erst nach der Kapitulation der Achsentruppen im Mai 1943 in Tunesien wieder in den Blickpunkt der Alliierten: Die Installation einer Radaranlage und die Anlage eines Flugplatzes auf der Insel wurde als ernsthafte Gefahr für die geplante Invasion Siziliens betrachtet. Ausserdem bestand zu dem Zeitpunkt die Möglichkeit eines vorbereitenden Bombardements gegenüber den verstärkten Verteidigungsanlagen der Insel.
Die intensiven, zehn Tage andauernden Luftbombardements schwächten die Verteidigung der Insel deutlich. Als darauf britische Streitkräfte auf der Insel landeten, ergab sich die stationierte italienische Garnison. Nach einer Abschätzung von Solly Zuckerman wurde die Effektivität der Verteidigungsmassnahmen der Insel auf 47 Prozent reduziert. Die Leichtigkeit dieser Operation führte zu einer optimistischen Annahme über die Effektivität von Bombardements, die bis dahin in der Realität so noch nicht beobachtet werden konnte.
Auch die italienischen Garnisonen der nahe gelegenen Inseln Linosa und Lampedusa fielen sehr rasch. Dies machte den Weg für die Invasion Siziliens einen Monat später frei.
Unternehmen Zitadelle (05.07.1943 – 16.07.1943)
Unternehmen Zitadelle (russische Bezeichnung: Курская битва „Schlacht von Kursk“) war der deutsche Deckname für den Angriff auf den sowjetischen Frontbogen um die russische Stadt Kursk während des Zweiten Weltkrieges im Sommer 1943. Das Unternehmen gilt als letzte deutsche Grossoffensive im Krieg gegen die Sowjetunion und fand in der Zeit vom 5. bis zum 16. Juli 1943 statt.
Sie wird auch als Schlacht bei Kursk, Panzerschlacht um Kursk oder Schlacht im Kursker Bogen bezeichnet. Auf sowjetischer Seite wurden unter dieser Bezeichnung auch die nachfolgenden Operationen zusammengefasst, die langfristiger und in grösserem Massstab angelegt waren als die deutschen Offensivbemühungen (Orjoler und die Belgorod-Charkower Operation). Sie war die grösste Landschlacht sowie eine der grössten Luftschlachten der Geschichte. Im Rahmen des „Unternehmens Zitadelle“ fand bei der Ortschaft Prochorowka eine Panzerschlacht statt, die als grösste der Geschichte gilt.
Lage und Planung
Militärische Lage im Frühjahr 1943
Jahreswechsel und Frühjahr 1943 an der deutschen Ostfront waren geprägt von der schweren Niederlage von Stalingrad und dem darauffolgenden Sieg von Charkow. Trotzdem befand sich die Wehrmacht bereits in der Defensive. Ihren fast 160, teilweise sehr geschwächten, Divisionen standen auf der nach dem Stillstand der Winterkämpfe 2500 Kilometer langen Front fast 400 Verbände der Roten Armee gegenüber. Es drohte ein Verlust der Initiative und so die Gefahr, in eine Abnutzungsschlacht mit der personell und materiell überlegenen Roten Armee zu geraten, die zwar in den vorangegangenen Kriegsjahren bereits rund 11 Millionen Mann Verluste hinzunehmen hatte, aber gleichwohl ständig stärker wurde.
Er entstand nach dem Ende der Schlacht um Stalingrad und der deutschen Rückeroberung von Charkow. Nach diesem begrenzten Sieg der Wehrmacht erstarrte die Front und die Rote Armee konzentrierte starke Kräfte im „Kursker Bogen“.

Die Sowjetunion hatte in den vorangegangenen beiden Kriegsjahren nach den anfänglichen Rückschlägen alle Kräfte mobilisiert. Das ganze Land arbeitete – zentralistisch geführt – für die Front. Nahezu die gesamte Industrie war auf die Kriegsproduktion umgestellt worden. Auch die in den ersten Kriegsmonaten erfolgreich ins Hinterland evakuierten Rüstungsbetriebe produzierten eine ständig steigende Zahl von Panzern, Flugzeugen und Geschützen. Hinzu kamen bedeutende Waffen- und Ausrüstungs-lieferungen durch die Vereinigten Staaten und Grossbritannien im Rahmen des Lend-Lease-Abkommens. Zudem standen trotz der vorangegangenen enormen Verluste Millionen potenzieller Rekruten im wehrpflichtigen Alter zur Verfügung. Es war damit nur eine Frage der Zeit, wann die im Vergleich mit Deutschland grösseren Ressourcen und vor allem die immer stärker werdende Kriegsindustrie den Ausschlag zugunsten der Sowjetunion geben würden. Mit der wachsenden materiellen Stärke hatten sich auch die Fähigkeiten der sowjetischen Streitkräfte auf dem Gefechtsfeld verbessert, insbesondere hinsichtlich strategischer Operationen. Es wurden schlagkräftige Panzer- und Luftarmeen geschaffen, die der zu diesem Zeitpunkt immer noch gut ausgerüsteten und erfahrenen Wehrmacht erfolgreich begegneten. Die Qualität des Führungspersonals hatte stark zugenommen. Die blutigen Vorkriegssäuberungen im Offizierskorps der Roten Armee waren zwar mit verantwortlich für die verheerenden Niederlagen zu Kriegsbeginn, hatten aber den Weg für eine jüngere kommunistisch erzogene Generation freigemacht.
Vor allem in den höheren Führungsebenen kamen nun Offiziere und Generäle zum Einsatz, die im Durchschnitt fast zwanzig Jahre jünger waren als ihre deutschen Kontrahenten. Sie hatten ihr Handwerk in der Praxis gelernt, am Vorbild erfolgreicher Wehrmachtsoperationen. Jetzt setzten sie verstärkt auf eine aktive, dynamische Kriegführung und die umfassende Täuschung des Gegners. Zudem gab man nun endlich die 1941/42 vielerorts übliche Praxis der unkoordinierten Frontalangriffe auf, die zu enormen Verlusten der Roten Armee geführt hatten.
Das deutsche Oberkommando verkannte diese dramatische Entwicklung weitgehend; allen voran Hitler, der sich in der Bewertung der eigenen Möglichkeiten durch den vorangegangenen Erfolg der SS-Divisionen bei der Rückeroberung von Charkow bestärkt sah und den Gegner nach wie vor unterschätzte. Obwohl einige Stimmen für eine abwartende Haltung und die Vorbereitung einer Gegenoffensive gegen einen früher oder später zwangsläufig erfolgenden Grossangriff der Roten Armee plädierten, setzten sich letztlich die Befürworter einer eigenen deutschen Sommeroffensive durch. Insbesondere Hitler, der angesichts der politischen und militärischen Entwicklung dringend einen überzeugenden Sieg brauchte, unterstützte ein aggressives Vorgehen. So äusserte er mehrmals, er habe angesichts der sich anbahnenden Entwicklung auf anderen Kriegsschauplätzen keine Zeit, auf Stalin zu warten.
Ein naheliegendes Ziel einer begrenzten deutschen Sommeroffensive war der „Kursker Bogen“. Dabei handelte es sich um einen Frontvorsprung der Roten Armee, der durch die Kämpfe Anfang 1943 entstanden war und tief in die deutschen Linien hineinreichte (siehe auch obenstehenden Frontverlauf).
Das Ziel des Unternehmens Zitadelle bestand folglich darin, die starken sowjetischen Kräfte, welche sich in diesem Grossraum aufhielten, in einer schnellen Zangenbewegung zu binden und eventuell einzukesseln, um sie anschliessend aufzureiben. Dadurch wären der Sowjetunion die Kräfte für eine Grossoffensive genommen worden. Anschliessend wollte man möglichst die Initiative an der Ostfront zurückgewinnen. Daher war das Unternehmen zwar eine Offensive, sie diente jedoch zur eigenen Verteidigung und sollte die Sowjetunion an ihrem Vormarsch hindern. Der Roten Armee sollten dabei so grosse Verluste zugefügt werden, dass zumindest für die folgenden Monate mit keinen Grossangriffen auf die deutsche Front mehr zu rechnen sein würde. Das deutsche Oberkommando hoffte zudem, durch die beabsichtigte Frontverkürzung mindestens zehn gepanzerte Verbände freisetzen zu können. Diese Truppen sollten auf anderen Kriegsschauplätzen, vor allem gegen die drohende Invasion in Italien und Westeuropa, eingesetzt werden. Damit sollte zum ersten Mal eine echte strategische Reserve geschaffen werden. Ziel der Wehrmachtführung war es nunmehr, den Alliierten so erfolgreich Widerstand zu leisten, dass diese zu einem Frieden bereit sein würden, der zumindest einen Teil der zuvor eroberten Gebiete bei Deutschland belassen würde.
Deutscher Offensivplan
Der Operationsplan basierte auf einer Idee des Befehlshabers der Heeresgruppe Süd, Generalfeldmarschall Erich von Manstein, die dieser bereits unmittelbar nach der erfolgreichen Operation zur Rückeroberung von Charkow entwickelt hatte, und wurde generalstabsmässig durch das Oberkommando des Heeres unter Leitung des Generalstabschefs Kurt Zeitzler ausgearbeitet. Der Plan erhielt den Decknamen „Unternehmen Zitadelle“ und wurde in den Befehlen des OKH Nr. 5 vom 13. März 1943 und Nr. 6 vom 15. April 1943 festgeschrieben. Der „Kursker Bogen“ in der Frontlinie hatte eine ungefähre Seitenlänge von 200 Kilometern und eine Tiefe von bis zu 150 Kilometern. Die Planung sah vor, am Fuss des Bogens beidseitig zu einer Offensive überzugehen, die alle im Frontvorsprung versammelten, sowjetischen Truppen von ihrer Hauptfront abschneiden würde. Das operative Ziel bildete die Stadt Kursk, in der sich die beiden Angriffsspitzen am 5./6. Tag der Offensive treffen sollten. Nach erfolgtem Durchbruchsollten in der zweiten Phase die eingekesselten sowjetischen Truppen und ihre Reserven – insgesamt acht bis zehn Armeen – vernichtet werden. Der Plan war konventionell, zielte auf das Herbeiführen einer klassischen Kesselschlacht ab und entsprach somit dem unter dem Synonym „Blitzkrieg“ bekannten Vorgehen in der Vergangenheit. Mit einem Überraschungsmoment konnte deshalb kaum gerechnet werden. Der Erfolg sollte vor allem durch den konzentrierten Einsatz von gepanzerten Truppen und neuen Waffensystemen in beiden Stossrichtungen erzwungen werden.
Für das Unternehmen wurde im Norden bei der Heeresgruppe Mitte unter Generalfeldmarschall Günther von Kluge die 9. Armee (General Walter Model) mit 22 Divisionen, davon acht Panzer- und Panzergrenadierdivisionen, bereitgestellt. Die Heeresgruppe Süd unter von Manstein konzentrierte im südlichen Abschnitt die 4. Panzerarmee und eine Armeeabteilung („Kempf“) mit insgesamt 19 Divisionen, davon neun Panzer- und Panzergrenadier-Divisionen. Zur 4. Panzerarmee unter Hermann Hoth gehörte das II. SS-Panzerkorps unter Obergruppenführer Paul Hausser mit den drei Panzergrenadier-Divisionen „Leibstandarte SS Adolf Hitler“, „Das Reich“ und „Totenkopf“. Die ebenfalls bereitgestellten Luftflotten 4 und 6, die eng mit den Bodenkräften zusammenwirken sollten, wurden durch Fliegerkräfte von anderen Frontabschnitten verstärkt. Fast 2000 Flugzeuge, darunter verbesserte Muster der Typen He 111 (Bomber), Focke-Wulf Fw 190 (Jäger/Jagdbomber) und Hs 129 (Erdkampfflugzeug), sollten den Angriff der Bodentruppen unterstützen.
Trotz dieser gewaltigen Truppenkonzentration litt der Plan im Kern an einem entscheidenden Mangel, der bereits zum Scheitern der grossangelegten Offensiven des Jahres 1942 in den Kaukasus und nach Stalingrad geführt hatte: Es fehlten schlicht die notwendi-gen Kräfte und Mittel zu seiner erfolgreichen Umsetzung. So mangelte es insbesondere an den Truppen, die laut Operationsbefehl Nr. 6 vom 15. April 1943 zur Deckung der Flanken der Angriffskeile herangeführt werden sollten. An die laut Planung auf den Vorstoss folgende Abwehrschlacht an den Seiten der angreifenden Verbände war daher nicht zu denken, so dass sich diese Truppen selbst dieser Aufgabe statt des essenziell wichtigen Vordringens würden widmen müssen. Damit mussten diese entscheidenden Kräfte an Schlagkraft einbüssen und in Abnutzungsgefechte geraten, was letztlich tatsächlich zum Scheitern des Unternehmens führte.
Ein Teil der Verantwortlichen im Oberkommando und an der Front war sich dieser Diskrepanz zwischen Plan und Realität bewusst. Einige waren davon überzeugt, dass sich das Zeitfenster für den Erfolg des bereits mehrfach verschobenen Unternehmens angesichts des stärker gewordenen Gegners, der in gut ausgebauten und tief gestaffelten Verteidigungssystemen auf den Angriff wartete, bereits geschlossen hatte, konnten sich jedoch gegen die Befürworter und insbesondere Hitler als Oberbefehlshaber der Wehrmacht nicht durchsetzen. Hitler sah die Panzerwaffe als entscheidenden Faktor auf dem Gefechtsfeld an. Er erwartete daher, dass sich der Erfolg in jedem Fall durch den massiven Einsatz der neuen Panzermodelle einstellen würde.
Vermutete Informationslecks
Die Angriffspläne des Unternehmens waren – einigen Quellen zufolge – den Sowjets durch den Spion Werther aus den Reihen des OKW vorzeitig bekannt. Es wird vermutet, dass die Berichte aus dem OKW über die Schweiz durch Rudolf Rössler nach Moskau gelangten. Wer sich hinter dem Decknamen Werther tatsächlich verbarg, bleibt bis heute ungeklärt, spekuliert wird über eine NS-feindliche Offiziersgruppe im Führerhauptquartier, u. a. Wilhelm Scheidt, Mitarbeiter beim Sonderbeauftragten für die militärische Geschichtsschreibung im Führerhauptquartier, und Walter Scherff. Bernd Ruland verdächtigt in seinem Buch „Die Augen Moskaus“ die Mitarbeiter der Fernschreibzentrale der Wehrmacht in Berlin und den britischen Geheimdienst durch die Entzifferung der Enigma-Verschlüsselung. Ebenso wurden Informationen aus dem englischen Bletchley Park über John Cairncross an die Sowjetunion geliefert. Alfred Jodl, der damalige Chef des Wehrmachtführungsstabes, sagte im Nürnberger Prozess aus, dass die Nachrichten schneller in Moskau gewesen seien als auf seinem Schreibtisch.
Verzögerung
Gegner und Befürworter
Im ursprünglichen Operationsbefehl zu Zitadelle wurde als frühester und zugleich idealer Angriffstermin der 3. Mai genannt. Ein Beginn bereits im April kam durch die frühjährliche Schlammperiode (Rasputiza), in der alle Operationen an der Ostfront auf den unpassierbar gewordenen Strassen und Wegen unmöglich wurden, von vornherein nicht ernsthaft in Betracht. Während der im Frühjahr 1943 länger als erwartet anhaltenden witterungsbedingten Bewegungsunfähigkeit entwickelte sich Widerstand gegen den ursprünglichen Operationsplan. Insbesondere Generaloberst Heinz Guderian, als Inspekteur der Panzertruppen Beauftragter für die Einführung der neuen Panzermodelle in die Truppe, und von Manstein reklamierten später in ihren Memoiren eine Gegnerschaft für sich: Man habe erkannt, dass die Zeit gegen die deutschen Truppen arbeitete. Unklar ist, inwiefern diese Angaben zutreffen, die die Schuld an der letztlichen Niederlage vor allem Hitler zuschreiben und die Generalität mit einigen Ausnahmen exkulpieren.
Der massgebliche Urheber des Operationsplans, Generaloberst Kurt Zeitzler, Generalstabschef des Heeres, setzte auf Hitlers Unterstützung, um die zunehmende Zahl der Kritiker zum Schweigen zu bringen. Hitler selbst schien schwankend geworden zu sein, nachdem ihm Model Luftaufnahmen vorgelegt hatte, auf denen zu sehen war, dass die sowjetische Seite einen deutschen Angriff in genau dieser Form erwartete, umfangreiche Verteidigungsstellungen anlegte und starke Kräfte konzentrierte. Der Termin vom 3. Mai wurde durch Weisung Hitlers am 29. April verschoben, da ihm die Panzerausrüstung noch nicht ausreichend erschien. Ein schneller Durchstoss durch das Stellungssystem als Voraussetzung für eine spätere Kesselbildung erschien ihm fraglich. Zur Klärung der aufgekommenen Fragen berief Hitler am 4. Mai 1943 in München ein Treffen ein.
Die Kritiker des Plans wiesen auf die bereits viel zu weit fortgeschrittenen Verteidigungsanstrengungen des Gegners hin. Angesichts der zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossenen Vorbereitungen habe eine Offensive in dieser Form kaum Aussicht auf Erfolg. Zeitzler, unterstützt durch den Befehlshaber der Heeresgruppe Mitte, Feldmarschall von Kluge, vertrat dagegen die Meinung, die sowjetische Verteidigung könne den neuen Panzern, die die Spitzen der Angriffskeile bilden sollten, letztlich nicht widerstehen. Guderian und der ebenfalls anwesende Rüstungsminister Albert Speer versuchten im Gegenzug offenbar, die reale Situation zu verdeutlichen: Zu den Schwierigkeiten in der Produktion und der ungenügenden technischen Zuverlässigkeit der neuen Modelle kam die notwendige Zeit für die Umstellung der Truppe, die nicht nur die neue Technik, sondern auch veränderte Einsatzgrundsätze meistern musste. Guderian war seit seiner Rückkehr in den aktiven Dienst Anfang 1943 mit Umstrukturierung und Teil-Neuaufbau der deutschen Panzertruppe befasst. Diese befand sich durch die Verluste an der Front, vor allem jedoch aufgrund schlechten Managements in der Entwicklung, Kompetenzgerangels zwischen den Waffengattungen und einer ineffektiven Einsatzdoktrin in einem schlechten Zustand.
Zu grösseren Angriffsoperationen war die Truppe im Frühjahr, so seine spätere Darstellung, praktisch nicht in der Lage. Der Umbau hatte Ende April 1943 gerade erst begonnen. Unabhängig von der beschleunigten Umstrukturierung der Kernverbände war die Wehrmacht nach den verlustreichen Kämpfen am Jahresanfang im Mai noch nicht wieder bereit, weitreichende Angriffsoperationen durchzuführen. Dieser Tatsache war bereits der Stopp der Kämpfe nach der erfolgreichen Rückeroberung von Charkow geschuldet, bei der unter anderem die SS-Panzergrenadier-Division LSSAH in schweren Strassenkämpfen fast die Hälfte ihrer Kampfstärke verloren hatte.
Guderian vertrat den Standpunkt, es sei sinnvoller, die neuen Panzer in den bevorstehenden Auseinandersetzungen an der Westfront einzusetzen oder wenigstens die begrenzten Kräfte nur an einer Stelle zu einem Durchbruch auf Kursk zu konzentrieren, statt sie in einem Frontalangriff auf die sowjetische Verteidigung, die genau diese Vorgehensweise erwartete, zu verschwenden.
Zeitzler und von Kluge traten dieser Ansicht entgegen und spekulierten dabei in ihrer Argumentation anscheinend auf Hitlers Technikbegeisterung. Insbesondere von Kluge spielte die Produktionsschwierigkeiten herunter und stellte demgegenüber die Vorteile der neuen Panzer heraus, die sich auf dem Schlachtfeld ergeben würden. Guderian, seit langem eine persönliche Abneigung gegen von Kluge hegend, opponierte lebhaft dagegen. Die Spannungen zwischen den beiden Kontrahenten eskalierten sogar in einer durch von Kluge gegenüber Guderian ausgesprochenen Duellforderung, in der er Hitler fragte, ihm dabei als Sekundant zu dienen. Den Anwesenden gelang es nur mit Mühe, die beiden Kontrahenten zu beruhigen.
Hitler hielt sich, wie häufig, zunächst aus den Streitigkeiten heraus und ergriff keine Partei. Obwohl er die Einwände nachvollziehen konnte und die Produktionsschwierigkeiten als gegeben hinnahm, war er angesichts der erwarteten Vorteile einer erfolgreichen Operation nicht bereit, Zitadelle abzusagen oder einen definitiven Beginn festzulegen, bevor eine ausreichende Menge der neuen Panzer zur Verfügung stand. Der Plan blieb damit in Kraft. Operative Vorbereitungen, Truppenkonzentrationen und die Zuführung neuer Waffen liefen in den nächsten Wochen weiter. Als neuer Termin wurde der 12. Juni genannt.
Einfluss der strategischen Lage und die Partisanenbekämpfung im Gebiet Orjol
Nach dem Fall von Tunesien an alliierte Truppen und dem kompletten Verlust der Heeresgruppe Afrika – einer militärischen Katastrophe, die rein zahlenmässig in ihrem Ausmass mit der von Stalingrad vergleichbar war – verschob Hitler am 13. Mai angesichts der nun realen Bedrohung des deutsch besetzten Griechenlands oder gar Italiens durch eine alliierte Landungsoperation den Start von Zitadelle auf Ende Juni. Hitler wollte sich zunächst Sicherheit verschaffen, ob das faschistische Italien nach dem Verlust seiner nordafrikanischen Kolonien und im Angesicht einer echten Bedrohung den Krieg fortsetzen würde, bevor er einen massiven Truppeneinsatz an der Ostfront genehmigte.
Die Entwicklung in Nordafrika war jedoch nicht der einzige Faktor: Entscheidend waren vor allem die massiven logistischen Schwierigkeiten im Raum der Heeresgruppe Mitte, die durch umfangreiche Partisanenaktivitäten in der Umgebung von Orjol verursacht wurden, sowie weitere Forderungen nach Verstärkungen. Insbesondere der Kommandeur der 9. Armee und Befehlshaber des nördlichen Angriffsflügels Walter Model tat sich diesbezüglich hervor. Obwohl sich Model gegenüber Hitler immer wieder für Zitadelle ausgesprochen hat, wurde dieses Verhalten im Nachhinein häufig als Indiz für eine versteckte Gegnerschaft gedeutet.
Die in den dichten Wäldern östlich des Flusses Desna und im rückwärtigen Raum hinter der 9. Armee und 2. Panzerarmee operierenden Partisanenverbände wurden zentral vom sowjetischen Oberkommando geführt und massiv aus der Luft mit Waffen, Ausrüstung und Personal unterstützt. Sie umfassten nach heutigen Schätzungen im Frühjahr mehr als 100.000 Mann. Ihre Angriffe und Sabotagen hatten solche Ausmasse angenommen, dass die ohnehin schon unzureichenden Eisenbahnkapazitäten weiter eingeschränkt wurden. Die Eisenbahnlinien Brjansk-Konotop und Brjansk-Shirekina sowie alle Strassen südlich von Brjansk mussten zeitweise komplett für den Verkehr gesperrt werden. Dies betraf sogar die Hauptverkehrsstrasse von Brjansk nach Orjol, welche zudem nur in geschlossenen Konvois benutzt werden konnte. Darin bestand ein echtes Risiko für die Durchführung von Zitadelle, für die nicht nur Verbindungsstrassen auf der Nord-Süd-Achse ausgebaut wurden, sondern sogar das Brückensystem erweitert werden musste, um die neuen schweren Ferdinand-Panzerjäger an die Front zu transportieren. Gegen die Partisanen starteten die Deutschen im Mai gross angelegte mehrwöchige Operationen. Auch mehrere für Zitadelle vorgesehene Fronteinheiten – darunter mit der 4. Panzer-Division ein besonders schlagkräftiger Verband – waren beteiligt. Diese Einheiten benötigten später, nach Abschluss der unter dem Decknamen Unternehmen Zigeunerbaron geführten weitgehend erfolglosen Operation Zeit für Rückführung und Auffrischung. Die 9. Armee gab schliesslich als frühestmöglichen Zeitpunkt für den Beginn der Offensive den 19. Juli an.
Die Heeresgruppe Süd befand sich ebenfalls in Auffrischung und Umstrukturierung, so dass bei ihr eine Bereitschaft zum Angriff noch im Juni fraglich erscheinen musste.
Neuere Erkenntnisse (vgl. vor allem Roman Töppel) legen den Schluss nahe, dass vornehmlich die strategische Lage, die realen Schwierigkeiten der Fronttruppe und insbesondere die logistischen Probleme bei der Vorbereitung und nicht das später vielfach kritisierte Warten Hitlers auf neue Panzermodelle die Verzögerung von Zitadelle verursachten. Allerdings erfolgte die letzte Verschiebung erst Ende Juni, um die Panzergrenadier-Division Grossdeutschland mit einem grösseren Kontingent Panther auszurüsten.
Vergleich der Armeen
Für den Angriff hatte die Wehrmacht drei Armeen und einen grossen Teil der an der Ostfront stationierten Panzer zur Verfügung. Die 9. Armee unter Model hatte 335.000 Mann (davon 223.000 kämpfende Truppen), die 4. Panzerarmee unter Hoth hatte 223.907 Mann (davon 149.271 kämpfende Truppen) und die Armeeabteilung Kempf hatte rund 100.000 Mann (davon 66.000 kämpfende Truppen). Zusammen waren dies 778.907 Mann, wovon 518.271 zu den kämpfenden Truppen gehörten.
Die Rote Armee hatte zwei Fronten (vergleichbar mit deutschen Heeresgruppen) für die Verteidigung in Stellung gebracht und eine weitere dahinter als Reserve. Die Zentralfront unter Konstantin Rokossowski hatte 711.575 Mann (davon 510.983 kämpfende Truppen), Watutins Woronescher Front hatte 625.591 Mann (davon 446.236 kämpfende Truppen) und die Steppenfront unter Iwan Konew stellte 573.195 Mann (davon 449.133 kämpfende Truppen). Diese drei Fronten zusammen hatten 1.910.361 Mann, wovon 1.426.352 Mann zu den kämpfenden Truppen gehörten.
Zu Beginn des sowjetischen Gegenangriffs im Raum Orjol wurde die deutsche 2. Panzerarmee von zwei weiteren Fronten angegriffen. Die Brjansker- und Westfront erhöhten die Mannstärke der Roten Armee auf 2.629.458. Die Wehrmachtverbände hatten mit den nun vier Armeen insgesamt ungefähr 950.000 Mann im Raum Kursk.
Panzer der Wehrmacht
Das Unternehmen Zitadelle markierte einen Wendepunkt hinsichtlich der technischen Überlegenheit sowjetischer Panzermodelle. Mit Begines Krieges gegen die Sowjetunion erkannte die Wehrmacht, dass sie die Rote Armee unterschätzt hatte. Die neueren sowjetischen Panzermodelle waren zu diesem Zeitpunkt den deutschen weit überlegen. Der neue T-34 mit seiner modernen Schrägpanzerung war nahezu unzerstörbar für die damaligen deutschen Panzer sowie die meisten Panzerabwehrkanonen. Diese technische Dominanz der sowjetischen Modelle blieb noch für lange Zeit erhalten. Während die Führung der Roten Armee in der Folgezeit kaum neue Panzer entwickeln liess, legte die Wehrmacht dagegen grossen Wert auf die Entwicklung neuer Panzermodelle sowie die Verbesserung schon existierender, und so führte das Versäumnis der sowjetischen Führung, ihre Panzerwaffe weiter-zuentwickeln, während des Unternehmens Zitadelle zu einer starken technischen Überlegenheit der deutschen Panzerverbände. Das zeigte sich besonders in Duellsituationen und führte in der Folge zu einer verstärkten sowjetischen Forschung im Bereich ihrer Panzerwaffe. Nach Steven Zaloga wurde von der sowjetischen Führung die Weiterentwicklung des T-34 Ende 1941 eingefroren und entschieden keine neuen Panzermodelle zu bauen, um den Produktionsausstoss nicht zu vermindern.
Zu Beginn der Offensive bei Kursk waren die deutschen Panzerdivisionen standardmässig immer noch mit dem Panzerkampfwagen IV ausgerüstet. Allerdings handelte es sich nur bei einigen dieser Fahrzeuge um das verbesserte Modell F2 mit der 75-mm-Panzer-kanone L/43, die wirkungsvoll genug war, das sowjetische Standardmodell T-34/76 und den schweren KW-1 auf grössere Entfernungen zu vernichten. Grösstenteils kam immer noch die mit der 75-mm-Stummel-KwK bewaffnete Ausführung F1 zum Einsatz, die gegen die neuen sowjetischen Panzer nahezu wirkungslos war.
In grosser Stückzahl kam auch der Panzerkampfwagen III mit seiner 50-mm-Kanone L/60 zum Einsatz. Trotz ständiger Verbesse-rungen seit Kriegsbeginn war dieser Panzer dem sowjetischen T-34 nach wie vor unterlegen.
Der als Antwort auf den T-34 entwickelte mittlere Panzer V (Panther) war eine gute Synthese aus Bewaffnung, Panzerung und Beweglichkeit. Die um 55 Grad geneigte 80 mm starke Frontpanzerung bot einen guten Schutz. Der sowjetische mittlere Standardpanzer T-34 beispielsweise war nicht fähig, die Frontpanzerung des Panthers zu durchschlagen. Die übereilt den Angriffsverbänden zugeführten Panther des Typs „D“ waren manövrierfähig und mit leistungsfähigen Funkgeräten ausgerüstet, fingen jedoch leicht Feuer. Sämtliche 200 Panther waren in den zwei Abteilungen der Panzerbrigade 10 zusammengefasst, die der Panzergrenadier-Division „Grossdeutschland“ unterstellt war. Laut Guderian (Erinnerungen eines Soldaten) waren jedoch das grösste Problem die stark beanspruchten Seitenvorgelege (Untersetzungsgetriebe hinter den Treibrädern vorn), die als einfache Stirnradgetriebe ausgeführt waren. Wie unausgereift die neuen Panzer waren, zeigte sich bereits vor Beginn der eigentlichen Schlacht, als 45 Panther bei ihrem Marsch in die Bereitstellungsräume aufgrund technischer Probleme ausfielen. In der Schlacht fielen Panther ständig auch ohne Feindeinwirkung aus und mussten in Werkstätten geschleppt werden. So kam es, dass fast über die gesamte Zeit der Schlacht nie mehr als 40 dieser Panzer gleichzeitig im Einsatz waren. Die Panzerbrigade 10 war auf deutscher Seite der Verband mit der höchsten Anzahl an verlorenen Panzern. Trotz mangelnder Zuverlässigkeit zeigte der Panzer V sein Potenzial und war laut deutschen Berichten für 267 vernichtete Feindpanzer verantwortlich. Nachdem die anfänglichen Probleme beseitigt waren, wurde dieser Panzer zu einem der, wenn nicht dem, besten Panzer des Zweiten Weltkrieges.
Der als schwerer (etwa 55 Tonnen) Durchbruchspanzer konzipierte Pz-VI (Tiger) verfügte über eine 88-mm-Panzerkanone (KwK 36), die im Sommer 1943 alle gegnerischen Panzer bereits auf grosse Entfernungen wirkungsvoll bekämpfen konnte (Durchschlagsleistung: 90 mm auf 2300 m). Hinzu kam eine starke Frontpanzerung, die zu diesem Zeitpunkt ungeachtet der klassischen, rechtwinkligen Bauweise kaum zu durchdringen war. Auch die Seiten- und Heckpanzerung konnte nur aus sehr geringen Distanzen durchschlagen werden Hinzu kam ein psychologischer Effekt auf gegnerische Truppen, der in vielen nachfolgenden Berichten zum Unternehmen Zitadelle zu einer starken Fokussierung auf diesen Panzertyp führte.
In der sowjetischen Memoirenliteratur ist in diesem Zusammenhang stets von Tiger-Panzern die Rede – offensichtlich wurde auch der verbesserte Pz-IV aufgrund seiner ähnlichen Silhouette als Tiger identifiziert. Mit dafür verantwortlich war wohl der damals bei den neuesten Modellen des Pz-IV (Ausf. G/H) seitlich angebrachte, grossflächige Kettenschutz (Schürze). Liest man sowjetische Schlachtberichte, wimmelte es auf dem Gefechtsfeld vor Kursk nur so von Tigern und Panthern. Tatsächlich verfügten im Süden die Panzergrenadier-Division „Grossdeutschland“ sowie die drei Divisionen des II. SS-Panzerkorps lediglich über je eine Tiger-Kompanie mit jeweils 13 bis 15 Panzern. Hinzu kam die schwere Heeres-Panzer-Abteilung 503 mit 45 Tigern. Auf der Nordseite standen nur zwei Tiger-Kompanien in der schweren Heeres-Abteilung 505 zur Verfügung. Insgesamt kamen im Rahmen von Zitadelle nur 146 Tiger zum Einsatz, somit etwa 5 % der deutschen Panzerkräfte. Die wenigen Tiger wurden kontinuierlich in den Angriffsschwerpunkten zur Erzwingung des Durchbruchs und zur Abwehr der Gegenangriffe, fast immer an der Spitze der Panzerkeile, eingesetzt und erwiesen sich als besonders kampfstark. War ein Tiger jedoch erst einmal isoliert, konnte er auf sich allein gestellt kaum etwas gegen die Übermacht von sowjetischer Infanterie und T-34 ausrichten.
Weitere deutsche Panzer
Neben Panther und Tiger wurden auch 90 schwere Jagdpanzer „Elefant/Ferdinand“, einige Sturmpanzer IV („Brummbär“), Sturmgeschütz III sowie Jagdpanzer des Modells „Hornisse“ in geringer Stückzahl in den selbstständigen Abteilungen der 9. Armee eingesetzt. Die 653. und 654. schwere Panzerjäger-Abteilung erhielten jeweils 45 Exemplare des „Ferdinand“. Dieser Jagdpanzer entstand als Notlösung auf Chassis des Porsche-Entwurfs des Tiger. Er verfügte über eine enorme Panzerung und war durch Feindpanzer oder PaK fast nicht zu zerstören. Diese erhöhte Panzerung führte zu einem stattlichen Gewicht von 65 Tonnen. Das Fehlen eines Maschinengewehrs machte diesen schwerfälligen Jagdpanzer jedoch sehr anfällig für feindliche Infanterie. Des Weiteren litt der improvisierte Panzer an seiner mangelnden Beweglichkeit und verzeichnete viele temporäre Ausfälle durch seinen komplizierten Antrieb. Im Panzergefecht war der „Ferdinand“ aber äusserst effektiv. Er war mit der langen 8,8-cm-KwK 43 ausgerüstet, der gleichen Kanone, die im späteren Tiger II zum Einsatz kam. Diese Kanone war 1,5 Meter länger als die des „Tigers“ und konnte feindliche T-34 bis auf 3,6 km Entfernung zerstören. Die beiden Abteilungen vermeldeten um die 500 zerstörte Feindpanzer.
Weiterhin befanden sich vereinzelt auch noch Panzer II in den Beständen der Panzerverbände, die nunmehr als Aufklärungspanzer genutzt wurden.
Sowjetische Panzermodelle
T-34 – Standardpanzer der Roten Armee
Der bei weitem überwiegende Teil der sowjetischen Panzertruppen war im Sommer 1943 mit dem T-34 ausgerüstet, der in riesigen Stückzahlen gebaut wurde. Der T-34/76 war eine gelungene Kombination aus Panzerung, Beweglichkeit und Bewaffnung. Er hatte sich zu Kriegsbeginn gegenüber den deutschen Kampfpanzern als überlegen gezeigt, hatte diese Überlegenheit jedoch im Sommer 1943 gegen die verbesserten Pz-IV mit ihrer 75-mm-Kanone und die neuen Panther und Tiger verloren. Entscheidende Nachteile stellten zu diesem Zeitpunkt auch die Doppelbelastung des Kommandanten dar, der zugleich als Richtschütze fungierte, sowie die fehlenden Funkgeräte, die bei den deutschen Panzern zur Standardausstattung gehörten. Dadurch verringerte sich die Einsatz-ffektivität.
Weitere Panzer der Roten Armee und Bewaffnung
Der ebenfalls noch in grösseren Stückzahlen vorhandene leichte T-70 war zur Unterstützung der Infanterie gedacht und konnte nicht gegen die aktuellen deutschen Modelle bestehen.
Der schwere sowjetische Panzer KW-1 besass zwar eine starke Panzerung, war aber mittlerweile durch die Entwicklungen der Panzertechnik überholt. Er war insbesondere zu langsam und konnte deshalb leicht ausmanövriert und an seinen Seiten abgeschossen werden. Die als Konsequenz alliierter Waffenlieferungen bei den sowjetischen Truppen zum Einsatz kommenden englischen Churchills oder die amerikanischen Shermans und Lees zeigten sich im direkten Gefecht den deutschen Modellen ebenfalls unterlegen.
Von den KW-2 waren nur noch wenige Exemplare vorhanden, die an strategisch wichtigen Punkten bereitgestellt wurden. An Bedeutung gewannen dagegen die schweren Jagd-/Sturmpanzer: Der 30 t schwere SU-122 (122-mm-Kanone) und der 45 t schwere SU-152 wurden erstmals in kleineren Stückzahlen eingesetzt, zumal letzterer, auch Sweroboj („Bestiendrescher“) genannt, mit seiner 152-mm-Kanone selbst stärkste deutsche Panzer ausser Gefecht setzen konnte.
Ein Novum im Krieg waren die erstmals eingesetzten sowjetischen PTAB-Bomben. Diese Streubomben mit Hohlladung wurden von Schlachtflugzeugen Il-2 abgeworfen und konnten eine grosse Fläche mit massenhaft kleinen aber für Panzer tödlichen Geschossen übersäen. Die deutsche Seite musste darauf mit einer Auflockerung ihrer Panzerformationen reagieren.
Erstmals eingesetzt wurde auch das Jagdflugzeug La-5FN und die 57-mm-Panzerabwehrkanone M1941 (SiS-2). Diese war 1941 aus der Produktion genommen worden, da die schwächere 76-mm-Divisionskanone Sis-3 zur Panzerbekämpfung ausreichte, und wurde nun gegen die stärkeren deutschen Panzer wieder produziert.
Gefechtstaktik
Entscheidend waren jedoch keinesfalls nur die reinen technischen Vor- und Nachteile der Konstruktionen beider Seiten. Viel wichtiger waren die Erfahrung und ein gutes Zusammenspiel der Panzerbesatzungen sowie ihre operative Führung.
Die sowjetischen Truppen profitierten anders als in der Vergangenheit von der in zwei Kriegsjahren gewachsenen Erfahrung und hatten nach den Erfolgen der letzten Monate auch die Hoffnung, den zuvor als unbesiegbar geltenden Gegner schlagen zu können. Darüber hinaus konnten sowjetische Verbände mit ihrem Verzicht auf eine starre Verteidigung Ausbildungs- und Erfahrungrückstände gegenüber den in beweglicher Kriegführung überlegenen deutschen Einheiten kompensieren. In späteren Kriegsberichten der deutschen Seite werden sehr häufig die hohe Tapferkeit und unglaubliche Opferbereitschaft der sowjetischen Panzerbesatzungen – auch im Angesicht einer drohenden Niederlage – hervorgehoben. Damit war die psychologische Komponente, die in der Vergangenheit für die Erfolge der „Blitzkrieg“-Durchbruchtaktik und das regelmässig folgende Zusammenbrechen des Widerstandes überrollter und eingekesselter Einheiten verantwortlich war, zum Zeitpunkt des Beginns von Zitadelle nahezu entwertet.
Planungen und Ziele der sowjetischen Seite
Der sowjetischen Führung war der Frontbogen um Kursk ebenso wenig entgangen wie der Deutschen. Durch intensive Nutzung von Luftaufklärung und den Einsatz von Agenten im deutschen Aufmarschgebiet wurden die Absichten des Gegners bald offensichtlich.
Bereits im März 1943 wurde durch die Stawka, dem sowjetischen Oberkommando unter direkter Führung Stalins, die grundlegende Absicht festgeschrieben. Danach hatte die Verteidigung des Kursker Frontvorsprungs das Ziel, die immer noch als enorm stark eingeschätzten Angriffskräfte des Gegners deutlich zu schwächen, um dann mit den Hauptkräften der verteidigenden Zentral- und der Woronescher Front, die durch frische Reserven verstärkt werden sollten, die deutsche Hauptgruppierung zu vernichten. Der Schlüssel zu diesem Ziel sollte ein tief gestaffeltes Verteidigungssystem und die Konzentration starker mobiler Reserven im Hinterland sein.
Zur Abwehr der deutschen Offensive begann man zunächst unter massiver Hinzuziehung der Zivilbevölkerung und von Pionieren, die besonders bedrohten Stellen durch ein tief gestaffeltes Stellungssystem mit insgesamt 5.000 Kilometern Laufgräben, unzähligen Bunkern und Feuerstellungen zu sichern und eine halbe Million Landminen zu legen. Pro Frontkilometer wurden bis zu 2.500 Minen gelegt. Durch die schnell wachsende Vegetation, vor allem ausgedehnte Sonnenblumen- und Kornfelder, waren die Minen im Sommer beim Angriffsbeginn kaum sichtbar.
Die Zentral- und die Woronescher Front wurden in kürzester Zeit personell auf volle Stärke gebracht und bevorzugt mit neuen Waffensystemen ausgerüstet, insbesondere mit Panzerabwehrmitteln und Pioniermaterial. Gleichzeitig wurden hinter dem bis zu 30 Kilometer tiefen statischen Verteidigungssystem grosse mobile Reserven, vor allem aus neu aufgestellten oder erweiterten Panzerverbänden, geschaffen, die mögliche Durchbrüche deutscher Truppen schon im Ansatz abfangen sollten. Die beiden sowjetischen Fronten „Woronesch“ und „Zentral“ verfügten nach neuesten Untersuchungen zu Beginn der Schlacht über rund 1,336 Millionen Soldaten, 3.444 Panzer und etwa 19.000 Geschütze.
Ausserdem wurden umfangreiche Reserven im Rücken des Kursker Brückenkopfes konzentriert. Durch die Bildung der neuen Steppenfront unter Marschall Iwan Konew stand eine strategische Reserve zur Verfügung, die nach der erwarteten Kräfteabnutzung des Gegners in der Verteidigung zum Gegenangriff übergehen sollte. Zu diesen Kräften gehörte mit der 5. Garde-Panzerarmee eine der fünf im Frühjahr 1943 neu geschaffenen Panzerarmeen. Befehlshaber war Generalleutnant Pawel Rotmistrow, der massgeblich an der Konzeption und Umstrukturierung der sowjetischen Panzertruppen in strategische Einsatz- und Offensivverbände beteiligt war.
Einen entscheidenden Vorteil stellte die Kenntnis des Angriffsplans dar. Bis heute ist unklar, ob dieser Vorteil durch klassische Aufklärung im gegnerischen Hinterland, durch einen sowjetischen Spionagering in der Schweiz oder vom englischen Geheimdienst, der den Codeschlüssel einer Heeresversion der deutschen Funkchiffriermaschine Enigma entschlüsselt hatte, geliefert wurde. Vermutlich waren es mehrere Quellen, wobei die mangelhafte deutsche Geheimhaltung, die gerade eine Konzentration des Gegners im „Kursker Bogen“ anstrebte, um möglichst viele Truppen in der geplanten Kesselschlacht zu vernichten, ihren Teil dazu beitrug.
Im Gegensatz zum deutschen Offensivplan, der eine Konzentration der Kräfte in den Angriffsabschnitten vorsah, jedoch die wichtige Verteidigung in den Abschnitten neben den Angriffskeilen in der Praxis nicht sicherstellen konnte und über keine echten operativen Reserven verfügte, setzte die sowjetische Seite bei ihrer Planung auf die quantitative Überlegenheit mit starken Reserven. Es wurden starke Anstrengungen unternommen, um die Qualität der Truppen, insbesondere der Führung der unteren Ebenen, zu verbessern. Der mehrfach verschobene Beginn des Unternehmens „Zitadelle“ sorgte auf diesem Gebiet für deutliche Verbesserungen. Neben der reinen Quantität stand auch die Qualität von Waffen und Ausrüstung im Blickpunkt. So wurde die Truppe beispielsweise verstärkt mit Funkgeräten ausgerüstet, die zur Standardausrüstung jedes deutschen Panzers gehörten. Dennoch bestand auch zu Beginn der Schlacht weiterhin ein deutlicher Qualitätsunterschied zu den deutschen Offensivkräften, insbesondere zu den im Süden aufmarschierten Elitedivisionen von Wehrmacht und Waffen-SS. Die Unterlegenheit des T-34/76 gegenüber fast allen deutschen Modellen, besonders den kampfwertgesteigerten Panzer IV sowie den neuen Panther und Tiger, führte im Verlauf der Kampfhandlungen zu teilweise verzweifelten und extremen Einsatzgrundsätzen. So wurden die Panzer notgedrungen als stationäre Feuerpunkte eingegraben und damit ihrer stärksten Fähigkeit, der Beweglichkeit, beraubt oder sollten versuchen, mit maximaler Geschwindigkeit die Distanz zum Gegner mit seinen weitreichenden und durchschlagskräftigen Waffen zu überbrücken und in dessen verwundbare Flanke zu gelangen. Letztere Taktik hatte im Gegensatz zu ersterer nur bedingt Aussicht auf Erfolg, da durch den massierten Einsatz und die fehlende Kommunikation zwischen den Panzern Führung und Koordination verloren gingen. Gleichwohl handelte es sich um einen aus dem Bewusstsein der Unterlegenheit geborenen Versuch, die erkannte Schwäche durch Opferbereitschaft in Verbindung mit zahlenmässiger Überlegenheit wettzumachen.
Mit der Verbesserung der militärischen Fähigkeiten wurden in der Zeit der Vorbereitung auf den Angriff grosse Anstrengungen zur ideologischen Schulung und Steigerung von Motivation und Kampfmoral der verteidigenden Truppen unternommen. Es wurde insbesondere versucht, jedem Offizier und Soldaten die Bedeutung der kommenden Schlacht und seines ganz persönlichen Einsatzes für den Ausgang des Krieges zu vermitteln und die patriotischen Gefühle zu stärken. Insbesondere sowjetische Publikationen betonen immer wieder die Bedeutung dieses Faktors für den späteren Erfolg. Unbestritten ist: Als der deutsche Angriff begann, traf er auf einen hochmotivierten Gegner.
Den entscheidenden Unterschied zu den deutschen Zielen macht die strategische Anlage der Stawka-Planungen deutlich: Die militärischen Planungen der sowjetischen Seite waren wesentlich weitreichender. Im Gegensatz zum Operationsplan „Zitadelle“ sollte das Auffangen des deutschen Angriffs im „Kursker Bogen“ nur den Auftakt zur weiträumigen strategischen Sommeroperation der sowjetischen Armee bilden, die die anschliessende Befreiung grosser Gebiete im Norden und Süden des Frontvorsprungs und den Vormarsch bis über den Dnepr beabsichtigte.
Zusammenfassend kann dennoch festgehalten werden, dass auch der sowjetische Plan, der die umfassende Vernichtung deutscher Kräfte beabsichtigte, die eigenen Möglichkeiten, vor allem im qualitativen Bereich, überschätzte. Der deutsche Angriffsplan hatte deshalb durchaus Aussicht auf lokalen Erfolg, konnte aber auch bei wohlwollender Betrachtung den endgültigen Übergang der strategischen Initiative auf die sowjetische Armee an der gesamten Ostfront nicht rückgängig machen.
Verlauf
Am Morgen des 5. Juli 1943 um 1:20 Uhr begann die Rote Armee mit einem umfassenden Artilleriebeschuss der vermuteten Bereitstellungsräume der deutschen Truppen. Ein Pionier der 6. Infanterie-Division war beim Räumen einer Minengasse gefangen genommen worden und hatte bei der Vernehmung als Angriffszeitpunkt 2:00 Uhr angegeben. Tatsächlich begann der Angriff um 3:30 Uhr, deshalb befanden sich die Truppen noch nicht in ihren Bereitstellungsräumen. Aus dieser Tatsache und dass in den Kriegstagebüchern der Artillerieschlag kaum bzw. beiläufig erwähnt wird, ziehen neuere Arbeiten die Schlussfolgerung, dass der Artillerieschlag weitgehend wirkungslos blieb und widersprechen damit der in der sowjetischen und teilweise auch der westlichen Literatur bislang vertretenden Auffassung einer teilweise sogar schlachtentscheidenden Wirkung des Artillerieschlags. Auf der Südseite zum Beispiel führte allerdings die Zerstörung einer Brücke zu einer kurzfristigen Verzögerung des Angriffs des III. Panzerkorps.
Die sowjetische Luftwaffe griff nur wenige Minuten vor dem geplanten Start der deutschen Flugzeuge deren Flugplätze mit allen greifbaren Bombern und Jagdflugzeugen an. Da die sowjetischen Flugzeuge aber von einem weitreichenden Radargerät vom Typ Freya geortet wurden, konnte die deutsche Luftwaffe rechtzeitig reagieren. So konnten die deutschen Jäger, anders als im Einsatzplan vorgesehen, vor den Bombern starten. Es kam zu einer gewaltigen Luftschlacht. Rund 120 sowjetische Flugzeuge wurden dabei abgeschossen.
Zu nennenswerten Ausfällen auf deutscher Seite kam es bei den beiden sowjetischen Präventivschlägen am Morgen des 5. Juli jedoch nicht. Am 5. Juli konnten die deutschen Truppen im Kampfgebiet 425 feindliche Flugzeuge abschiessen. Die Luftwaffe verlor hingegen nur 36 Maschinen. Beim Unternehmen Zitadelle konnte die deutsche Luftwaffe das letzte Mal im Zweiten Weltkrieg die Luftherrschaft erringen.
Nordseite
Der Angriff der 9. Armee unter Generaloberst Model auf die bis zu 30 Kilometer tief gestaffelte Verteidigung der Zentralfront unter Marschall Konstantin Rokossowski begann um 3:30 Uhr. Das XXXXVI., XXXXVII. und XXXXI. Panzerkorps traten zum Durchbruch an. Pioniere, Infanterie und Artillerie versuchten eine Bresche in die Verteidigung zu schlagen, in die dann die Panzer vorstossen sollten. Der Angriff traf von Beginn an auf einen unerwartet zähen und verbissenen Widerstand und ein nie dagewesenes Artilleriefeuer. Auf der Nordseite ging die sowjetische Zentralfront das Risiko des Verlustes von riesigen Munitionsbeständen bei einem Durchbruch ein und lagerte bis zu 5 Kampfsätze direkt neben den Geschützen. Ein Kampfsatz für eine Armee wog 20.000 Tonnen. Nach sowjetischen Angaben gab es in der Kriegsgeschichte nie einen derartig hohen Munitionseinsatz wie bei der 13. Armee, die 4 Kampfsätze verschoss.
Am Abend des 5. Juli waren die deutschen Angriffsspitzen dennoch auf einer Breite von 15 Kilometern bis zu acht Kilometer tief in den ersten Verteidigungsstreifen eingebrochen. Beide Seiten verzeichneten hohe Verluste. Rokossowski entschloss sich umgehend zu einem massiven Gegenangriff, der am Morgen des 6. Juli im Zusammenwirken von Artillerie, Fliegerkräften und Bodentruppen gegen das deutsche XXXXVI. Panzerkorps begann und erste Erfolge zeigte. Model setzte nun seinerseits die 2. und 9. Panzer-Division sowie die schwere Panzer-Abteilung 505 ein, wodurch es im Gebiet zwischen Ponyri und Soborowka zu einer Konzentra-ion von mehr als 1000 Panzern auf deutscher Seite kam. Dennoch kam der deutsche Angriff nur im Schritttempo voran, da Rokossowski, dessen Kräfte nun ins Hintertreffen zu geraten drohten, ebenfalls weitere Reserven in das Gefecht warf.
Als der Kampf am Abend des 6. Juli zu einem vorläufigen Ende kam, bereiteten beide Seiten ihr Vorgehen für den nächsten Tag vor. Rokossowski befahl seinen Kräften, zur Verteidigung überzugehen. Des Weiteren befahl er, einen grossen Teil der Panzer einzugraben und als feste Feuerpunkte zu verwenden, nachdem zwei Panzerbrigaden in kürzester Zeit die Masse ihrer Panzer während der schweren Gefechte mit Tigern der schweren Panzer-Abteilung 505 verloren hatten. Zwischenzeitlich führte er weitere Reserven heran und verstärkte seine Linien. Models Stab war vom langsamen Vorankommen und dem Widerstand der sowjetischen Truppen überrascht. Man entschied sich daher bereits jetzt, die Kampfverbände des ersten Schlags mit Kräften zu verstärken, die eigentlich für die Phase nach dem geplanten Durchbruch in Richtung Kursk vorgesehen waren. Neben der 18. Panzer-Division und der 4. Panzer-Division, die bereits in direkter Frontnähe konzentriert waren, ergingen Marschbefehle an die 12. Panzer-Division, die 10. Panzergrenadier-Division und die 36. motorisierte Division, die sich im Gebiet südlich von Orjol bereithielten. Trotz der Erfahrungen der ersten beiden Angriffstage hoffte das Oberkommando der 9. Armee, den von der sowjetischen 13. Armee gehaltenen zweiten Verteidigungsstreifen am 7. Juli durchstossen zu können. Ihm entging dabei die weiter fortschreitende Kräftekonzentration der Roten Armee an diesem Frontabschnitt, die einen Durchbruch um jeden Preis verhindern wollte.
Am Morgen des 7. Juli begann der massierte Angriff des XXXXI. und XXXXVII. Panzerkorps. Mehr als 400 Panzer und vier Infanteriedivisionen stiessen entlang der Bahnlinie zwischen Ponyri und Olchowatka vor. Ziel der Attacke war der Bahnhof von Ponyri, ein für beide Seiten entscheidender Verkehrsknotenpunkt der Region. Der Angriff traf auf zähen Widerstand und kam erneut nur schrittweise voran. Die sich langsam durch die gestaffelten Minenfelder vortastenden deutschen Truppen blieben häufig in den sich mehrfach überlappenden Schussfeldern sowjetischer Panzerabwehrtrupps und im schweren Artilleriefeuer vor der zweiten Verteidigungslinie der Zentralfront liegen. Am Nachmittag näherten sich die Angreifer von drei Seiten Ponyri, konnten den Widerstand der Verteidiger am Ortsrand jedoch noch nicht brechen. Beide Seiten führten nun weitere Verstärkungen heran. Nach heftigen Kämpfen und hohen Verlusten kontrollierten die deutschen Truppen die Hälfte von Ponyri. Innerhalb des Ortes – der in der Nachbetrachtung von Zeitzeugen auch als das „Stalingrad“ bei Kursk bezeichnet wurde – entwickelten sich harte und verbissene Kämpfe um jedes Haus, jede Mauer und jeden Graben. Trotz hoher Verluste dachte keine Seite an einen Rückzug.
Models Hauptaugenmerk galt Olchowatka. Die höhergelegene Gegend bot ein günstiges Gelände für die überlegenen deutschen Panzer. Die Eroberung sollte den endgültigen Durchbruch in Richtung Kursk und die geplante Vereinigung mit den an der südlichen Flanke angreifenden Kräften von Mansteins ermöglichen. Das XXXXVII. Panzerkorps mit der 2. und 20. Panzer-Division in der Spitze stiess in dieser Richtung vor. Rokossowski hatte dieses Vorgehen erkannt und seine Kräfte an diesem Abschnitt unter anderem mit zwei weiteren Panzerkorps der 2. Panzerarmee verstärkt, die nun Gegenangriffe ausführten. Nach heftigen Kämpfen, zahllosen Angriffen und Gegenangriffen blieb der deutsche Angriff stecken. Auch der Einsatz der schweren Panzer-Abteilung 505 brachte nicht den erhofften Erfolg.
Am Abend des 7. Juli hatten die deutschen Angreifer zwar unter hohen Verlusten Raum gewonnen, waren aber erneut nicht in der Lage gewesen, einen Durchbruch zu erzielen. Mehr noch, die vorgestossenen Divisionen sahen sich ständigen Gegenangriffen ausgesetzt, wobei insbesondere die hinter den Verteidigern massiert konzentrierte sowjetische Artillerie stetige Verluste verursachte. Es fehlte vor allem, anders als noch an den ersten beiden Tagen der Offensive, an Luftüberlegenheit, die im Verlauf des 7. Juli an die Rote Armee verloren ging. Die 9. Armee verzeichnete 10.000 Ausfälle während der ersten drei Tage. Lediglich 5000 Mann Ersatz erreichten die kämpfenden Truppen. Ähnlich schlecht sah die Ersatzsituation bei den vernichteten und ausgefallenen Panzern aus.
Dessen ungeachtet plante die Führung der 9. Armee einen erneuten Angriff für den 8. Juli und führte weitere Reserven heran. Drei Infanteriedivisionen und 400 Panzer wurden westlich von Ponyri konzentriert. Auch die sowjetische Seite gruppierte ihre Kräfte um und verstärkte ihre Stellungen mit weiteren Reserven.
Der Morgen des 8. Juli begann mit einer massiven Artillerievorbereitung und dem gezielten Einsatz von Sturzkampfbombern gegen sowjetische Artilleriestellungen. Diese Bemühungen hatten jedoch nur wenig Erfolg gegen die gut eingegrabenen sowjetischen Verteidiger. Die unmittelbar danach vorrückenden deutschen Panzer stiessen erneut auf heftigsten Widerstand. Trotz der zurück-ewonnenen Luftherrschaft erzielten die Angreifer keine nennenswerten Erfolge. Oftmals tobten stundenlange, verlustreiche Kämpfe um einzelne Geländepunkte, die mehrfach den Besitzer wechselten. Ein kleiner Erfolg für die Deutschen bahnte sich bei Teploe an. Nach heftigen Kämpfen und Angriffen mit Wellen von 60 bis 80 Panzern eroberten die Panzerdivisionen die Stadt. Die sowjetische Zentralfront schloss die drohende Lücke in der Front jedoch umgehend wieder. Auch in Ponyri tobten wieder heftige Infanteriekämpfe. Nachdem die sowjetischen Truppen den Ort zeitweise zurückerobern konnten, teilten sich am Abend des 8. Juli beide Seiten erneut die Kontrolle.
Model erkannte nach den gescheiterten Durchbruchsversuchen die festgefahrene Situation. Seinen Truppen war es nicht möglich, die gesteckten Ziele ohne weitere Reserven zu erreichen. Die Kräfte der 9. Armee waren bereits über die Massen beansprucht. Ersatz war nicht verfügbar. Dennoch plante er nach Rücksprache mit dem Oberkommando der Heeresgruppe Mitte, das einen Misserfolg nicht akzeptieren wollte, für den nächsten Tag eine Wiederaufnahme des Angriffs. Das Kriegstagebuch des XXXXVI. Panzerkorps führte „das langsame Vordringen der Angriffsdivisionen und ihre dabei zum Teil schweren Verluste“ auf „den ungewöhnlichen hohen Einsatz der feindlichen Artillerie und Granatwerfer sowie auf den Einsatz der feindlichen Panzer“ zurück.
Am 9. Juli legten Models Verbände eine Pause ein, um sich umzugruppieren. Nach heftigen Gegenangriffen der Roten Armee an allen Abschnitten der nördlichen Stossgruppe sahen sich die Angreifer vielfach in der Rolle des Verteidigers. Der ursprünglich geplante und für den Erfolg des Unternehmens Zitadelle erforderliche schnelle Durchbruch durch die Verteidigung der Zentralfront war nicht in Sicht. Es drohte ein Stellungskrieg und somit eine für beide Seiten verlustreiche Abnutzungsschlacht, in der die deutschen Kräfte gegenüber den zahlenmässig stärkeren Truppen der Roten Armee zwangsläufig unterliegen mussten.
Auch der 10. Juli brachte keine Veränderung der Situation. Die deutschen Truppen blieben in der gut gestaffelten Verteidigung liegen. Sie mussten sich permanenter Gegenangriffe der sowjetischen Seite erwehren, die nun ihrerseits offensiver agierte. Das Verlangen Models nach weiteren Truppen wurde angesichts der Ereignisse auf anderen Kriegsschauplätzen, insbesondere der in der Nacht zum 10. Juli erfolgten Landung der Alliierten auf Sizilien, von Hitler abgelehnt.
Model war im Begriff seine Kräfte für eine Fortsetzung des Angriffes umzugruppieren, als die Rote Armee am 11. Juli nun ihrerseits zum Angriff auf die zum Stehen gekommenen Divisionen der 9. Armee überging. Anders als erhofft, verzeichnete jedoch auch sie trotz verlustreicher Auseinandersetzungen keine Erfolge. Angesichts der hohen Verluste und der ebenfalls angespannten Kräftesituation der Zentralfront begnügte sich Rokossowski nach Rücksprache mit der Stawka vorerst mit dem erfolgreich vereitelten Angriff und ordnete seinerseits den Stopp grösserer Gegenangriffe an.
Das Oberkommando der Roten Armee löste nun die langfristig vorbereitete Operation Kutusow im nördlich gelegenen Frontvorsprung um Orjol aus. Damit entstand neben dem Durchstoss durch die schwachen deutschen Kräfte hindurch in diesem Gebiet auch für die vorgestossenen Kräfte der 9. Armee die Gefahr einer grossräumigen Einkesselung. Die Operationen auf der Nordseite des Kursker Bogens waren damit auch für die letzten Optimisten im OKW, die noch an einen Erfolg glaubten, offensichtlich gescheitert.
Südseite
Im südlichen Abschnitt des Frontvorsprungs konzentrierte Generalfeldmarschall Manstein, Befehlshaber der Heeresgruppe Süd, eine starke Angriffsstreitmacht im Raum Belgorod. Hierzu gehörte der stärkste Verband im Kursker Frontbogen, die 4. Panzerarmee unter Generaloberst Hoth. Sie vereinte drei Korps: Das LII. Armeekorps (57., 255. und 332. Infanterie-Division), das XXXXVIII. Panzerkorps (167. Infanterie-Division, Panzergrenadier-Division „Grossdeutschland“, 3. und 11. Panzer-Division, Panzerbrigade 10 [die einzige Einheit mit „Panthern“], Panzer-Regiment 39, Sturmgeschütz-Abteilung 911) sowie das II. SS-Panzerkorps (SS-Divisionen „Totenkopf“, „Das Reich“ und „Leibstandarte SS Adolf Hitler“).
An der rechten Flanke der 4. Panzerarmee operierte die Armeegruppe Kempf, bestehend aus drei Korps: Dem III. Panzerkorps (168. Infanterie-Division, 6. 7. und 19. Panzer-Division, schwere Panzerabteilung 503, Sturmgeschützabteilung 228), Korps Raus (106. und 320. Infanterie-Division, Sturmgeschützabteilung 905, später verstärkt durch die 198. Infanterie-Division) und dem XVII. Armeekorps (282., 39. und 161. Infanterie-Division, schwere Panzerjagdabteilung 560).
Manstein liess diese Kräfte in Zusammenarbeit mit der Luftflotte 4 am 5. Juli gegen 5:00 Uhr angreifen. Das bereits angeschlagene III. Panzerkorps und das Korps Raus blieben auf der rechten Flanke in ständigem Artillerie- und Panzerabwehrkanonen-Feuer in der Verteidigung des Gegners stecken und wurden dann so stark durch Gegenangriffe bedrängt, so dass sie hinter ihren Plänen zurückblieben. Die Kräfte der 4. Panzerarmee, insbesondere das II. SS Panzerkorps, hatten mehr Erfolg.
Das sowjetische Stellungssystem erwies sich an der Südseite gegenüber dem konzentrierten Angriff als schwächer als auf der Nordseite, da man den Schwerpunkt des deutschen Angriffs im Norden erwartet hatte. Auch die von der sowjetischen Seite durchgeführten massiven Luftangriffe blieben weitgehend erfolglos. Anders die deutschen Luftstreitkräfte, die auf dem Gefechtsfeld eng mit den vorrückenden Stossverbänden zusammenwirkten und massgeblichen Anteil an dem schnellen Durchbruch hatten. Entscheidend waren neben der koordinierten Luftunterstützung, die an der Nordseite weitgehend fehlte, der massive Einsatz von Artillerie und der konsequente Einsatz von Kräften, die zu den erfahrensten deutschen Verbänden gehörten.
Die Verbände der 4. Panzerarmee unter Generaloberst Hoth durchstiessen die ersten sowjetischen Verteidigungsstellungen der sowjetischen 6. Garde-Armee und vernichteten dabei auch die zu deren Unterstützung vorgeschobenen Artillerie-Abteilungen der 1. Panzerarmee. Das unterstellte II. SS-Panzerkorps überwand die mehrfach gestaffelten Verteidigungsstellungen und schlug dabei Gegenangriffe sowjetischer Reserven zurück. Obwohl das SS-Panzerkorps an der rechten Flanke aufgrund der fehlenden Deckung durch das zurückbleibende III. Panzerkorps ständig attackiert wurde, stand es bereits am 10. Juli vor dem vermeintlichen Durchbruch zu seinem Angriffsziel Kursk und stiess am 11. Juli bis drei Kilometer vor Prochorowka vor. Das XXXXVIII. Panzerkorps musste sich dagegen wiederholter Flankenangriffe erwehren und dazu Kräfte entgegen der Stossrichtung nach hinten verlagern. Die geplanten Gegenangriffe der Verteidiger in die tiefen Flanken der angreifenden Panzerkeile blieben nicht wirkungslos, konnten die deutschen Angriffsspitzen jedoch nicht wie geplant entscheidend schwächen. Nach den Erinnerungen des Generalstabschefs des XXXXVIII. Panzerkorps Friedrich Wilhelm von Mellenthin war am 5. Angriffstag klar, dass „dem deutschen Angriff das Rückgrat gebrochen worden und sein Schwung verloren gegangen war“.
Angesichts des unerwartet schnellen Durchbruchs durch das 1. und 2. Verteidigungssystem legte der Oberbefehlshaber der südlichen Woronesch-Front, Generaloberst Watutin, am 9. Juli einen Plan vor, um den deutschen Angriffskeil durch Stoss in dessen tiefe Flanken abzuschneiden und zu vernichten. Die 1. Panzerarmee, die sich bereits seit Beginn der Offensive in der Verteidigung befand und dabei starke Verluste erlitten hatte, sollte von Westen aus, die aus der Reserve über eine längere Strecke eilig herangeführte und um weitere zwei Panzerkorps verstärkte 5. Garde-Panzerarmee von Osten angreifen.
Panzerschlacht bei Prochorowka
Das II. SS-Panzerkorps hatte mit seinen Panzergrenadier-Divisionen Leibstandarte, Totenkopf und Das Reich vor Prochorowka eine Pause eingelegt, nachdem es die sich heftig verteidigende sowjetische 5. Gardearmee bis auf den Ortsrand zurückgeworfen hatte. Angesichts dieser Entwicklung entschloss sich der Befehlshaber der 5. Garde-Panzerarmee, Generalleutnant Rotmistrow, am Abend des 11. Juli, am nächsten Morgen einen Gegenangriff zu starten, um die drohende Einschliessung von Prochorowka und den endgültigen Durchbruch der deutschen Angriffs-Divisionen in die ungeschützte Tiefe zu verhindern. Er verfügte zu diesem Zeitpunkt über 793 Panzer und 57 Sturmgeschütze, darunter viele veraltete T-70. Im Wissen um die überlegene Panzerung und Bewaffnung der neuen deutschen Panzer wurde der Befehl ausgegeben, mit hoher Geschwindigkeit anzugreifen, um eine Schussentfernung von 500 m und weniger zu erreichen. Ausserdem sollten jeweils mehrere Panzer als Gruppe einen Gegner, insbesondere die gefürchteten Tiger, in der Nahdistanz attackieren.
Am Morgen des 12. Juli begann der heftige Gegenangriff auf die Stellungen des II. SS-Panzerkorps vor Prochorowka. Die sich daraus entwickelnde Schlacht gilt als Schauplatz des grössten Panzergefechts der Geschichte. Hier sollen 900 sowjetische Panzer der sowjetischen 5. Garde-Panzerarmee auf 600 deutsche Panzer getroffen sein. Die Schlacht wurde im Nachhinein insbesondere von der sowjetischen Propaganda sowie in Kriegs- und Memoirenliteratur zum entscheidenden Sieg verklärt. Neuere Erkenntnisse lassen jedoch darauf schliessen, dass es sich nur um mehrere kleinere Panzergefechte gehandelt hat, schon allein deshalb, weil auf deutscher Seite in diesem Abschnitt insgesamt wesentlich weniger als die behaupteten 600 Panzer verfügbar waren. Aussergewöhnlich waren aber die hohen Verluste der Panzertruppen der 5. Garde-Panzerarmee gegenüber den deutschen Panzern, die sich, anders als später behauptet, überwiegend in stationären Positionen befanden.
Die sowjetischen Panzer griffen mit hohen Tempo und aufgesessener Infanterie an, um die höheren Durchschlagsleistungen der deutschen Panzergeschütze zu unterlaufen und in den Nahkampf zu kommen. Vor den Stellungen der II. Panzer-Abteilung der Division Leibstandarte kam es zum grössten Zusammentreffen. Nach Berichten deutscher Kampfteilnehmer sollen bereits bei der Annäherung sehr viele sowjetische Panzer in dem für die Verteidiger günstigen Gelände abgeschossen worden sein. Viele der angreifenden Panzer hätten sich auch gegenseitig behindert und in der Enge sogar gerammt. Einen entscheidenden Ausschlag zu Ungunsten der sowjetischen Truppen gab dann ein in einer Senke befindlicher, zuvor aufgegebener eigener Panzergraben, der offensichtlich bei der Planung des Angriffs durch das sowjetische 29. Panzerkorps nicht berücksichtigt worden war und hinter dem sich die deutschen Panzer der Leibstandarte aufgereiht hatten. Bei dem vergeblichen Versuch, dieses Hindernis am einzigen Übergang zu überwinden, wurden die angreifenden sowjetischen Panzer zu leichten Zielen. Viele stürzten sogar in den Graben und überschlugen sich. Es entwickelten sich heftige Nahkämpfe, bei denen nach den Erinnerungen des SS-Grenadiers der Leibstandarte Kurt Pfötsch die Panzer sich auf engsten Raum gegenseitig umkurvten. Er berichtet auch, dass sowjetische Panzer, oft brennend, versuchten die Tiger zu rammen, um mit ihnen in die Luft zu fliegen.
Rotmistrow warf daraufhin stetig neue Kräfte in den Frontabschnitt, diese erlitten jedoch wegen ihres bedingungslosen Einsatzes hohe Verluste und erzielten keine Geländegewinne. Gegen Mittag des 12. Juli brach er den Angriff ab und ging mit seinen verbliebenen Kräften an den Ausgangsstellungen zur Verteidigung über. Die 5. Garde-Panzerarmee verlor in den Gefechten an diesem Tag mehr als 200 Panzer und gab am 16. Juli 3597 Gefallene an. Hinzu kamen noch einmal so viele Verwundete. Das SS-Panzerkorps meldete für diesen Tag 120 abgeschossene Feindpanzer. Dagegen standen vergleichsweise geringe deutsche Verluste. Deutsche Archivdaten geben 3 Totalverluste und 143 beschädige Panzer, darunter 25 beschädigte Tiger, für das SS-Panzerkorps für den 12. Juli an. Da die deutsche Seite nach der Schlacht das Gefechtsfeld beherrschte, gibt diese Zahl einen verzerrten Eindruck des unmittelbaren Ergebnisses des Gefechtes. Die Zahl zerstörter Panzer war auf deutscher Seite auch darum so niedrig, weil abgeschossene Panzer abgeschleppt und in Stand gesetzt werden konnten, im Gegensatz zur sowjetischen Seite. David M. Glantz gibt die Verluste des SS Panzerkorps mit 60 bis 70 Panzern an. Neuere russische Untersuchungen halten fest, dass es der 5. Garde-Panzerarmee trotz hoher Verluste nicht gelungen war, den gestellten Auftrag zu erfüllen. Nach der Schlacht soll Stalin, so der russische Historiker Swerdlow, erwogen haben, Panzergeneral Rotmistrow abzusetzen und vor Gericht zu stellen, gefährdeten doch die hohen Verluste die Planungen für die nachfolgende Offensive auf Charkow. Die propagandistische Verklärung der Schlacht bei Prochorowka zum Sieg der sowjetischen Panzertruppen bewahrte Rotmistrow jedoch vor diesem Schicksal. Für den internen Dienstgebrauch stellte eine eigens einberufene Untersuchungskommission lediglich die schlechte Planung und Durchführung des Unternehmens fest. Die Angriffe der sowjetischen 1. Panzerarmee im Bereich des XXXXVIII. Panzerkorps am 12. Juli blieben ebenfalls erfolglos, so dass auch diese Kräfte zur Verteidigung übergehen mussten, statt wie geplant die deutschen Divisionen mit tiefen Angriffsoperationen abzuschneiden und zu vernichten.
Die deutschen Offensivkräfte behaupteten an dieser Stelle zunächst das Schlachtfeld und hatten ihre Angriffsfähigkeit nicht entscheidend eingebüsst. Der heftige sowjetische Gegenangriff war dagegen unter grossen Verlusten gescheitert. Unter Einsatz aller Kräfte hätte nun wahrscheinlich der Durchbruch auf der Südseite zum Operationsziel Kursk erfolgen können. Manstein wollte zu diesem Zweck weitere Truppen aus der unter „Führervorbehalt“ stehenden Reserve der Heeresgruppe Süd – das XXIV. Panzerkorps mit der SS-Panzergrenadier-Division „Wiking“ sowie der 17. und 23. Panzer-Division – für den Durchbruch gegen die angeschlagenen Verteidiger einsetzen. Dies wurde ihm allerdings von Hitler angesichts der prekären Entwicklung am nördlichen Frontabschnitt, in dem durch die Orjol-Gegenoffensive der Roten Armee eine Einkesselung der vorgestossenen Kräfte der Heeresgruppe Mitte drohte, untersagt. In seinen Memoiren vertrat Manstein später die Meinung, mit diesen Truppen wäre zumindest auf der Südseite ein Teilerfolg möglich gewesen. Es muss allerdings bezweifelt werden, ob sich ein Durchbruch in den freien Raum in operativer oder gar strategischer Hinsicht entscheidend ausgewirkt hätte. Selbst wenn es gelungen wäre, die an dieser Stelle angeschlagenen sowjetischen Truppen einzukesseln und zu vernichten – ein nicht zu unterschätzender Erfolg, betrachtet man die nachfolgenden Einsätze der beiden sowjetischen Panzerarmeen (1. und 5. Garde) – drohte eine Auseinandersetzung mit weiteren Truppen der strategischen Stawka-Reserve. Letztlich hätten die vorgestossenen deutschen Verbände aber ungeachtet potenzieller Erfolge in jedem Fall aufgrund der angelaufenen Grossoffensive der Roten Armee eher früher als später zurückgenommen werden müssen. Manstein wurde es jedoch trotzdem gestattet, am rechten Flügel eine begrenzte Angriffsoperation („Roland“) durchzuführen. Nach leichten Geländegewinnen schloss das III. Panzerkorps zum II. SS-Panzerkorps auf; die Befehle zur Herauslösung der Kernverbände machten jedoch eine Fortsetzung der Angriffs-Operationen unmöglich.
Legende vom Abbruch durch die Landung in Sizilien
Der Historiker Roman Töppel bezweifelt die Darstellung Mansteins in seinen Erinnerungen, dass Hitler am 13. Juli die Kursker Schlacht, wegen der am 10. Juli erfolgten, alliierten Landung auf Sizilien abbrach, um Truppen dorthin verlegen zu können, und bezeichnet dies als eine Legende. Dazu führt er eine Reihe von widersprechenden Quellen an. Der Generalstabschef Kurt Zeitzler, der ebenfalls am 13. Juli anwesend war, schrieb in einer Studie für die US-Armee, die vor Mansteins Buch entstand, dass Hitler ganz im Gegenteil wütend und tobend weiter angreifen wollte, als Feldmarschall Kluge um die Einstellung des Angriffs wegen der sowjetischen Offensive auf den Orelbogen bat. In einem Funkspruch Mansteins vom 22. Juli 1943 an Generaloberst Eberhard von Mackensen wird als Grund für den Abbruch die Lageentwicklung bei der Heeresgruppe Mitte genannt. Auch die Tagebuch-intragungen von Johann Adolf Graf von Kielmansegg widersprechen dem. Das Kriegstagebuch des Oberkommando der Wehrmacht vermerkt den Abbruch der Schlacht erst für den 19. Juli und um durch Frontverkürzung Reserven angesichts der heftigen sowjetischen Offensiven zu schaffen. Zudem wurde zunächst kein einziger Verband nach Italien verlegt. Goebbels notierte sogar: „So wie die Engländer und Amerikaner jetzt ihr Unternehmen aufdrehen, brauchen wir nicht einen einzigen Soldaten aus dem Osten wegzuholen“. Entgegen der in der Literatur immer wieder behaupteten Verlegung des SS-Panzerkorps nach Italien, wurde dieses zur Abwehr der am 17. Juli begonnen sowjetischen Donez-Mius-Offensive in den Raum Stalino verlegt. Erst am 26. Juli wurde die Verlegung der Divisionen „Das Reich“ und der Leibstandarte befohlen, wovon lediglich die Verlegung der Leibstandarte erfolgte, und das nach Abgabe aller ihrer Panzer. In Wirklichkeit führten also nach Töppel die sowjetischen Gegenoffensiven zum Abbruch der Kursker Schlacht.
Bei der am 12. Juli gestartete sowjetische Offensive im Raum Orjol durchstiessen sowjetische Offensivkräfte der Brjansker Front in koordiniertem Zusammenwirken mit grossen Partisanenverbänden, die sich seit Monaten auf diesen Tag vorbereitet hatten, die schwachen deutschen Linien der 2. Panzerarmee und erzielten einen unmittelbaren Einbruch von rund 20 Kilometern Tiefe. Damit bestand die Gefahr eines Durchbruchs in Richtung Orjol und des Einkesselns der vorgestossenen 9. Armee. Die Heeresgruppe Süd musste sich der am 3. August beginnenden sowjetischen Offensive Rumjanzew entgegenstellen.
Für die sowjetische Seite war die Schlacht bei Kursk keineswegs beendet. Sie sah die eigenen als Reaktion auf das Unternehmen Zitadelle vorgetragenen Angriffe erst als Auftakt für ihre umfassenden Angriffsbemühungen im Sommer 1943. Ab dem 3. August begann die Belgorod-Charkower Operation zur Rückeroberung des Gebietes um Charkow. Bis Ende September hatte die Rote Armee den Dnjepr überschritten und die Heeresgruppe Süd weit zurückgeworfen.
Die sowjetische Historiographie führte den Sieg in der Kursker Schlacht in erster Linie auf den „Massenheroismus“ der sowjetischen Soldaten zurück. Deutsche Akten sprechen von zähem, fanatischen Widerstand bis in den Tod. Das XXXXI. Panzerkorps meldete: „Gegner wehrt sich infanteristisch äusserst zäh und verteidigte sich zum Letzten“. Im Kriegstagebuch der 9. Armee hiess es: „Es bleibt eine harte Tatsache, dass der Gegner bisher mit fanatischer Verbissenheit gekämpft hat. Aufgefangene Funkbefehle enthalten immer wieder die Forderung: Stellungswechsel verboten, halten Sie bis zum Tode“. Das Kriegstagebuch der Armeeabteilung Kempf vermerkte: „Der Gegner lässt sich dort in seinen gut ausgebauten Stellungen totschlagen“. Und der Generalstabschef der 4. Panzerarmee schrieb: „Der feindliche Infanterist kämpft gut, entgegen der bisherigen Annahme, dass es sich beim Gegner um schlechte Stellungsdivisionen handelt, muss festgestellt werden, dass auch dieser Feind zu fechten und zu sterben versteht“.
Während der Kursker Schlacht lief die Aktion Silberstreif, bei der durch massenhaften Abwurf von Flugblättern Rotarmisten zum Überlaufen gebracht werden sollten. Sie erwies sich als völliger Fehlschlag.
Verluste
Eine genaue Ermittlung der Verluste beider Seiten ist schwierig und war lange Zeit umstritten. Da die sowjetischen Verbände direkt nach dem Unternehmen Zitadelle, im Norden schon währenddessen, zum Gegenangriff übergingen, fällt eine zeitliche Abgrenzung schwer.
Für die Verluste der Roten Armee gilt die Arbeit von Grigori Kriwoschejew als Standardwerk. Ein Grossteil der Bücher über diese Schlacht akzeptiert dessen Zahlen für die sowjetischen Verluste. Demnach verlor die Rote Armee während der Kursker Verteidigungsoperation (5. – 23. Juli) 177.847 Mann, davon waren 70.330 tot oder vermisst. Des Weiteren verloren die Verbände der Roten Armee 1.614 Panzer, wobei Schätzungen bis knapp 2.000 gehen. An Artilleriegeschützen wurden 3.929 als zerstört gemeldet. Einige Historiker geben für die sowjetischen Verluste höhere Zahlen an und argumentieren mit dem damals schlechten sowjetischen Meldesystem. Des Weiteren wurden von russischen Pfadfindern in den letzten Jahren sterbliche Überreste von 5.000 Rotarmisten gefunden. Davon waren rund 30 Prozent in den Archiven des Verteidigungsministeriums nicht erfasst und konnten somit nicht in die Verluststatistik eingehen. Nicht unumstrittene Historiker wie Solukow kommen demnach auf personelle Verluste von über 300.000 Mann. Diese Zahlen sind aber mit Vorsicht zu betrachten.
Der Generalinspekteur für die Panzerwaffe Heinz Guderian schrieb in seinen Erinnerungen:

„Wir hatten durch das Misslingen der ‚Citadelle’ eine entscheidende Niederlage erlitten. Die mit grosser Mühe aufgefrischten Panzerkräfte waren durch die schweren Verluste an Menschen und Gerät auf lange Zeit verwendungsunfähig. Ihre rechtzeitige Wiederherstellung für die Verteidigung der Ostfront, erst recht aber für die Abwehr der im nächsten Frühjahr drohenden Landung der Alliierten an der Westfront war in Frage gestellt“.
Für den Generalstabschefs des XXXXVIII. Panzerkorps Friedrich Wilhelm von Mellenthin waren die deutschen Panzerdivisionen „beinahe weissgeblutet“ und in der Kursker Schlacht sei „die Blüte des deutschen Heeres endgültig und entscheidend dahingewelkt“.
Für die deutschen personellen Verluste geben neueste Werke Zahlen zwischen 49.000 und 54.182 an. Davon waren 11.043 tot oder vermisst. Von den eingesetzten deutschen 2.699 Panzern wurden laut David M. Glantz’ Schätzung 350 zerstört. Deutsche Archive, interpretiert von Karl-Heinz Frieser, zeigen hingegen den Totalverlust von 252 Panzern. Am Morgen des 20. Juli waren von den ursprünglich 2.500 einsatzbereiten Panzern und Sturmgeschützen bei der „Heeresgruppe Mitte“ nur noch 285 Panzer einsatzbereit und bei der „Heeresgruppe Süd“ noch 543 sowie an der gesamten Ostfront noch 198 Sturmgeschütze. Die Differenz erklärt sich durch geborgene und reparierte Fahrzeuge. Eine Studie der US-Armee konstatiert, dass auf einen zerstörten deutschen Panzer 5,6 beschädigte kamen, während auf der sowjetischen Seite das Verhältnis bei 1:0,8 lag. Wobei der scheinbare Vorteil relativ weniger beschädigter Fahrzeuge in Wahrheit darauf zurückzuführen ist, dass mehr Fahrzeuge irreparabel beschädigt wurden.
Sowohl für die deutschen Panzer- als auch die personellen Verluste geben insbesondere sowjetische Nachkriegswerke weitaus höhere Zahlen an. Diese Zahlen widersprechen allerdings den Archiven und aktuellen Untersuchungen und sind aller Wahr-scheinlichkeit nach zu Propagandazwecken überhöht.
Die Zahlen lassen sich jedoch nicht immer genau überprüfen. Auf einen vernichteten deutschen Panzer kamen, laut Frieser, sieben sowjetische Panzer. Davon fielen jedoch viele nicht dem direkten Duell am Boden, sondern den zu diesem Zeitpunkt noch effektiv agierenden Panzerjagdkräften der deutschen Luftwaffe zum Opfer. Auch konnte die sowjetische Seite viele Panzer nach dem Rückzug der deutschen Stosskeile auf die Ausgangsstellungen bergen und instandsetzen.
Operation Husky (10.07.1943 – 17.08.1943)
Operation Husky war die Codebezeichnung für die alliierte Invasion Siziliens ab dem 10. Juli 1943 und der Auftakt des „Italienfeldzuges“ im Zweiten Weltkrieg.
Die strategische Situation
1942 bzw. Anfang 1943 fehlte dem alliierten Oberkommando ein strategisches Gesamtkonzept, wie sich die in der ARCADIA-Konferenz festgelegte Strategie „Europe first“ umsetzen liess. Klarheit bestand nur dahin gehend, dass Deutschland durch eine Landung auf dem europäischen Kontinent in die Knie gezwungen werden sollte. Das Unternehmen Roundup stiess sowohl bei den US-amerikanischen Planern als auch im britischen Generalstab auf Zustimmung. Allerdings zeigt sich nach dem April 1942 schnell, dass die alliierten Streitkräfte noch zu keiner Landung auf dem Kontinent – speziell in Frankreich – in der Lage waren.
Vielmehr bestand durch die Offensiven der Wehrmacht in Nordafrika und Russland die Gefahr einer Verschärfung der militärischen Lage – bis hin zum Ausscheiden der Sowjetunion aus dem Krieg. Die Alliierten konnten also nur auf die Aktionen der Wehrmacht reagieren und entschieden sich vor dem Hintergrund dieser Situation im Juli 1942 für eine Landung in Nordafrika – die Operation TORCH.
Ende 1942 bzw. zu Beginn des Jahres 1943 änderte sich die Situation für die Alliierten grundlegend. Durch den Erfolg der britischen 8. Armee bei El Alamein und deren folgenden Vorstoss nach Tunesien, unterstützt von der alliierten Landung in Marokko und Algerien (Operation Torch), wendete sich das Blatt in Nordafrika. Gleichzeitig gelang der Roten Armee die Einschliessung und Vernichtung der 6. Armee in Stalingrad. Es zeichnete sich zum ersten Mal ab, dass die Wehrmacht allmählich in die Defensive geriet. Damit stellte sich den Vereinigten Stabschefs die Frage, in welche Richtung sich die alliierte Strategie weiter entwickeln sollte. Für die USA stand fest, dass nach dem Abschluss der Aktionen in Tunesien die Landung auf dem Kontinent wieder in den Mittelpunkt rücken sollte, die Operation TORCH wurde als eher kleine Abweichung vom eigentlichen Kriegsziel angesehen. Allerdings vertrat Grossbritannien eine andere Haltung, es sollte der Feldzug im Mittelmeer fortgesetzt werden. Für Winston Churchill bzw. die britische Armeeführung war eine Fortführung des Krieges durch Operationen gegen Italien oder Südfrankreich denkbar. Als weitere Option wurden Vorstösse in Richtung Balkan angesehen. Als mögliche Ziele galten unter anderem Sardinien (Codename BRIMSTONE) und Sizilien (Codename HUSKY).
In genau diesem Klima traf die militärische Führung der Westalliierten im Januar 1943 in Casablanca aufeinander. Obwohl sich US-Stabschef George Marshall vehement für die Fortführung der Operation ROUNDUP – wenn auch in modifizierter Form – einsetzte und die Position der Briten als Verschwendung von Ressourcen ansah, konnte sich die US-amerikanische Haltung letztlich nicht durchsetzen. Ein Grund war der immer noch andauernde Feldzug in Nordafrika. Eigentlich hatte man im alliierten Oberkommando daraufgesetzt, dass Tunesien bereits zum Jahreswechsel 1942/1943 vollständig besetzt war – und die Truppen für Aktionen in Europa zur Verfügung standen. Stattdessen zogen sich die Kämpfe hin und es war klar, dass die Truppen für andere Operationen im Sommer 1943 nicht bereitstehen würden.
Aufgrund dieser Schwierigkeiten war an eine Invasion Europas von Grossbritannien aus zum geplanten Zeitpunkt unmöglich.
Vor diesem Hintergrund musste eine Entscheidung fallen, auf welches Ziel sich die Aufmerksamkeit nach der Eroberung Tunesiens richten sollte. Eine Fortsetzung der Operationen im Mittelmeerraum erschien aus Sicht der britischen Führung logisch. Churchill setzte nicht einfach nur auf eine Schwächung der Achsenmächte. Weitere Angriffe gegen Italien könnten nicht nur zu dessen Ausscheiden aus der Achse Berlin-Rom führen. Bereits die Operationen in Nordafrika hatten zu einer Verstärkung der deutschen Verteidigung Südfrankreichs geführt – was die Verteidigung entlang der Atlantikküste schwächte. Für den Fall, dass die Alliierten die Mittelmeerinseln oder gar das italienische Festland angriffen, war mit einem noch grösseren Materialeinsatz der Wehrmacht zu rechnen. Zur Auswahl standen für weitere Operationen – neben Sizilien und Sardinien – Korsika, Kreta und der Balkan. Aufgrund verschiedener Vorzüge und logistischer Sachzwänge entschieden sich die Westalliierten am 18. Januar 1943 für die Operation HUSKY – eine Invasion Siziliens.
Dafür sprach unter anderem die Tatsache, dass Truppen nach Abschluss der Eroberung Tunesiens bereits in unmittelbarer Nähe der Insel zur Verfügung standen. Mit einer Operation im Mittelmeer in Richtung Sizilien würde man erreichen, dass die Bereitstellung der für die Verlegung der Truppen notwendigen Transportkapazität im Vergleich zu anderen Operationen leichter zu beschaffen wäre. Zudem hätte eine Besetzung Siziliens den Alliierten die direkte Verbindung zwischen Ägypten und Gibraltar geöffnet – was zu einer deutlichen Verkürzung der Schifffahrtswege führen würde. Bisher musste der alliierte Schiffsverkehr aus dem Pazifik bzw. aus Indien – oder in die entgegengesetzte Richtung – den Umweg um Afrika nehmen, da die Achsenmächte von sizilianischen Flugfeldern aus die Schifffahrt im südlichen Mittelmeer kontrollieren konnten.
Für Sizilien als nächstem Schritt sprach zudem die Hoffnung, eine Landung auf italienischem Boden würde die Stimmung im faschistischen Italien soweit beeinflussen, dass Italien aus der Achse ausschied. Die alliierte Armeeführung ging für diesen Fall von einer Intervention der Wehrmacht in Italien aus, was den Druck an anderen Frontabschnitten deutlich verringern konnte. In welche Richtung sich die Strategie der Westalliierten weiter entwickeln sollte, liessen die Vereinigten Stabschefs auch nach ihrer Entscheidung für die Landung auf Sizilien offen.
Planung
Obwohl Sizilien und Tunesien nur einige Dutzend Kilometer trennten, waren die Schwierigkeiten von Beginn an erheblich. Eines der Hauptprobleme bestand nicht in der Anlandung der ersten Welle, sondern die Sicherstellung des Nachschubs. Der direkte Angriff auf einen Hafen von einer Grössenordnung wie Catania oder Messina fiel aufgrund der starken Küstenbefestigungen aus. Damit mussten die Landungsstrände so ausgewählt werden, dass mit möglichst wenig Gegenwehr durch die Verteidiger zu rechnen war, Häfen gleichzeitig relativ leicht zu erreichen waren.
Ein weiteres Kernproblem bestand im Aufbau einer Führungsstruktur für die beteiligten Truppen, die aus Streitkräften der Vereinigten Staaten, Grossbritanniens und Kanadas bestanden. Commander-in-Chief wurde General Dwight D. Eisenhower, zu dessen Stellvertreter (Deputy C-in-C) berief man Harold R. L. G. Alexander, der gleichzeitig das Kommando über die Bodentruppen erhielt. Das Kommando über die beteiligten Marinestreitkräfte übergab man Andrew B. Cunningham, während Air Chief Marshal Arthur Tedder das Kommando über die alliierten Luftstreitkräfte führte. Mit der Operation HUSKY legten die Westalliierten den Grundstein für das später gut funktionierende Kommandosystem – bestehend aus unabhängigen Planungskomitees für die einzelnen Truppengattungen. Im Zuge der Vorbereitungen für die Landung auf Sizilien zeigten sich allerdings deutlich dessen Schwächen.
Die ersten Planungsschritte für die Operation HUSKY begannen bereits Ende Januar 1943 – mit der Gründung der Task Force 141 in Algier. Diese Bezeichnung erhielt der zuständige Planungsstab, aus dem später die 15. Armeegruppe hervorgehen sollte. Mit den strategischen Planungen beauftragt, entwickelte die TF 141 zuerst einen Plan, der vom späteren Ergebnis deutlich abwich. Die Eastern Task Force (hauptsächlich aus britischen Streitkräften bestehend), sollte im Osten der Insel bei Syrakus und Gela landen. Die Western Task Force erhielt Palermo bzw. den Südwesten Siziliens als Angriffsziel. Diese Aufteilung der Invasionsstreitkräfte sollte die Kräfte der Verteidiger binden und konzentrierte Angriffe auf die Invasionstruppen verhindern. Ein Fokus der Planer lag dabei auf dem Südosten Siziliens rund um Syrakus und den Flugfeldern nahe Gela. In den ursprünglich entworfenen Plänen sollten an den Landungen im Südosten der Insel drei britische Divisionen und eine US-Division beteiligt sein. Zwei Tage nach dieser Landung waren weitere Operationen gegen Palermo geplant.
Der später umgesetzte Operationsplan, dessen Form davon deutlich abwich, beruhte vor allem der Intervention Bernard L. Montgomerys. Ab dem 13. März 1943 begann dieser aktiv in die Planungen zur Operation HUSKY einzugreifen – unter anderem durch die Forderung, der östlichen Landungstruppe grössere Kontingente an Truppen und Material zur Verfügung zu stellen. Angeregt wurde eine Schwächung des auf Gela gerichteten Landekopfs. Allerdings bestand Arthur Tedder auf einer Einnahme der Flugfelder, um die alliierten Streitkräfte früh aus der Luft unterstützen zu können. Ein weiteres Problem entstand durch die begrenzten Transportkapazitäten. Die Verstärkung der für den Südosten geplanten Operation hätte die gegen Palermo gerichtete Landung der US-Streitkräfte nicht nur geschwächt. Es wäre auch zu Störungen des Zeitplans gekommen.
Ein Grund für die Ablehnung des ursprünglichen Operationsplans durch den Kommandierenden der 8. Armee war die in seinen Augen falsche Einschätzung der Verteidigung Siziliens. Montgomery ging davon aus, dass Italiener und Wehrmacht den Angreifern heftigen Widerstand entgegensetzen würden. Aufgrund seiner Annahme regte Montgomery Änderungen an und legte eigene Pläne für die Invasion vor. Ein Schritt, den viele Beteiligten kritisierten – unter anderem Admiral Andrew Cunningham und Arthur Tedder.
Allerdings fielen die Reaktionen einiger Beteiligten auch erleichtert aus. Bislang verliefen die Planungen zur Operation HUSKY alles andere als reibungslos. Gerade das Chaos und die Zurückhaltung der Oberbefehlshaber wurde immer mehr zum Problem. Ein Grund hierfür bestand in der Tatsache, dass die militärische Führung der einzelnen Planungsstäbe – wie beispielsweise General Harold Alexander – noch bis ins Frühjahr 1943 mit den Kämpfen in Tunesien beschäftigt war. Damit fehlte den Planungsstellen die nötige Führungsautorität. Die bereits für Juni 1943 geplante Landung musste auf den Juli 1943 verschoben werden. Montgomery legte mit seiner Kritik den Finger in eine offene Wunde.
Gerade die Befehlshaber der Luft- und Marinestreitkräfte beharrten im Streit mit Montgomery auf ihren Standpunkten. Air Chief Marshal Arthur Tedder machte Ende April mit Nachdruck deutlich, dass eine wirkungsvolle Luftunterstützung nur durch die Einnahme der Flugfelder im Raum Gela möglich sei. Und Admiral Cunningham unterstrich die drohenden Gefahren, welche die Konzentration so vieler Schiffe auf engem Raum bedeutete. Anfang Mai 1943 gelang den Beteiligten schliesslich endlich der Durchbruch im Streit um die Operationsplanung. Die Landung bei Palermo wurde gestrichen. Stattdessen sah der neue Plan eine Landung der US-Streitkräfte im Raum Gela – Licata vor. Hier sollten die Truppen unter George S. Patton Ponte Olivo und Biscati einnehmen sowie die Hafenstadt Licata sichern. Aus Sicht von General Patton eine Aufgabe, die in erster Linie darin bestand, die Flanke der 8. Armee zu sichern – und die US-Streitkräfte zu Statisten in der 2. Reihe machte.
Der Operationsplan für die Landung auf Sizilien sah insgesamt 5 Phasen vor:
- Vorbereitungen der Luft- und Marinestreitkräfte, um die Herrschaft zu Luft und zur See zu sichern
- Luftlandungen in der Nacht zum 10. Juli 1943, Landungen der Bodentruppen vor Sonnenaufgang (Einnahme der Flugfelder sowie der Häfen Syrakus und Licata)
- Errichtung eines sicheren Landekopfs
- Eroberung der Städte Augusta und Catania
- Einnahme der gesamten Insel
Zur Erfüllung diese Operationsplans sollte die 8. Armee unter Montgomery im Raum Syrakus/Pozzallo, bestehend aus dem XIII. Korps, dem XXX. Korps und der 231. Infanterie-Brigade, in den Morgenstunden des 10. Juli 1943 landen. Unterstützung erhielt die britische 8. Armee durch die 1. Luftlande-Brigade, die Brücken einnehmen und den Feind stören sollte. Nach der Sicherung des Landekopfes sollte das XIII. Korps mit dem Vormarsch in Richtung Catania beginnen. Für das XXX. Korps war ein Vormarsch nach Nordwesten vorgesehen, das Fühlung mit der 7. US-Armee aufnehmen sollte.
Die US-Streitkräfte sollten im Golf von Gela landen und ihre Angriffe gegen Gela sowie Scoglitti, die Flugfelder von Ponte Olivo, Biscari und Comiso bzw. die Stadt Licata richten. Anschliessend war für die 7. Armee lediglich eine Deckung der Flanke Montgomerys vorgesehen. Patton standen nur drei Divisionen zur Verfügung, die durch Einheiten der Ranger und 82nd Airborne Division ergänzt wurden. Dabei übernahmen die 1st Infantry Division und die 45th Infantry Division als II Corps den Vormarsch Richtung Gela/Scoglitti, während die 3rd Infantry Division im Raum Licata an Land gehen sollte.
Beteiligte Streitkräfte
An der Invasion von Sizilien trugen fünf Staaten die Hauptlast der Kämpfe: Auf Seiten der angreifenden Alliierten standen Gross-britannien, Kanada und die USA den Verteidigern der Insel, bestehend aus italienischen Verbänden und Teilen der Wehrmacht, gegenüber.
Die anglo-amerikanischen Verbände bildeten zusammen die 15. Army Group, die nach dem Abschluss der Operation in veränderter Zusammensetzung die Aufgabe der Eroberung Italiens übernahm. Zum Zeitpunkt der Operation Husky bestand die Armeegruppe aus der 7. US-Armee und der britischen 8. Armee. Der 8. Armee unter Bernard L. Montgomery wurden für die Landung südlich Syrakus das 13. Korps und 30. Korps unterstellt. Den US-Verbänden unter der Führung von George S. Patton unterstand ursprünglich nur ein Armeekorps. Durch eine Reorganisation seiner Streitkräfte verfügte Patton ab Mitte Juli 1943 aber über zwei Korps – das 2. US-Korps und das US Provisional Corps. Darüber hinaus verfügten beide Armeen über diverse Reserve- und Unterstützungseinheiten wie Kommandotruppen, Panzerjagdverbände und Artillerieeinheiten.
Die auf Sizilien stationierten Streitkräfte der Achsenmächte bestanden aus einer Mischung kampfstarker und erfahrener Verbände und Einheiten mit zweifelhaftem Kampfwert. Den Kern der kampfstarken Verbände bildeten zwei deutsche Verbände – die 15. Panzergrenadier-Division und die Panzer-Division „Hermann Göring“. Als deutlich schwächer waren die in Sizilien stationierten Küstendivisionen einzuschätzen. Zum Schutz der Küstenlandstriche vor Landeoperationen aufgestellt, rekrutierte sich deren Mannschaftsbestand aus der älteren Bevölkerung und aus dem Ruhestand reaktivierten Armeeangehörigen.
Die Landungen
Die Landungen fanden bei Sturm statt, was die Operation erheblich erschwerte, jedoch auch ein Überraschungselement bedeutete. Die britische Armee landete an der südöstlichen, die US-amerikanische an der südwestlichen Küste.
Vor dem eigentlichen Angriff auf Sizilien besetzten die Alliierten vom 11. bis zum 14. Juni 1943 die kleinen Inseln Pantelleria, Lampedusa, Lampione und Linosa. Als erste Operation unmittelbar gegen Sizilien wurden in der Nacht vom 9. auf den 10. Juli Fallschirmjäger abgesetzt, jeweils zwei Einheiten auf britischer und auf US-amerikanischer Seite. Für die 82. US-Luftlandedivision war es der erste Einsatz. Die Flugzeuge konnten aufgrund des Sturms den Kurs nicht halten und wurden weit abgetrieben, so dass nur etwa die Hälfte der abgesetzten Einheiten den Sammelpunkt erreichte. Die Briten setzten Lastensegler ein, jedoch mit ähnlich geringem Erfolg: Nur zwölf der 144 Segler erreichten das Ziel, einige stürzten sogar ins Meer. Die dennoch abgesetzten Soldaten griffen Patrouillen an und erzeugten beim Gegner Verwirrung.
Die Invasionsflotte befand sich beim Start der Luftlandeeinheiten bereits auf See und war schon am 9. Juli um 16:30 Uhr von der Luftaufklärung der Achsenmächte gesichtet worden. Dennoch traf die Anlandung auf wenig Widerstand, zumal die Achsenmächte ihre geringe Zahl von Schiffen nicht gegen die weit überlegene alliierte Seestreitmacht einsetzen wollten. Um 2:45 Uhr am 10. Juli betraten die ersten US-amerikanischen, 90 Minuten später die ersten britischen Soldaten sizilianischen Boden. Die italienischen Truppen waren unzureichend ausgerüstet an der Küstenlinie stationiert und leisteten kaum Widerstand. Die Briten marschierten nahezu problemlos in den Hafen von Syrakus ein. Nur an der US-amerikanischen Landungsküste fand ein gross angelegter Gegenangriff statt. Am 11. Juli sandte Patton seine Reserve-Fallschirmjäger ins Gefecht, jedoch schien davon nicht jede Einheit informiert worden zu sein; kurz nach einem Luftangriff der Achsenmächte erschienen die alliierten Flugzeuge und wurden von den eigenen Bodentruppen für einen weiteren Luftangriff gehalten. 37 der 144 Maschinen wurden abgeschossen.
Die Invasionsstreitmacht bestand aus knapp 3000 schwimmenden Einheiten – darunter sechs Schlachtschiffe und zwei Flugzeugträger – sowie aus gut 2500 Flugzeugen. Mit dem Ende der ersten Anlandungsphase befanden sich rund 181.000 alliierte Soldaten mit 1800 Geschützen, 600 Panzern und 14.000 anderen Fahrzeugen auf der Insel. Die Alliierten setzten die Truppenverlegungen nach Sizilien fort, so dass Ende August rund 470.000 Soldaten auf der Insel angekommen waren.
Der Landkampf
Die Pläne für den Kampf nach der Invasion waren nicht bis ins Detail ausgearbeitet worden. Jede Armee sollte ihre eigenen Ziele verfolgen, nur die Grenze zwischen den beiden Armeen war definiert. Der Fortschritt in den ersten zwei Tagen war aus alliierter Sicht überwältigend. So wurden Vizzini im Westen und Augusta im Osten eingenommen. Am 13. Juli meldete der deutsche Generalfeldmarschall Albert Kesselring nach Berlin, dass die italienischen Truppen versagt hätten. Die deutschen Truppen müssten den Kampf nahezu ohne Luftunterstützung allein fortführen. Zugleich betonte er, dass er die Insel ohne massive Verstärkung nicht würde halten können.
Dennoch nahm der Widerstand im britischen Sektor nach den ersten Tagen der Invasion zu. Montgomery überzeugte Alexander, die Grenze zwischen den beiden Armeen zu verschieben, damit seine britische Armee den Widerstand umgehen und ihre Schlüsselrolle bei der Einnahme von Messina bewahren konnte, während die US-amerikanische Armee den Schutz und die Unterstützung ihrer Flanke übernahm. Patton jedoch erstrebte ein grösseres Ziel für seine Armee und wagte den Versuch, Palermo einzunehmen. Während ein Aufklärungstrupp Agrigent einnahm, versuchte er Alexander zu überzeugen, seinen Vorstoss fortzusetzen. Alexander lehnte dies ab, sein entsprechender Befehl wurde jedoch angeblich bei der Übertragung verstümmelt, und als die Situation sich aufklärte, stand Patton bereits vor Palermo.
Unterdessen hatte Kesselring unentschlossen gehandelt. Zwar hatte er das Halten der Insel für unmöglich erklärt, einen Rückzug lehnte er aber trotzdem ab. Erst Ende Juli führte er im grösseren Umfang Truppen vom Festland zu, erklärte aber zugleich, dass er mit der schnellen Verstärkung der Alliierten über die eroberten Häfen nicht Schritt halten könne. Als strategisches Ziel gab er an, den Nordosten der Insel so lange wie möglich zu halten und damit eine Invasion des italienischen Festlandes möglichst lange hinauszuzögern. Hitler gab zudem den Befehl, dass die Deutschen das Kommando über die verbleibenden italienischen Einheiten übernehmen und das italienische Kommando „ausschalten“ sollten. Als Folge dieses Vorgehens kam es zu Scharmützeln zwischen Italienern und Deutschen. Am 31. Juli übergab Guzzoni dennoch offiziell das Kommando über die Insel an den deutschen General Hans Hube.
Nachdem Palermo am 22. Juli eingenommen, damit ganz Westsizilien unter alliierter Kontrolle war und die britische Armee immer noch südlich von Messina festsass, befahl Alexander einen Angriff von beiden Seiten auf die Stadt. Patton jedoch wollte Messina vor den Briten einnehmen. Er schrieb: „Das ist wie ein Pferderennen, in dem das Ansehen der US-Armee auf dem Spiel steht“. Entsprechend setzte er seinen Stoss nach Osten fort; dort traf er bald auf erheblichen Widerstand. Die Achsenmächte hatten um die Stadt herum einen starken Verteidigungsring angelegt, die „Ätna-Linie“, um den eingeschlossenen Truppen einen möglichst raschen Rückzug auf das Festland zu ermöglichen. Patton begann seinen Angriff auf die Front von Troina, allerdings war dies der Dreh- und Angelpunkt der deutschen Verteidigung und dementsprechend befestigt. Die Alliierten kamen nur noch langsam voran. Trotz weiterer amphibischer Anlandungen gelang es den Deutschen, ihre Truppen mit dem Unternehmen Lehrgang auf das Festland zurückzuverlegen. Die Deutschen konnten fast 40.000 Soldaten, gut 9000 Fahrzeuge, 27 Panzer und 94 Geschütze in Sicherheit bringen. Die Italiener retteten 62.000 Soldaten auf das Festland. Teile der 3. US-Infanteriedivision drangen Stunden nach dem Auslaufen des letzten deutschen Schiffs am 17. August in Messina ein. Damit hatte Patton das „Rennen“ gewonnen.
Konsequenzen und Folgen
Auf der Seite der Achsenmächte wurden 4678 deutsche und 4325 italienische Soldaten getötet. 13.500 Deutsche und 32.500 Italiener wurden verwundet, 116.681 Italiener und 5532 Deutsche gefangen genommen. Die Italiener verzeichneten unmittelbar nach dem Ende der Kämpfe 40.655 Vermisste, die Deutschen 4583. Im Zusammenhang mit der Einnahme des Flugplatzes von Biscari kam es zum Massaker von Biscari, bei dem US-Truppen 76 Kriegsgefangene töteten. Auf US-amerikanischer Seite fielen 2811 Soldaten, 6544 wurden verwundet oder gerieten in Gefangenschaft. Die Briten hatten 2721 Tote zu beklagen, mit 10.122 verwundeten oder gefangenen Soldaten. Für viele US-amerikanische Einheiten war es der erste Einsatz. Rund 21.000 alliierte Soldaten erkrankten an Malaria, die damals oft tödlich war.
Die Operation Husky war die grösste amphibische Operation im Zweiten Weltkrieg, was angelandete Truppen und Frontaufbau betrifft. Sie übertraf sogar die Landungen in der Normandie. Strategisch gesehen konnten die Alliierten alle ihre geplanten Ziele erreichen. Luft- und Seestreitkräfte der Achsenmächte wurden von der Insel vertrieben und Seestrassen im Mittelmeer geöffnet.
Nach der Einnahme Palermos am 22. Juli setzte der Grosse Faschistische Rat Mussolini am 25. Juli 1943 mit einfachem Mehrheitsbeschluss ab. Mussolini wurde, als er seine Demission vom Amt des Ministerpräsidenten einreichen wollte, auf Befehl von König Viktor Emanuel III. verhaftet und an wechselnden Orten interniert, um eine eventuelle Befreiungsaktion zu erschweren. Inzwischen verhandelte Marschall Pietro Badoglio mit den US-Amerikanern und schloss mit ihnen den Waffenstillstand von Cassibile, der am 8. September 1943 öffentlich gemacht wurde. Daraufhin besetzten deutsche Truppen Italien („Fall Achse“).
Donez-Mius-Offensive (17.06.1943 – 02.08.1943)
Die Donez-Mius-Offensive war eine sowjetische militärische Operation während des Zweiten Weltkrieges an der deutsch-sowjetischen Front. In ihrem Verlauf kam es zwischen dem 17. Juli und dem 2. August 1943 zu grösseren Kämpfen zwischen der Roten Armee und der Wehrmacht an den Flüssen Donez und Mius. Das Ziel der sowjetischen Südwest- und Südfront war, die deutsche Führung zum Abzug von Verbänden des Unternehmens Zitadelle bei Kursk zu zwingen und das wirtschaftlich bedeutende Donezbecken zurückzuerobern. Nach geringen Anfangserfolgen gelang es der deutschen Heeresgruppe Süd jedoch, die sowjetische Offenensive aufzufangen und stellenweise die alte Frontlinie wiederherzustellen.
Hintergrund
Einige Tage nach dem Beginn der deutschen Offensive am 5. Juli 1943 bei Kursk zeigte sich, dass die sowjetische Zentralfront und die Woronescher Front, die mit deren Abwehr beauftragt waren, grosse Verluste erlitten und zunehmend unter Druck gerieten. Um sie zu entlasten, erteilte die Stawka der Südwestfront unter Generaloberst Rodion Malinowski und der Südfront unter Generaloberst Fjodor Tolbuchin am 7. Juli den Auftrag, eine Angriffsoperation vorzubereiten. Die Truppen der Südwestfront sollten den Donez überqueren und danach auf die Stadt Stalino vorstossen. Die Verbände der Südfront hatten den Auftrag, gleichzeitig über den Mius und die Krynka vorzustossen und ebenfalls Stalino zu erreichen. Bei einem Gelingen dieser Operationen wäre ein grosser Teil der deutschen Heeresgruppe Süd eingekreist und das wirtschaftlich bedeutende Donezbecken zurückerobert worden.
Sowjetische Planungen
Die sowjetische Südwestfront umfasste zu diesem Zeitpunkt die 1. Gardearmee (W. I. Kusnezow), die 8. Gardearmee (W. I. Tschuikow) und die 3. Gardearmee in erster Linie, sowie die 12. Armee, das 23. Panzerkorps (General E. G. Puschkin) und 1. mechanisierte Gardekorps (Generalmajor M. D. Solomatin) in der Reserve. Unterstützt wurden diese Kräfte durch die 17. Luftarmee. Insgesamt kamen 202.430 Soldaten und 1.109 Panzer zum Einsatz.
Der Plan des Fronthauptquartiers sah vor, dass zunächst die 1. und die 8. Gardearmee aus dem Raum Isjum heraus den Donez überschreiten und die deutsche Verteidigung durchbrechen sollten. Ihr Operationsziel sollte die Stadt Barwenkowo sein. Den so geschaffenen Durchbruch sollte danach die 12. Armee ausnutzen, um den Brückenkopf bis Krasnoarmejsk auszudehnen. Erst nach der Vollendung des Durchbruchs und der Errichtung eines Brückenkopfes auf dem jenseitigen Flussufer plante Generaloberst Malinowski seine gepanzerten Reserven, das 23. Panzerkorps und das 1. mechanisierte Gardekorps, einzusetzen, um in die Tiefe des Raumes vorzustossen und Stalino zu erreichen.
Zur Unterstützung dieses Angriffs sollte auch die 3. Gardearmee (G. I. Chetagurow) weiter östlich bei Priwolnoje offensiv vorgehen, den Fluss überschreiten und die Stadt Artjomowsk einnehmen. Zur Südfront zählte zu jenem Zeitpunkt die 51. Armee (G. F. Sacharow), links davon die 5. Stossarmee (W. D. Zwetajew), im Zentrum die 28. Armee (W. F. Gerassimenko) und an der linken Flanke die 44. Armee (W. A. Chomenko). Als Reserve stand die 2. Gardearmee (J. G. Kreiser) bereit. Zusammen waren dies fünf Armeen mit 28 Schützendivisionen, zwei mechanisierte Korps, drei Panzerbrigaden und ein Kavalleriekorps. Unterstützung erhielten diese Verbände durch die 8. Luftarmee (Generalleutnant T. T. Chrjukin). Insgesamt waren dies 271.790 Soldaten und 737 Panzer. Das Fronthauptquartier plante, den Schwerpunkt des Angriffs in einen etwa 20 km breiten Bereich zwischen der 5. Stossarmee und der 28. Armee zu legen. Diese Armeen sollten den Mius überqueren und die deutsche Verteidigung durchbrechen. Die 2. Gardearmee sollte danach den erzielten Einbruch ausnutzen und in den rückwärtigen Raum der deutschen Verteidigung vorstossen, um dort bei Stalino auf die Verbände der Südwestfront zu stossen. Die 44. und die 51. Armee hatten mit einem Teil ihrer Kräfte am linken und rechten Flügel Unterstützungsangriffe vorzutragen.
Insgesamt konnten die Südwestfront und die Südfront 474.220 Soldaten und 1.846 Panzer zum Angriff bereitstellen. Die Gesamt-kräfte beider Fronten zählten nach älterer sowjetischer Literatur jedoch weit mehr: 1,27 Millionen Soldaten, 2.150 Panzer, 20.754 Geschütze und Minenwerfer sowie 1.604 Flugzeuge.
Deutsche Lage
Da die deutsche Heeresgruppe Süd unter Generalfeldmarschall Erich von Manstein massgeblich an der Offensive bei Kursk beteiligt war, hatte sie den grössten Teil ihrer Kräfte auf ihren Nordflügel verlegt. Entlang dem Mius stand die 6. Armee (Generaloberst Karl-Adolf Hollidt) mit dem XXIX. Armeekorps (drei Infanterie-Divisionen, eine Kampfgruppe), dem XVII. Armeekorps (drei Infanterie-Divisionen) und dem Korps Mieth (IV.) (eine Gebirgs-Division, zwei Infanterie-Divisionen). In ihrer Reserve befand sich nur die Masse der 16. Panzer-Grenadier-Division. Nördlich davon stand die 1. Panzerarmee (Generaloberst Eberhard von Mackensen) mit dem XXX. Armeekorps (drei Infanterie-Divisionen), dem XXXX. Panzerkorps (drei Infanterie-Divisionen) und dem LVII. Armeekorps (drei Infanterie-Divisionen) am Donez. Als Heeresgruppenreserve hatte Generalfeldmarschall von Manstein das XXIV. Panzerkorps unter General der Panzertruppe Walther Nehring zurückgehalten. Es umfasste die 17. und die 23. Panzer-Division sowie die SS-Panzergrenadier-Division „Wiking“. Diese Kräfte verfügten insgesamt über 223 Panzer, 145 Sturmgeschütze und 115 Selbstfahrlafetten.
Generalfeldmarschall von Manstein hatte bereits Ende Mai 1943 damit gerechnet, dass die Rote Armee eine Entlastungsoffensive gegen das Donezbecken führen würde, sobald Unternehmen Zitadelle begonnen hätte. Er war jedoch davon überzeugt, dass man auch dann keine Kräfte aus dem Kursker Bogen abziehen dürfe. Am 24. Mai 1943 fand die folgende Lageeinschätzung Mansteins Eingang in das Kriegstagebuch der Heeresgruppe Süd:

„Im Fall von ‚Zitadelle‘ ist das entscheidende Moment der Sieg in der Schlacht bei Kursk, und zwar muss die Schlacht durchgeschlagen werden, selbst auf die Gefahr einer schweren Krise im Donezgebiet hin. Dabei ist von vornherein in Rechnung zu stellen, dass dem Gegner auf der weit gespannten Front der Heeresgruppe tiefe Einbrüche bei der 6. Armee und 1. Panzer-Armee gelingen werden“.
Die deutsche Feindaufklärung hatte um den 12. Juli die verstärkten sowjetischen Angriffsvorbereitungen am Mius und Donez erkannt. Dies war einer der Gründe für den Abbruch des Unternehmens Zitadelle bei Kursk in den folgenden Tagen. Zudem gestattete dieser Umstand den deutschen Truppen, sich auf die Abwehr des Angriffs vorzubereiten. Südlich des Donez war die Verteidigung in zwei Linien mit sechs bis acht Kilometer Tiefe organisiert. Einzelne Ortschaften waren befestigt und zu Wider-standsnestern ausgebaut worden. Am Mius befanden sich ebenfalls ausgebaute Stellungen mit Feldstellungen und Draht-hindernissen, darunter die Mius-Stellung. Zusätzlich hatte man für Ausbildungszwecke einige Kilometer hinter der Frontlinie einen Übungsplatz mit zahlreichen Feldstellungen angelegt, welcher noch eine entscheidende Bedeutung erhalten sollte, da später erst in diesen Stellungen die Abwehr der sowjetischen Angriffe gelang. Im Übrigen war das Gelände fast ausschliesslich von hohen Gras- und Kornfeldern bewachsen. Nur wenige Höhen dominierten das Terrain. Diese und die wenigen Ortschaften bildeten die einzigen Orientierungspunkte auf dem Gefechtsfeld.
Verlauf
Sowjetische Offensiven am Donez und Mius
Südwestfront
Am Morgen des 17. Juli eröffnete die Südwestfront ihre Offensive gegen die 1. Panzerarmee am Donez mit einer Artillerie-vorbereitung und Schlägen der Fliegerkräfte. Der Zeitplan sah vor, innerhalb der ersten zwei Tage den Donez zu überwinden und Brückenköpfe von 20 bis 30 Kilometern Tiefe zu errichten. In den folgenden fünf bis sieben Tagen sollte dann die Linie Krasnoarmeiskoje–Konstantinowka erreicht werden, von der aus die Einnahme Stalinos vorgesehen war.
Die 1. Gardearmee des Generals Kusnezow, die insgesamt über acht Schützendivisionen und drei Panzerbrigaden verfügte, setzte das 46. Schützenkorps (53. Schützen- und 20. Gardeschützendivision) in erster Linie ein. Dieses brach nach Überwindung des Donez innerhalb der ersten Angriffsstunde in die Stellungen der deutschen 257. Infanterie-Division ein. Danach gingen die deutschen Verteidiger jedoch zu Gegenangriffen über, welche weitere Fortschritte der 1. Gardearmee vereitelten. Der Kampf nahm an dieser Stelle nun den Charakter eines erbitterten Stellungskrieges an.
Die 8. Gardearmee des Generals Tschuikow griff unterdessen zwischen Kamenka und Sinitschino an. Generaloberst Tschuikow setzte sein 33. Gardeschützen- und 29. Schützenkorps in der ersten Linie ein und liess diesen das 28. Gardeschützenkorps als zweite Welle folgen. Diese Verbände trafen hier auf den Widerstand der deutschen 46., 387. und 333. Infanterie-Division. Nach einer Artillerievorbereitung und Luftangriffen begann morgens um 7 Uhr der Angriff, der von 100 Mörsern pro Frontkilometer unterstützt wurde. Im Bereich des 33. Schützenkorps (50., 230., 243. Schützendivision, 253. Schützenbrigade) gelangen schon bald Einbrüche in die deutsche Verteidigung und die Bildung kleinerer Brückenköpfe. Diese konnten auch gegen die sechs deutschen Gegenangriffe gehalten werden, die an diesem Tag noch stattfanden. Im Bereich des 29. Gardeschützenkorps, das weiter rechts angriff, konnten sowjetische Pioniere bereits am ersten Angriffstag eine 16- und eine 60-Tonnen-Ponton-Brücke errichten. Dadurch war es möglich, die Brückenköpfe schnell durch eine grosse Anzahl weiterer Truppen zu verstärken. Am Ende des Tages stabilisierten deutsche Reserven nördlich von Chrestischje die Front. Am folgenden Tag versuchte Generaloberst Tschuikow, den Durchbruch mit Hilfe des 28. Gardeschützenkorps der zweiten Welle westlich von Slawjansk zu erzwingen. Da dies nicht gelang, wurden in den folgenden Tagen nach und nach auch das 1. mechanisierte Gardekorps und das 23. Panzerkorps in den Kampf geworfen, obwohl diese eigentlich viel später hätten eingesetzt werden sollen.
Auf der anderen Seite führte das deutsche Oberkommando aus der Heeresgruppenreserve die 17. Panzer-Division und die SS-Panzergrenadier-Division „Wiking“ des XXIV. Pz.K. heran. Diese verfügten über 84 einsatzbereite Panzer, mit denen sie umgehend zum Gegenangriff antraten. Dadurch konnte der sowjetische Einbruch vorerst abgeriegelt werden. Im Laufe der Kämpfe kam es auf beiden Seiten zu schweren Verlusten. Nach sowjetischen Angaben griffen die Deutschen etwa das Dorf Golaja Dolina (10 km nördlich von Chrestischje) am 21. Juli insgesamt fünf Mal erfolglos an und verloren dabei 25 Panzer und etwa 700 Soldaten. In den folgenden Tagen konnte die sowjetische Südwestfront trotz aller Anstrengungen keine weiteren Fortschritte erzielen. Der Brückenkopf der 1. Gardearmee stabilisierte sich zwischen den Orten Bolschaja Garschewka und Semjonowka in 12 km Breite und 2 bis 2½ km Tiefe. Die 8. Gardearmee hatte am ersten Angriffstag zwei Brückenköpfe erobert und versuchte diese in den folgenden Tagen zu vereinen. Als dies gelungen war, hatte diese Landezone schliesslich eine Breite von 25 km und 2 bis 5 km Tiefe. Im Bereich der 3. Gardearmee, die einen Unterstützungsangriff führen sollte, gelang es hingegen nicht, einen Brückenkopf zu bilden. Allerdings stellte die Südwestfront ihre Angriffshandlungen am 27. Juli ein, nachdem weitere Fortschritte nicht zu erwarten waren und die Front in den vorangegangenen zehn Tagen bereits 38.690 Soldaten verloren hatte, von denen 10.310 als gefallen oder vermisst galten.
Südfront
Inzwischen war auch die Südfront am Morgen des 17. Juli nach vorbereitenden Angriffen der Artillerie und Fliegerkräfte zum Angriff angetreten. Die 5. Stossarmee und die 28. Armee überquerten im Bereich der 294., 306. und 302. Infanterie-Division des XVII. Armeekorps (Gen.d.Inf. Wilhelm Schneckenburger) den Mius und brachen in die deutsche Verteidigungslinien ein. Es gelang ihnen bald, bei den Orten Stepanowka und Marinowka einen Brückenkopf von fünf bis sechs Kilometern Breite zu errichten. Da die 6. Armee dadurch in eine schwierige Lage geriet, wurde ihr die 23. Panzer-Division aus der Heeresgruppenreserve zugeführt. Doch noch bevor diese eintraf, liess Generaloberst Hollidt am 18. Juli die 16. Panzergrenadier-Division allein gegen die südliche Flanke des sowjetischen Vorstosses angreifen. Dieser standen jedoch inzwischen zwölf gegnerische Schützendivisionen und das 2. mechanisierte Gardekorps gegenüber, sodass die deutsche Division bald selbst in Gefahr geriet, aufgerieben zu werden. Nachdem die 23. Panzer-Division eingetroffen war liess Generaloberst Hollidt am 19. Juli einen weiteren Gegenangriff vortragen, der erneut unter grossen Verlusten scheiterte. Die deutschen Kräfte hatten sich damit erschöpft und reichten nur noch für reine Abwehr-aufgaben aus. Nunmehr versuchten am folgenden Tag neun sowjetische Schützendivisionen und das 2. mechanisierte Gardekorps einen Durchbruch zu erzielen, was angesichts des deutschen Widerstandes und unter hohen Verlusten misslang. Generaloberst Tolbuchin musste die ausgebrannten Angriffskräfte abziehen und brachte stattdessen das frische 4. mechanisierte Gardekorps im Brückenkopf in Stellung. Als dieses am 21. Juli zum Angriff antrat, gewannen die Kämpfe noch einmal deutlich an Intensität. Der Höhepunkt wurde schliesslich am 22. Juli erreicht, als das 4. mechanisierte Gardekorps mit etwa 140 Panzern zum Durchbruchsangriff antrat. Diesen konnten die beiden motorisierten Divisionen der 6. Armee zu diesem Zeitpunkt lediglich 38 eigene Panzer entgegensetzen. Durch gut positionierte Panzerabwehrwaffen und die im Erdkampf eingesetzte 8,8-cm-Flak gelang es jedoch, etwa 130 sowjetische Panzer auszuschalten. Dieser deutsche Abwehrerfolg hatte die Dezimierung der sowjetischen Hauptangriffskräfte zur Folge und führte zu einem allmählichen Abebben der Kämpfe in den folgenden Tagen. Trotzdem kam es auch weiterhin zu örtlichen sowjetischen Vorstössen, die zu kleineren Krisen auf deutscher Seite führten. Bis zu diesem Zeitpunkt war es der inzwischen eingesetzten sowjetischen 2. Garde-Armee jedoch gelungen, den Mius-Brückenkopf auf 20 km Breite und 15 km Tiefe zu erweitern.
Deutsche Abwehrmassnahmen
Nachdem Hitler am 13. Juli 1943 unter dem Eindruck der sowjetischen Gegenoffensive bei Orjol und weiteren vom Nachrichten-dienst erkannten sowjetischen Angriffsvorbereitungen die Einstellung des Unternehmens Zitadelle beabsichtigte, kündigte er an, das II. SS-Panzerkorps unter Oberstgruppenführer Paul Hausser aus dem Raum Kursk abzuziehen und es in Italien (wenige Tage zuvor waren die Alliierten auf Sizilien gelandet) gegen die Westalliierten einzusetzen. Er zögerte den Abtransport allerdings hinaus, da er sich nicht sicher war, ob diese Truppen nicht dringend zur Abwehr einer befürchteten sowjetischen Offensive im Raum Charkow gebraucht würden. Allerdings nahm man in der deutschen Führung an, dass man die Rote Armee in der Schlacht bei Kursk insofern geschwächt hätte, dass diese noch einige Tage für die Vorbereitung neuer Operation benötigen würde. In der Zwischenzeit stand das SS-Panzerkorps für einen Einsatz bei der Heeresgruppe Süd zur Verfügung, bevor es wieder in den Raum Charkow verlegt werden sollte.
Generalfeldmarschall von Manstein plante, mit dieser Verstärkung Angriffe gegen die sowjetische Südfront am Mius zu führen, wo die Lage am gefährlichsten erschien. Auf ihrem Weg dorthin müssten die Truppen jedoch auch den Bereich der 1. Panzerarmee passieren, wo sie ebenfalls zu einem Gegenschlag gegen die Brückenköpfe der sowjetischen Südwestfront antreten konnten. Generalfeldmarschall von Manstein plante deshalb, die SS-Panzergrenadier-Divisionen „Leibstandarte SS Adolf Hitler“ und „Das Reich“ quasi „im Vorbeigehen“ einen Gegenangriff am Donez führen zu lassen. Erst danach sollten sie zusammen mit der ebenfalls im Anmarsch befindlichen SS-Panzergrenadier-Division „Totenkopf“ und 3. Panzer-Division am Mius zum Einsatz gelangen. Am 24. Juli erfolgte die Bereitstellung der beiden SS-Divisionen am Donez gegenüber den sowjetischen Brückenköpfen. Doch kurz vor dem geplanten Angriffsbeginn intervenierte Hitler, der den Einsatz der Divisionen bei der 1. Panzerarmee verbot und stattdessen forderte, dass diese ausschliesslich am Mius eingesetzt werden dürften. Generalfeldmarschall von Manstein war äusserst ungehalten über dieser Einmischung in seine Operationsplanungen, musste sich den Anordnungen jedoch fügen.
Am 26. Juli wurde die Lage komplizierter, als Hitler den Abtransport der SS-Panzergrenadier-Division „Leibstandarte SS Adolf Hitler“ nach Italien befahl, ohne dass diese bei der Heeresgruppe Süd überhaupt zur Wirkung gekommen war. Des Weiteren waren die SS-Panzergrenadier-Division „Das Reich“ im Verbund mit den bereits am Mius stehenden 16. Panzer-Grenadier-Division und 23. Panzer-Division noch zu schwach für einen operativen Gegenangriff, sodass bis zum 30. Juli abgewartet werden musste, bis die übrigen beiden Panzer-Divisionen eintrafen. Erst danach konnte ein operativer Gegenangriff mit Aussicht auf Erfolg ins Auge gefasst werden.
Deutscher Gegenangriff am Mius
Nach der Darstellung Generalfeldmarschalls von Mansteins hatte die sowjetische Südfront im Mius-Brückenkopf inzwischen 16 Schützendivisionen, zwei mechanisierte Korps, eine Panzer-Brigade und zwei Panzerabwehr-Brigaden zusammengezogen. Der deutsche Operationsplan, den wiederum Generaloberst Hollidt erstellt hatte, sah vor, dass das XXIV. Pz.K. (23. Pz.Div. und 16. Pz.Gren.Div.) einen Ablenkungsangriff gegen den Südteil des Brückenkopfes führen sollte, während das II. SS-Panzerkorps (SS-Pz.Gren.Div. „Reich“ und Totenkopf, 3. Pz.Div.) den Hauptschlag weiter nördlich in Richtung des Ortes Dmitrijewka führen sollte. Das IV. Fliegerkorps hatte den Auftrag, den Angriff zu unterstützen. Eine grundsätzliche Fehlkalkulation war die Tatsache, dass die SS-Divisionen über das gleiche Gelände angreifen sollten, auf dem am 19. Juli bereits die erfolglose 23. Panzer-Division zusammengeschossen worden war. Hier hatten die sowjetischen Truppen ihre Stellungen seitdem noch ausbauen und verstärken können.
Am Morgen des 30. Juli 1943 begann der deutsche Gegenangriff. Im Bereich des II. SS-Panzerkorps trafen die Angriffsverbände auf hartnäckigen Widerstand. Zwar gelang es, den Ort Stepanowka einzunehmen, doch die sowjetischen Verbände führten immer wieder Gegenangriffe. Zugleich verhinderte das Panzerabwehrfeuer von der wichtigen Höhe 213,9 (in den Anhöhen von Saur-Mogila) jedes Vorankommen der deutschen Panzer. Durch Minenfelder und das Eingreifen der sowjetischen Luftwaffe kam es zu hohen Verlusten auf deutscher Seite. Am Ende des Tages hatten die drei Divisionen des Korps 915 Mann und 91 der eingesetzten 211 Panzer und Sturmgeschütze verloren. Dem XXIV. Panzerkorps gelangen grössere Erfolge. Die 23. Panzer- und 16. Panzer-grenadier-Division konnten westlich von Garany mehrere sowjetische Schützendivisionen einkreisen sowie 18 Panzerabwehr-geschütze und 44 Panzerbüchsen ausser Gefecht setzen. Dann erlahmte jedoch auch hier die deutsche Angriffskraft.
Auch der zweite Angriffstag brachte nur geringe Fortschritte und steigende Verluste für die deutsche Seite. In weiteren Frontal-angriffen wurden die Panzerverbände des II. SS-Panzerkorps weiter dezimiert, sodass es am Abend nur noch 20 einsatzfähige Panzer aufwies. Gleichzeitig verstärkten die sowjetischen Truppen ihre Angriffe auf Stepanowka, das von der Division „Das Reich“ gehalten wurde. Allein dabei verlor die Rote Armee 26 Panzer und 1.300 Soldaten an Gefangenen. Im Süden des Brückenkopfes machte nunmehr auch das unterstützende XXIX. Armeekorps Fortschritte, wenn auch unter hohen Verlusten. Die hier eingesetzte 294. Infanterie-Division verlor an diesem Tag beispielsweise 18 Offiziere, 123 Unteroffiziere und 1.128 Mannschaften. Hingegen baute das XXIV. Panzerkorps die Erfolge des Vortages aus. Nachdem es am Vormittag einen sowjetischen Versuch abgewehrt hatte, zu den eingeschlossenen Divisionen westlich von Garany durchzubrechen, rieb es in dem Kessel die sowjetische 3., 33. Garde- und 315. Schützendivision sowie Teile der 96. Garde-Schützendivision auf. Da dies den ganzen Tag über dauerte, gewann der Vorstoss nach Osten jedoch kaum an Boden.
Das Oberkommando der sowjetischen Südfront verstärkte die Truppen im Brückenkopf. Noch immer hielten ihre Verbände alle beherrschenden Höhen. Währenddessen wurde Generalfeldmarschall von Manstein nervös. Er wollte seine einzigen mobilen Reserven nicht vollkommen ausbrennen lassen und traf am Abend des 31. Juli selbst im Hauptquartier der 6. Armee ein. Nach Rücksprache mit den Kommandeuren der Angriffsverbände ordnete er eine Verlegung das Schwerpunktes des Angriffs an. Diese Massnahme zeigte am folgenden Tag, dem 1. August, Erfolg. Den deutschen Truppen gelang ein tiefer Einbruch in das sowjetische Stellungssystem, der zur ersten grösseren Rückzugsbewegung der Südfront führte. Am Abend dieses Tages nahm das II. SS-Panzerkorps schliesslich die beherrschende Höhe 213,9 ein. Allein die 23. Panzer-Division konnte an diesem Tag 4.193 sowjetische Gefangene verzeichnen.
Infolge dieser Ereignisse brach die sowjetische Verteidigung bald darauf zusammen, sodass die deutschen Truppen am 2. August, dem vierten Angriffstag, Dmitrijewka und den Mius erreichten. Damit war der Brückenkopf der Südfront beseitigt und die alte Verteidigungslinie wiederhergestellt.
Folgen
Über die Verluste beider Seiten gibt es nur wenige und widersprüchliche Angaben. Nach sowjetischen Unterlagen soll die Südwestfront bei ihren Angriffen am Donez vom 17. bis zum 27. Juli 38.690 Soldaten verloren haben, von denen 10.310 als gefallen oder gefangen galten. Die Südfront hat nach den gleichen Unterlagen am Mius vom 17. Juli bis zum 2. August Verluste in Höhe von 61.070 Mann erlitten, von denen 15.303 gefallen oder gefangen genommen waren. Insgesamt würden sich die Verluste dann auf 99.760 Soldaten belaufen, von denen allerdings 74.147 auf Verwundete entfielen. Karl-Heinz Frieser wies darauf hin, dass diese Angaben als zu niedrig angesehen werden müssten.
Im abschliessenden Bericht der 6. Armee wurde allein für die Kämpfe am Mius von 17.762 Gefangenen gesprochen, unter denen sich 955 Überläufer befunden hätten. Dies waren bereits mehr Soldaten als die von sowjetischer Seite zugegebenen etwa 15.000 „unwiederbringlichen Verluste“, in denen Gefangene und Gefallene zusammengerechnet worden waren. Zudem seien, so der Abschlussbericht, 732 sowjetische Panzer, 522 Pak, 197 Geschütze und 438 Granatwerfer zerstört oder erbeutet worden. Die deutschen Verluste der 1. Panzerarmee am Donez können heute nicht mehr rekonstruiert werden. Im Bereich der 6. Armee betrugen sie jedoch 3.298 Gefallene, 15.817 Verwundete und 2.254 Vermisste.
Die Ergebnisse der Kämpfe müssen differenziert betrachtet werden. Auf operativ-taktischer Ebene hatten die Süd- und Südwestfront nach dem Urteil des Historikers Karl-Heinz Frieser „kläglich versagt“, während die Deutschen einen „veritablen Erfolg“ hatten verbuchen können. Auf der strategischen Ebene bot sich jedoch ein anderes Bild. Der Chef des sowjetischen Generalstabes Marschall der Sowjetunion A.M. Wassilewski erklärte gegenüber Generaloberst Tolbuchin, dass das Ziel seiner Offensive erreicht worden wäre, da die Deutschen einige gepanzerte Verbände aus dem Raum Kursk hatten abziehen müssen. Als nun am 3. August 1943 eine grossangelegte sowjetische Gegenoffensive (→ Belgorod-Charkower Operation) begann, fehlten dort die abgezogenen Divisionen zur Stützung der deutschen Verteidigung. Wie Generalfeldmarschall von Manstein später in seinen Memoiren festhielt, war die Rote Armee bei Kursk früher als erwartet offensiv geworden. Im Rückblick bezeichnete er deshalb die Verlegung der gepanzerten Divisionen zum Gegenangriff gegen die sowjetischen Brückenköpfe als einen „verhängnisvollen“ Fehler. Dieser hätte seine Ursache jedoch letztlich darin gehabt, dass Hitler unbedingt das Donezbecken hatte behaupten wollen, anstatt dieses, wie Manstein schon im Mai 1943 gefordert hatte, zugunsten der Kursker Schlacht zu vernachlässigen. Nachdem die deutschen Panzer-Divisionen hastig wieder nach Norden verlegt worden waren, blieben die 1. Panzerarmee und 6. Armee in ihren überdehnten Stellungen stehen. Gegen sie begannen die Süd- und Südwestfront zwischen dem 13. und 16. August eine erneute Offensive (→ Donezbecken-Operation), in deren Verlauf die deutschen Stellungen durchbrochen und am 8. September Stalino eingenommen werden konnte. Mitte September 1943 begann daraufhin der allgemeine Rückzug der Heeresgruppe Süd zum Dnepr.
In der sowjetischen Historiographie wurden die Offensiven der beiden sowjetischen Fronten fast immer getrennt voneinander behandelt. So wurde der Angriff der Südwestfront als „Isjum-Barwenkowsker Operation“ (russisch Изюм-Барвенковская операция), derjenige der Südfront als „Mius-Operation“ (russisch Миусская операция) bezeichnet. Somit wurde kaum ersichtlich, dass beide Operationen aufeinander abgestimmt waren und letztlich vergeblich darauf gezielt hatten, zusammenwirkend Teile der Heeresgruppe Süd einzuschliessen und das ganze Donezbecken zurückzuerobern. Stattdessen wurde betont, dass der erfolgreiche Zweck der Offensiven einzig darin bestanden habe, deutsche Truppen aus dem Raum Kursk abzuziehen. Um den letztlichen Misserfolg der Operationen zu erklären, stellte die sowjetische Geschichtsschreibung die Mius-Linie im Nachhinein als eine Festung dar. Hier sollen die deutschen Verteidiger in tief ausgebauten Stellungssystemen gestanden haben, von denen allein schon die Hauptlinie sechs bis acht Kilometer tief gewesen sei. Pro Frontkilometer hätten 1500 bis 1800 Minen gelegen. Andererseits wurde auch die Stärke der deutschen Truppen verschleiert. So wurde in sowjetischen Darstellungen beispielsweise immer auch die „Gruppe Kempf“ zu den Verteidigern gerechnet, obwohl diese am nördlichen Flügel der Heeresgruppe Süd überhaupt nicht von den Kämpfen betroffen war.
In der deutschen Geschichtsschreibung werden diese Kämpfe ebenfalls nur selten thematisiert, weil hier der Schwerpunkt der Aufmerksamkeit auf den mehr oder weniger gleichzeitigen Ereignissen im Kursker Bogen, bei Charkow und Orjol liegt. Karl-Heinz Frieser stellte fest, dass die Abwehr der sowjetischen Offensiven praktisch „im Schatten von Kursk“ stattgefunden hätte. Er selbst war der erste Historiker, der 2007 im deutschen Sprachraum einen kurzen zusammenfassenden Abriss zu diesen bis heute wenig bekannten Operationen veröffentlichte. Dabei konnte er sich allerdings auf Vorarbeiten von George M. Nipe stützen, der auf Grundlage deutscher Quellen bereits 1996 eine operative Studie zum II. SS-Panzerkorps verfasst hatte, in welcher die Kämpfe am Mius (nicht aber derjenigen am Donez) einen breiten Raum einnahmen.
Orjoler Operation (12.07.1943 – 18.08.1943)
Die Orjoler Operation (russisch Орловская операция, auch als Operation Kutusow bekannt) war eine Offensive der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg, die als Teil der Schlacht am Kursker Bogen angesehen wird. Die Offensive begann am 12. Juli 1943 und endete am 18. August 1943. Im Rahmen der Offensive konnte zum ersten Mal das Konzept der „Operation in der Tiefe“ erfolgreich umgesetzt werden. Durch Angriffe in divergierende Richtungen konnte dabei eine Zersplitterung der deutschen Verteidigungs-massnahmen erreicht werden, die letztlich den Rückzug der deutschen Truppen aus dem Raum Orjol zur Folge hatte.
Vorgeschichte
Die sowjetisch-deutsche Front war Ende März 1943 zum Stehen gekommen, nachdem im vorangegangenen Winter grossangelegte Gegenoffensiven der Roten Armee die Verbände der Wehrmacht weit zurückgedrängt hatten. Nach der Niederlage in der Schlacht um Stalingrad war zeitweise der gesamte deutsche Südflügel in Gefahr geraten, abgeschnitten und überrannt zu werden, bevor ein Abwehrerfolg in der Schlacht bei Charkow die deutschen Linien stabilisierte. Absichten, diesen Erfolg zu weiteren Gegenangriffen auszunutzen, scheiterten am katastrophalen Zustand der deutschen Divisionen. Da jedoch auch die sowjetischen Truppen grosse Verluste erlitten hatten, beschränkten sich ab Ende März 1943 beide Seiten auf die strategische Defensive und bereiteten sich auf die Fortsetzung der Operationen nach Ende der Schlamm-Periode vor.
Sowjetische Planungen
Die Planung für die Orjoler Operation begann Ende April 1943 als Teil der Planungen für die Verteidigung von Kursk. Der ursprüngliche Plan sah den Angriff in drei Richtungen vor. Die 11. Gardearmee (General Baghramjan) der Westfront sollte zusammen mit der im Juni neu aufgestellten 4. Panzerarmee (Generalmajor Badanow) von Norden her angreifen. Zwei Angriffsgruppen der Brjansker Front, die 61. und die 3. Armee hatten zusammen mit der 63. Armee (Generalleutnant Kolpaktschi) von Osten vorzugehen. Von Süden sollte die Zentralfront mit der 13. und 70. Armee nach Norden angreifen. Die Offensive sollte beginnen, wenn der deutsche Angriff im Süden des Kursker Bogens gestoppt worden war. Die Angriffsvorbereitungen blieben der deutschen Aufklärung weitestgehend verborgen.
Truppenstärke und Aufmarsch
Drei sowjetische Fronten, die Brjansker Front unter dem Befehl von Markian Popow, die Zentralfront unter Konstantin Rokossowski und der linke Flügel der Westfront unter Wassili Sokolowski, mit einer Gesamtstärke von 1,286,049 Soldaten (davon 927.494 in den kämpfenden Truppen), 26.379 Geschützen, 2.409 Panzern und 3.023 Flugzeugen standen zwei Armeen der deutschen Heeresgruppe Mitte, der 2. Panzerarmee und der 9. Armee gegenüber. Die deutschen Verbände hatten laut Frieser zu Beginn des Unternehmens Zitadelle 495.000 Mann. Zu Beginn der Operation Kutuzov schätzt er die Stärke der Fronttruppen auf 307.000. Die beiden Armeen hatten ausserdem 5.500 Geschütze inklusive PaK und FlaK sowie 625 Panzer und Sturmgeschütze und 610 einsatzbereite Flugzeuge.
Seit 11. April 1943 wurde die deutsche 2. Panzerarmee nominell durch General der Infanterie Clössner in Vertretung des verhafteten Generals Rudolf Schmidt geführt. Generaloberst Model, dem Oberbefehlshaber der zeitgleich im Raum zwischen Ponyri und Olchowatka festgefahrenen 9. Armee, wurde darauf auch die oberste Führung im Oreler Frontbogen übertragen. Der 2. Panzerarmee waren zum Zeitpunkt des Angriffes 3 Armeekorps mit 14 Infanteriedivisionen unterstellt, als einzige bewegliche Reserve war die 5. Panzerdivision unter Generalleutnant Fäckenstedt verfügbar.
- Armeekorps (General der Infanterie Rendulic, später General der Infanterie Wiese) 34., 56., 262. und 299. Infanterie-Division
- Armeekorps (General der Infanterie Gollwitzer) 208., 211., 293. Infanterie- und 25. Panzergrenadier-Division
- Armeekorps (General der Infanterie Jaschke) 110., 134., 296. und 339. Infanterie-Division
Verlauf
Noch während des Angriffes der deutschen 9. Armee startete die Westfront unter Wassili Danilowitsch Sokolowski am 12. Juli ihren Angriff gegen die deutsche 2. Panzerarmee. Nach dreistündigem vorbereitenden Artilleriebeschuss folgte gegen 6.05 Uhr der sowjetische Infanterie- und Panzerangriff der 11. Gardearmee. Relativ schnell gelangen dem 36. Garde-Schützenkorps (Generalmajor Alexander Xenofontow) mehrere taktische Einbrüche in die schwachen vorderen deutschen Stellungen. Nachdem sechs Gardedivisionen an der Naht zwischen der deutschen 211. und 293. Infanterie-Division durchgebrochen waren, wurde das 5. Panzerkorps unter Generalmajor Sachno in die Lücke zum Vorstoss gegen Uljanowo eingeführt. Ein Gegenstoss der deutschen 5. Panzerdivision wird abgeschlagen. Am rechten Flügel Baghramjans erreichte das 16. Garde-Schützenkorps unter Generalmajor Lapschow den Durchbruch zur Resseta. Der zuzügliche Einsatz des 1. Panzerkorps (Generalleutnant Butkow) brach bis zum Abend 8 Kilometer tief in die Front des deutschen LIII. Armeekorps ein. Am Sucha-Abschnitt gegenüber der sowjetischen 3. und 63. Armee hatte General Rendulic (XXXV. A.K.) die Gefahr für die 56. und 262. Infanteriedivision richtig eingeschätzt und ausreichende Vorkehrungen getroffen. Das zwischen Mzensk und der Oserka unerwartet tiefgestaffelte deutsche Verteidigungssystem liess die starken sowjetischen Angriffe unter schweren Verlusten zerschellen.
Die deutsche Führung befürchtete bereits die Abschneidung der wichtigen Bahnlinie von Orel nach Brjansk und reagierte mit der notwendigen Verlegung einiger Divisionen aus dem Bereich der 9. Armee. Dies hatte zur Folge, dass die ohnehin langsam vorankommenden deutschen Verbände am nördlichen Abschnitt des Kursker Frontbogen noch mehr an Kraft verloren. Am 14. Juli traf zur Verstärkung des LIII. Armeekorps das Panzer-Regiment 52 und die 20. Panzerdivision an der Linie Sorokino-Ukolizy ein und brachten den Vormarsch das 36. Garde-Schützenkorps zum Stehen. Die 34. Infanterie-Division hielt das von Norden und Osten bedrängte Bolchow gegen die sowjetische 61. Armee (Generalleutnant Pawel Below). Am 17. Juli griff die sowjetische 63. Armee aus dem Raum westlich Nowosil nochmals gegen Bortnoje an und brach durch das neu eingeführte 1. Garde-Panzerkorps an der Front der deutschen 36. und 56. Infanterie-Division durch. Die neu herangeführte 12. Panzerdivision (Generalleutnant von Bodenhausen) verhinderte den Verlust Orjols und hielt am Optucha-Abschnitt stand.
Zur Erhöhung der Angriffskraft führte die Stawka die strategischen Frontreserven in die Schlacht ein. Am 19. Juli bei der Brjanskerfront die 3. Gardepanzerarmee (Generalleutnant Rybalko), am 20. Juli bei Westfront zuerst die 11. Armee (Generalleutnant Fedjuninski), und am 26. Juli schliesslich auch die 4. Panzerarmee (Generalleutnant W. M. Badanow). Dem 46. Schützenkorps (Generalmajor Konstantin M. Jerastow) der sowjetischen 61. Armee gelang am 28. Juli die Eroberung von Bolchow. General der Infanterie Zorn, Kommandierender General des XXXXVI. Panzerkorps fiel am 2. August südlich von Orjol durch einen sowjetischen Fliegerangriff.[10]
Am 5. August fiel die Stadt Orjol in die Hände der sowjetischen 63. Armee. Am 6. August näherten sich das 8. und 36. Garde-Schützenkorps von Nordwesten und Südosten der Stadt Chotynez, das 16. Garde-Schützenkorps (Fedjunkin) ging gleichzeitig auf Karatschew vor, während das 25. Panzerkorps in Richtung Bunino angesetzt wurde. Als Reserve wurde das 30. Panzerkorps (General Rodin) von der 4. Panzerarmee eingeführt. Am rechten Flügel der 11. Gardearmee blieb das 16. Garde-Schützenkorps am Wytebetfluss stecken und musste durch die 217. Schützendivision (Oberst Ryschikow) verstärkt werden. Am 9. August schnitten das 8. Gardekorps (General Malyschew) und das 1. Panzerkorps die Bahnlinie nach Karatschew ab. Das 36. Garde-Schützenkorps drang in den Westteil von Chotynez ein, das von den Deutschen vorzeitig geräumt wurde.
Aufbauend auf diesen Erfolg setzte die sowjetische 11. Gardearmee weiter nach Westen und begann am 12. August von Süden und aus dem Osten den Angriff auf Karatschew. Generaloberst Model verstärkte die 293. Infanteriedivision im Raum Karatschew mit der Division Grossdeutschland, der 8. Panzer- sowie 34. und der 56. Infanterie-Division. Vom Norden griff die sowjetische 11. Armee mit der 238. und 369. Schützendivision gegen die Stadt an. Die Einkreisung Karatschews von Norden zwang die Deutschen am 13. August zusätzlich die 78. Sturmdivision heranzuziehen und die Stadt am 14. August aufzugeben.
Die deutsche Führung war nicht mehr in der Lage die überlegenen sowjetischen Verbände zu stoppen. Generaloberst Model kämpfte noch hinhaltend, um das schwere Heeresgerät aus den Frontbogen zu bekommen und zog seine Truppen stetig in die Tiefe zurück. Alle Wehrmachtsverbände setzten in Richtung der Hagenstellung ab. Die Hagenstellung war eine ausgebaute Stellung im Hinterland, sie verlief in Nord-Süd-Richtung und stellte für die Wehrmacht eine günstig zu verteidigende Linie dar. Ausserdem konnten durch diese Frontverkürzung mehrere Divisionen frei gemacht werden, welche entweder direkt zu kritischen Frontabschnitten gebracht werden konnten oder als Reserven benutzt wurden.
Verluste und Folgen
Die Rote Armee stiess auf der 400 Kilometer breiten Front bis zu 150 Kilometer nach Westen vor, zerschlug 14 deutsche Divisionen (nach sowjetischen Angaben 90.000 Tote) und verlor 430.000 Soldaten (113.000 Tote), 2.500 Panzer, 900 Geschütze und 1.000 Flugzeuge. Von den auf deutscher Seite eingesetzten 90 Jagdpanzern vom Typ „Ferdinand“ gingen 39 verloren.