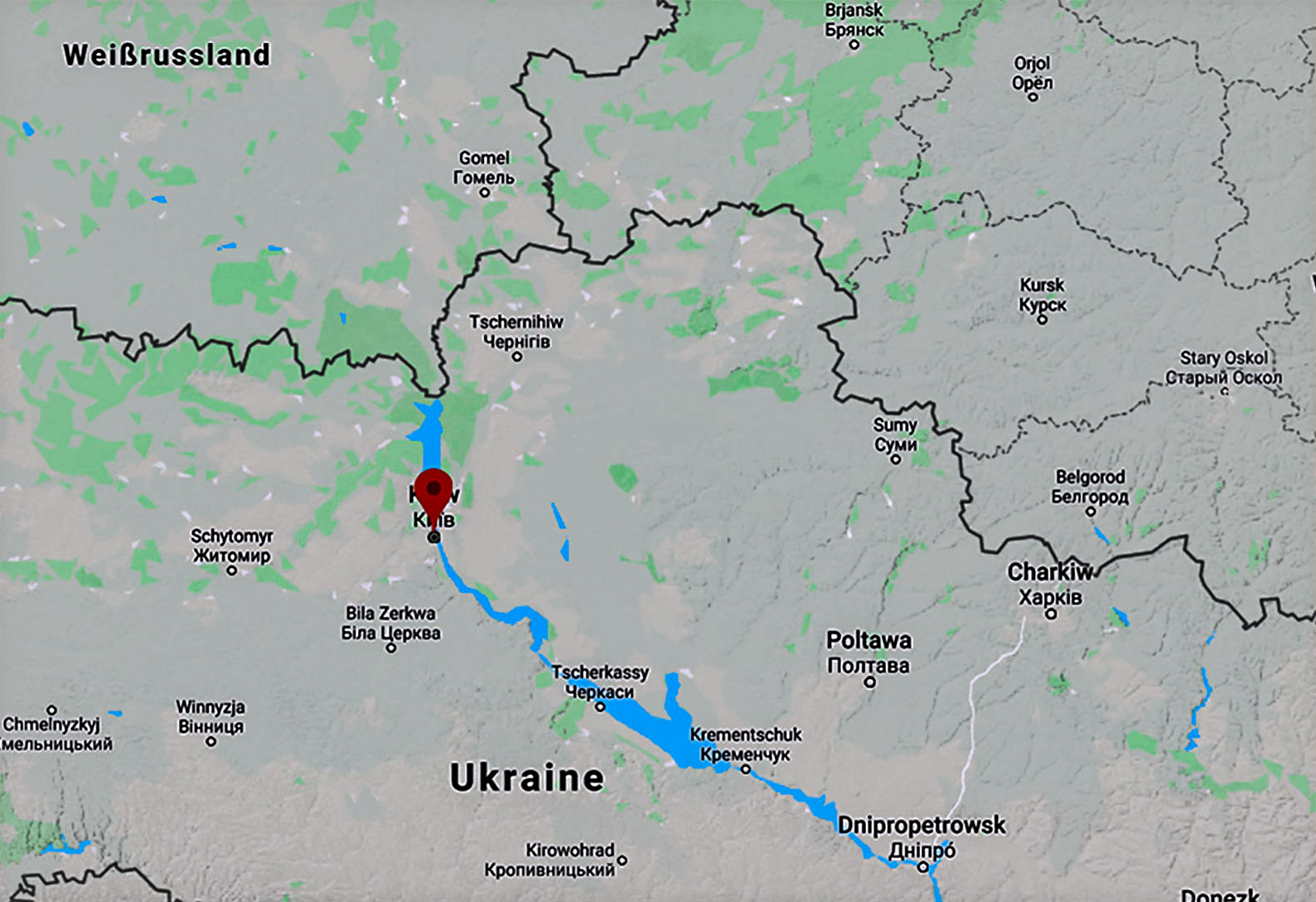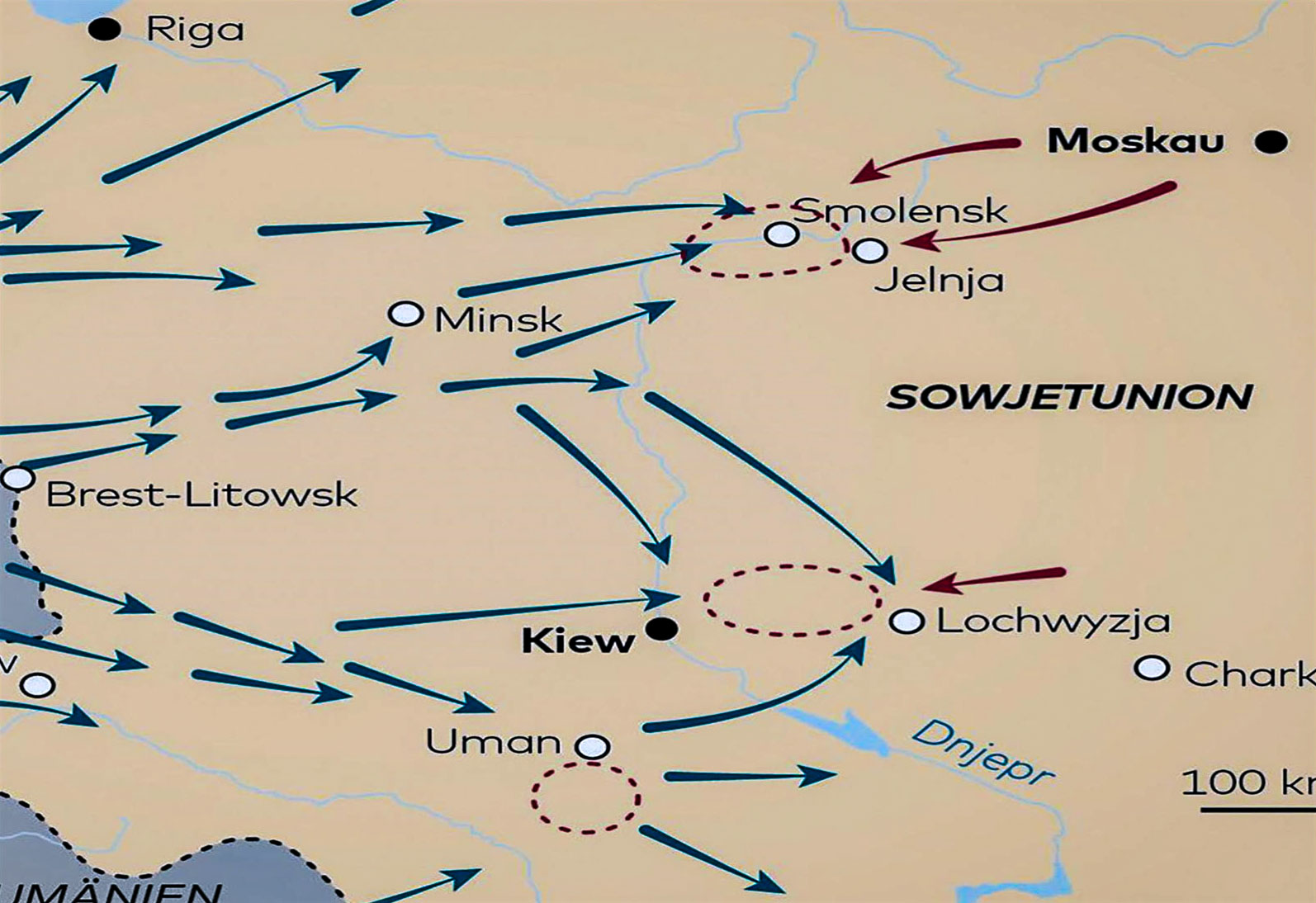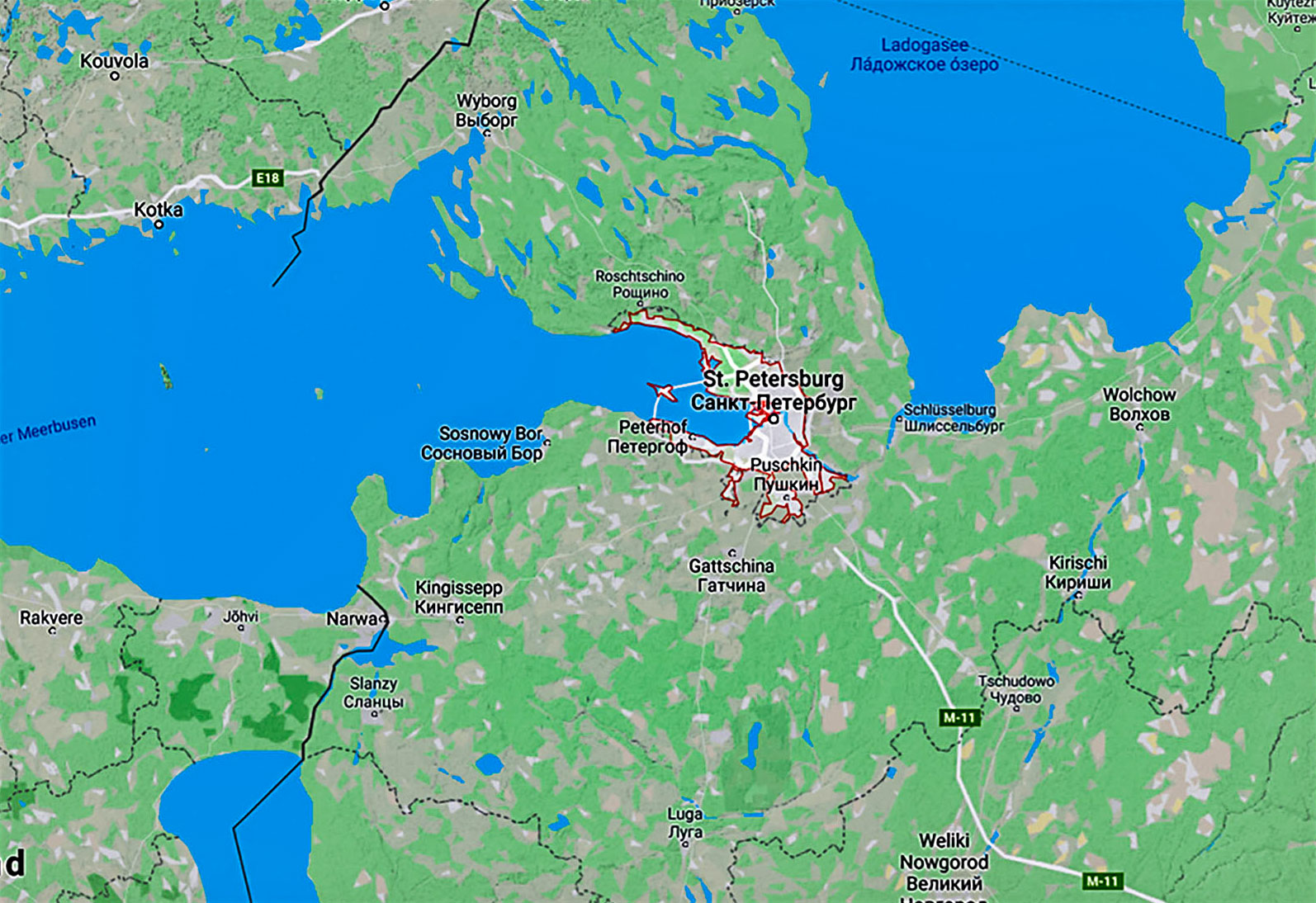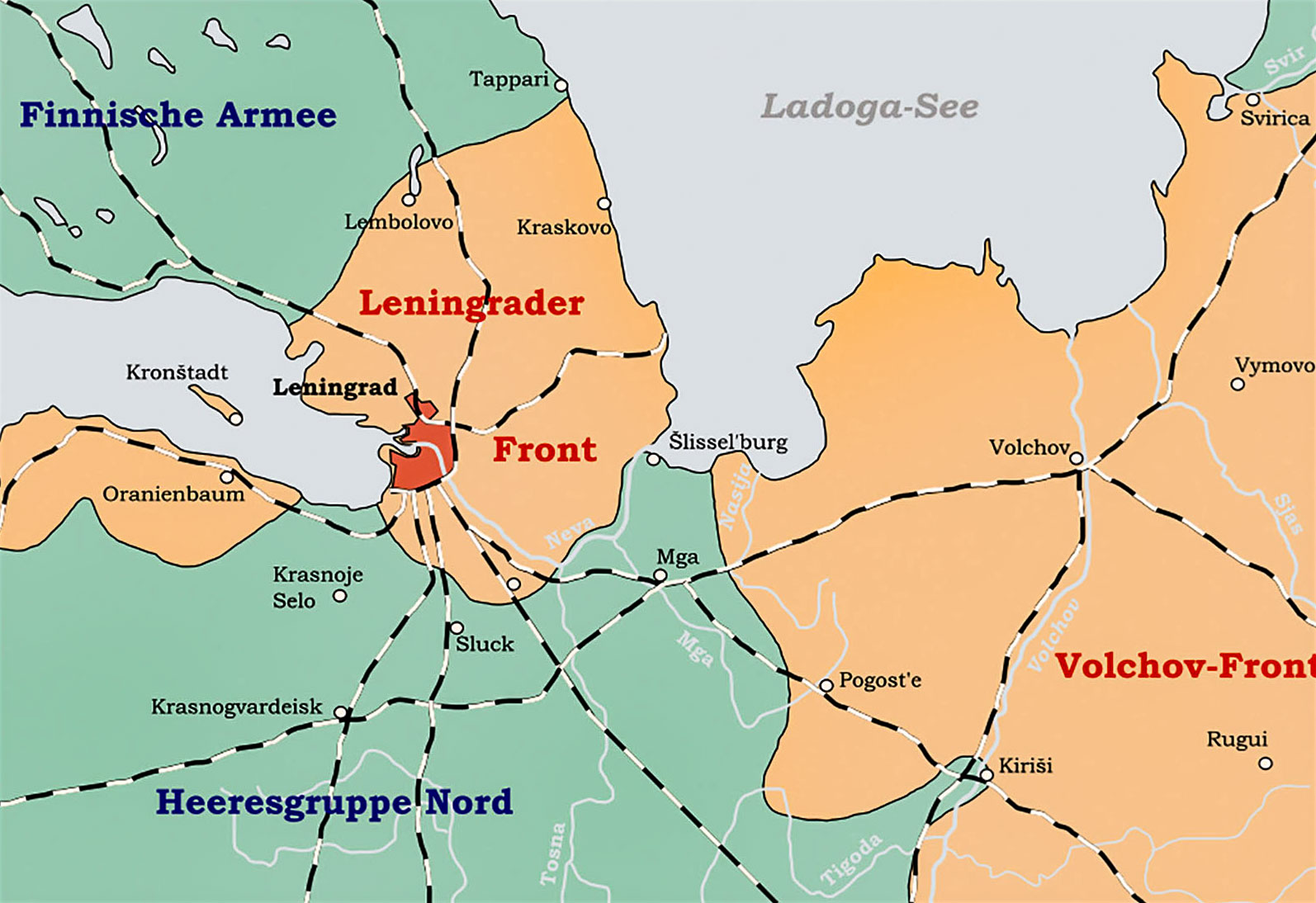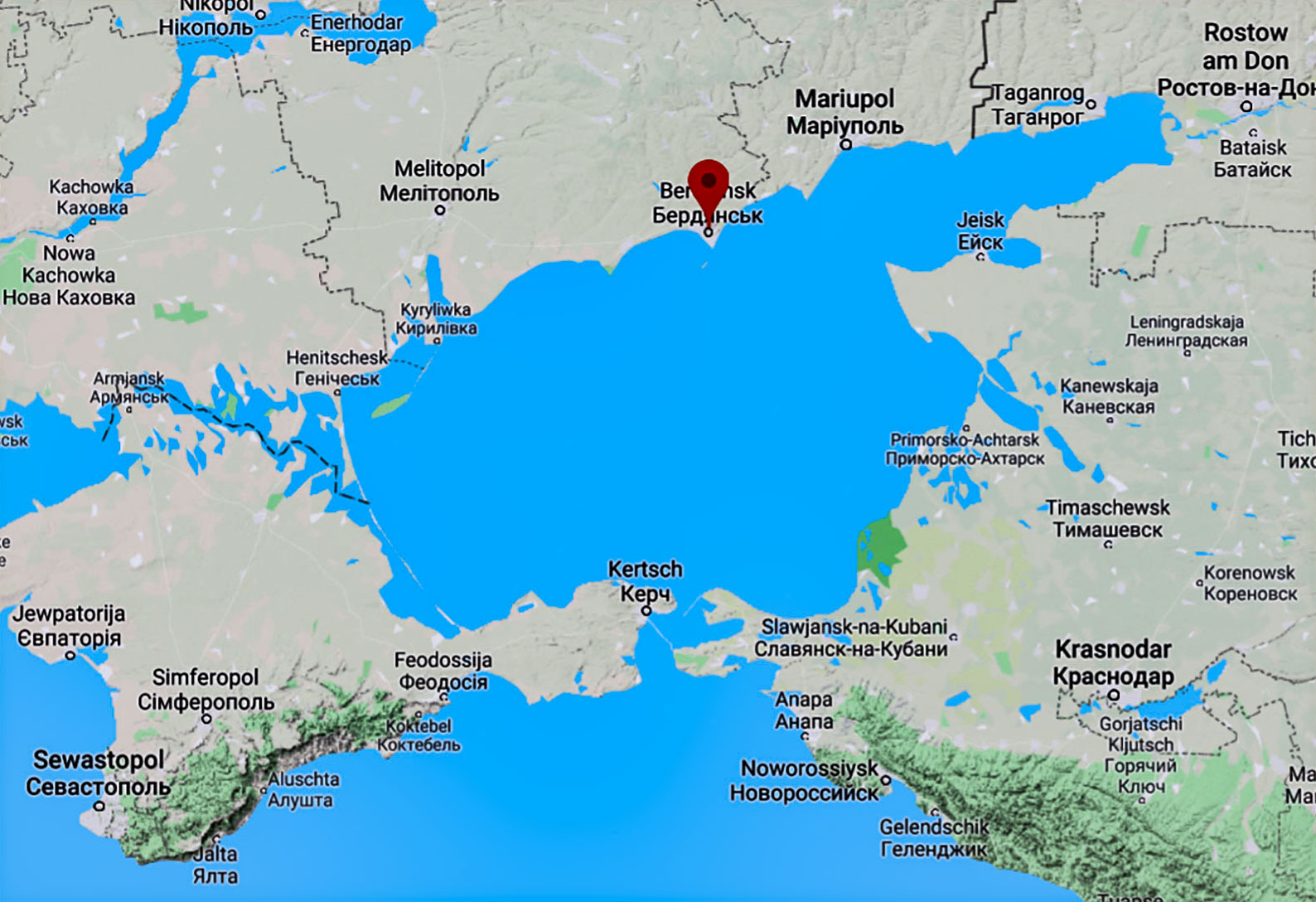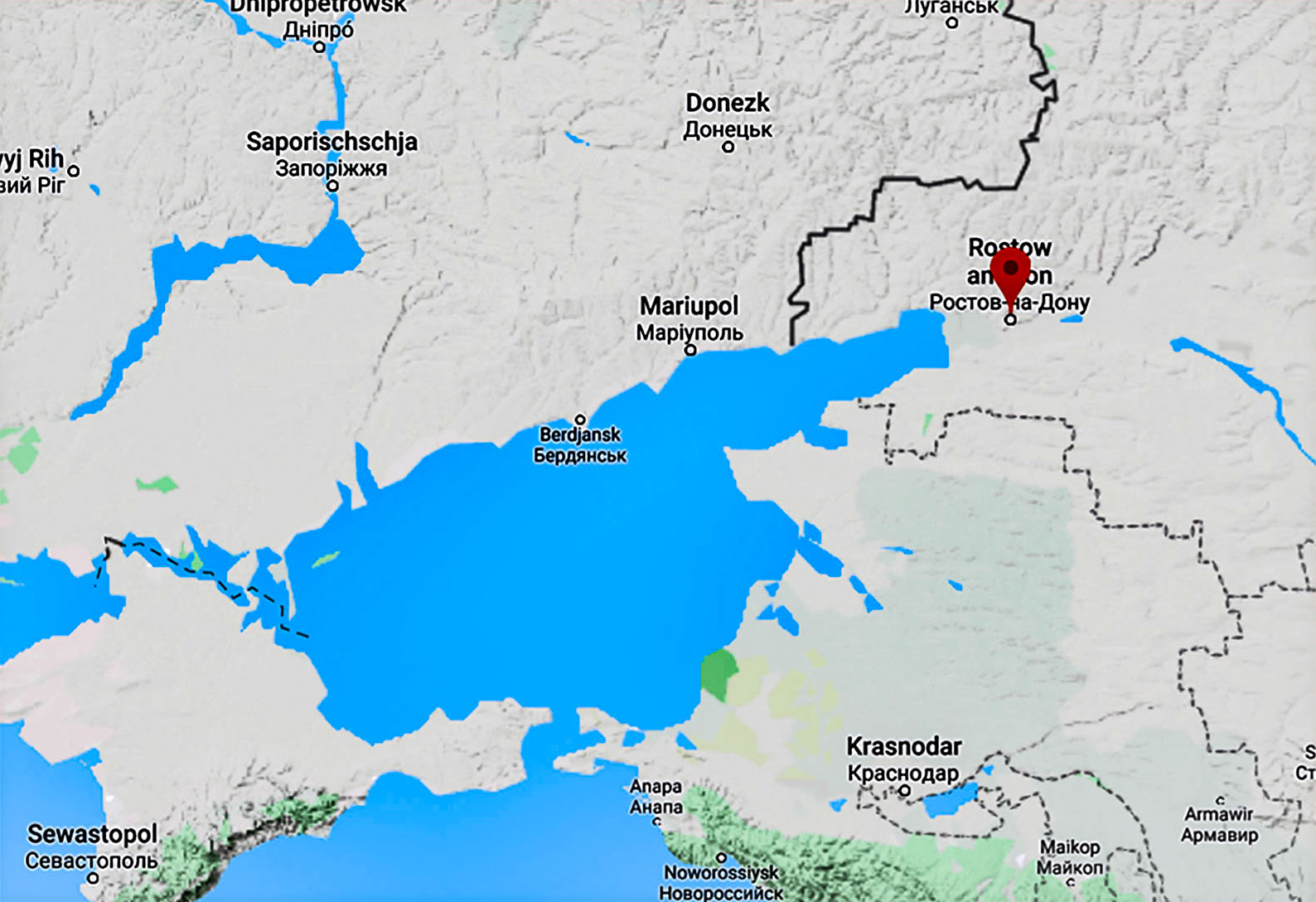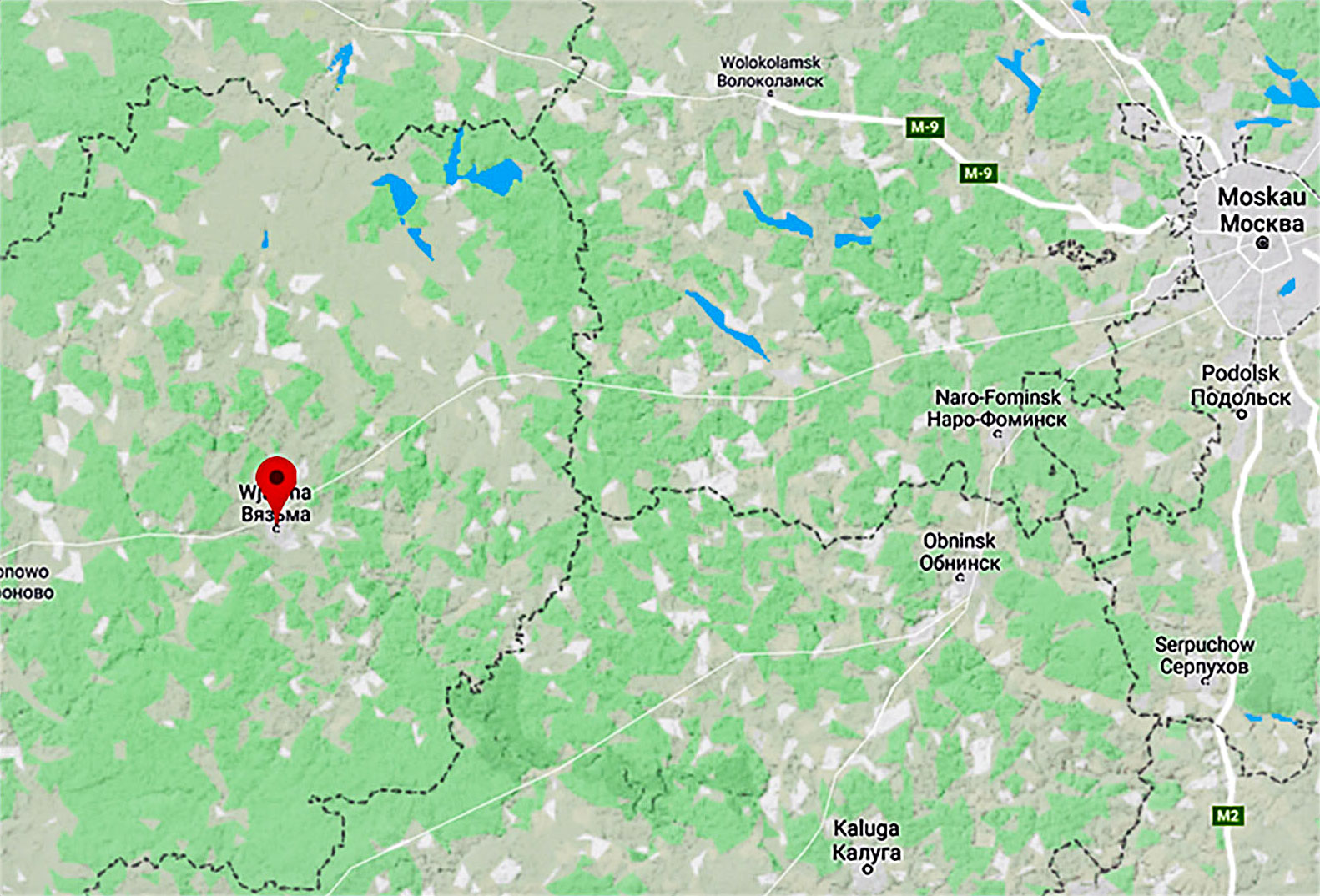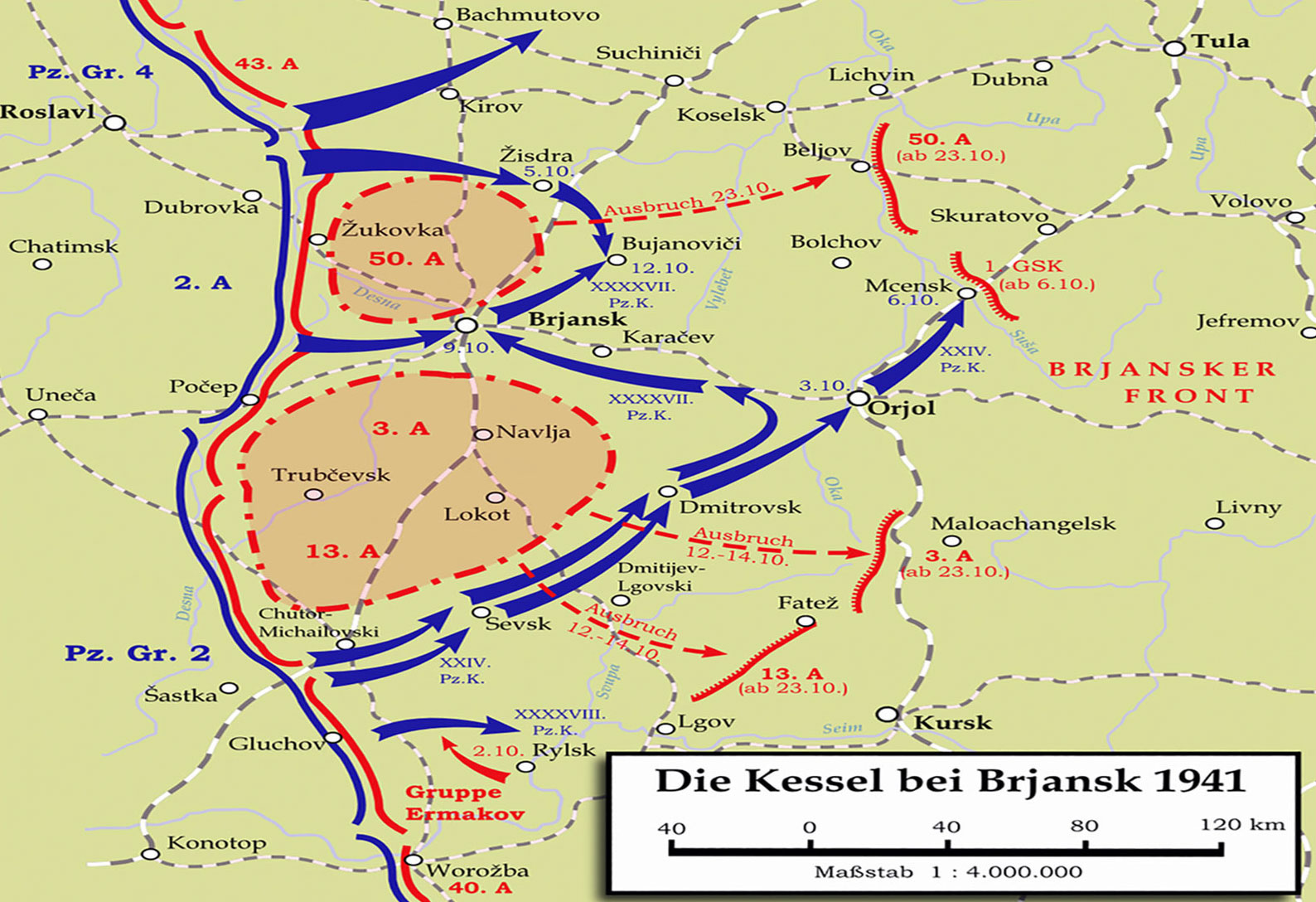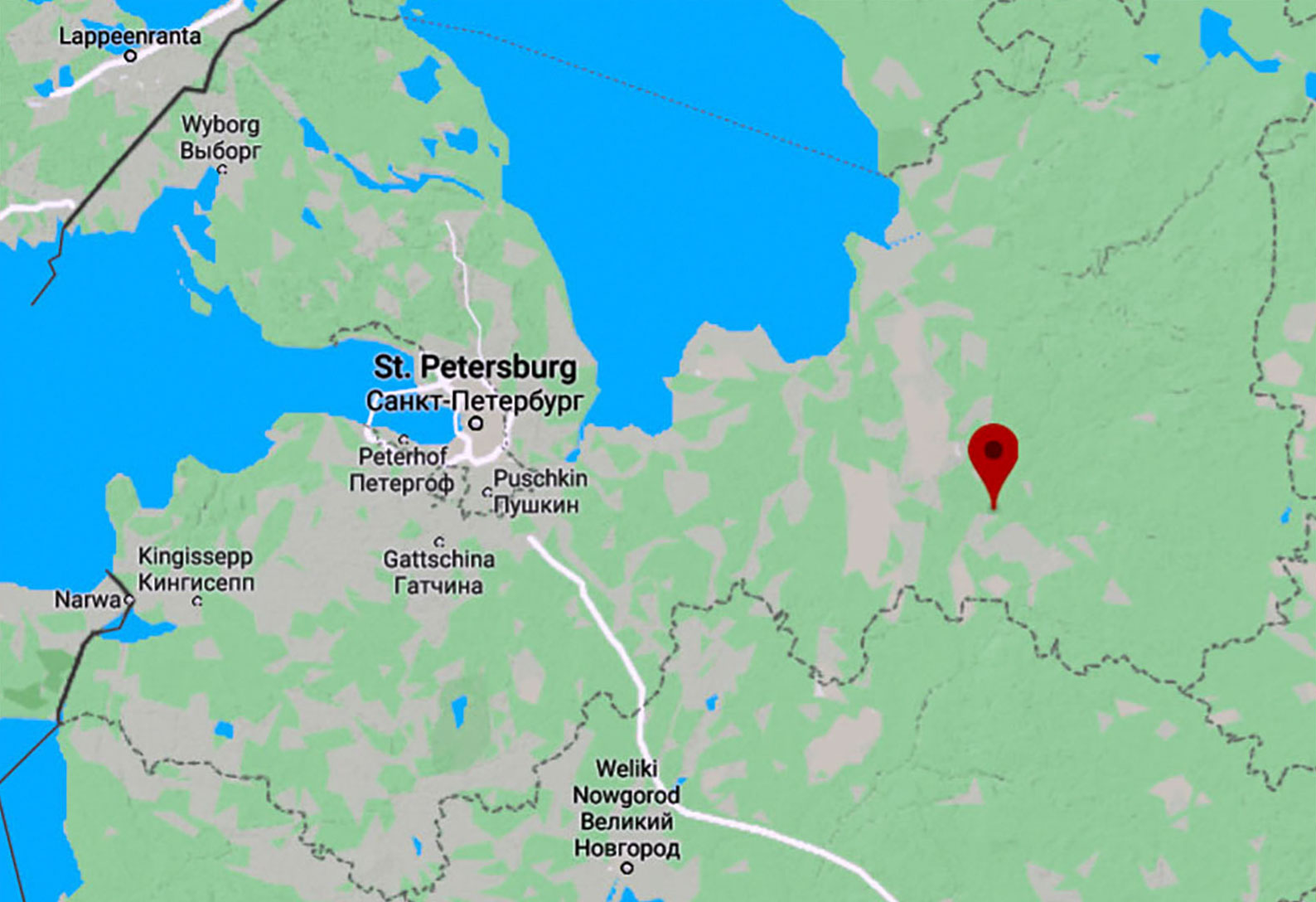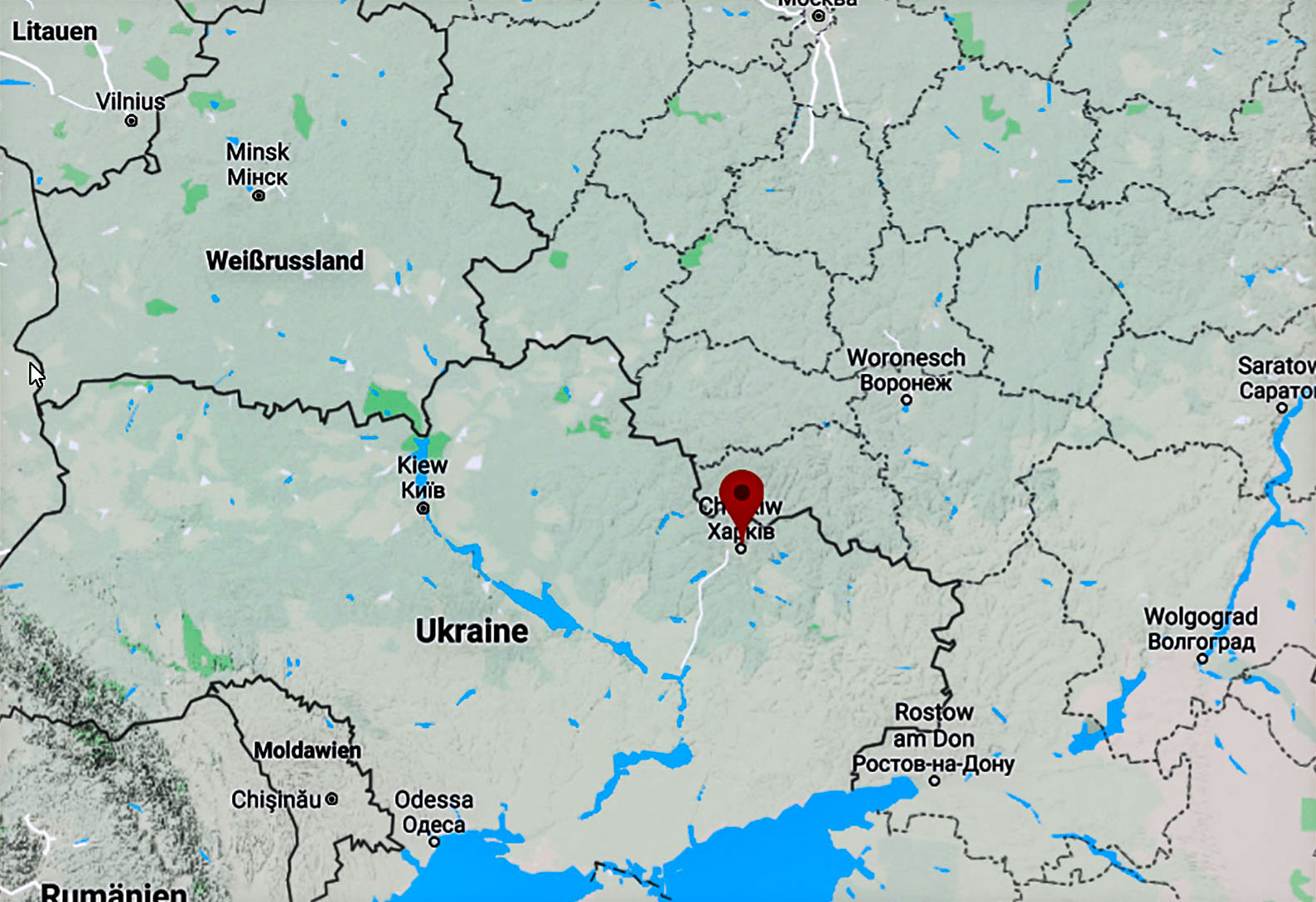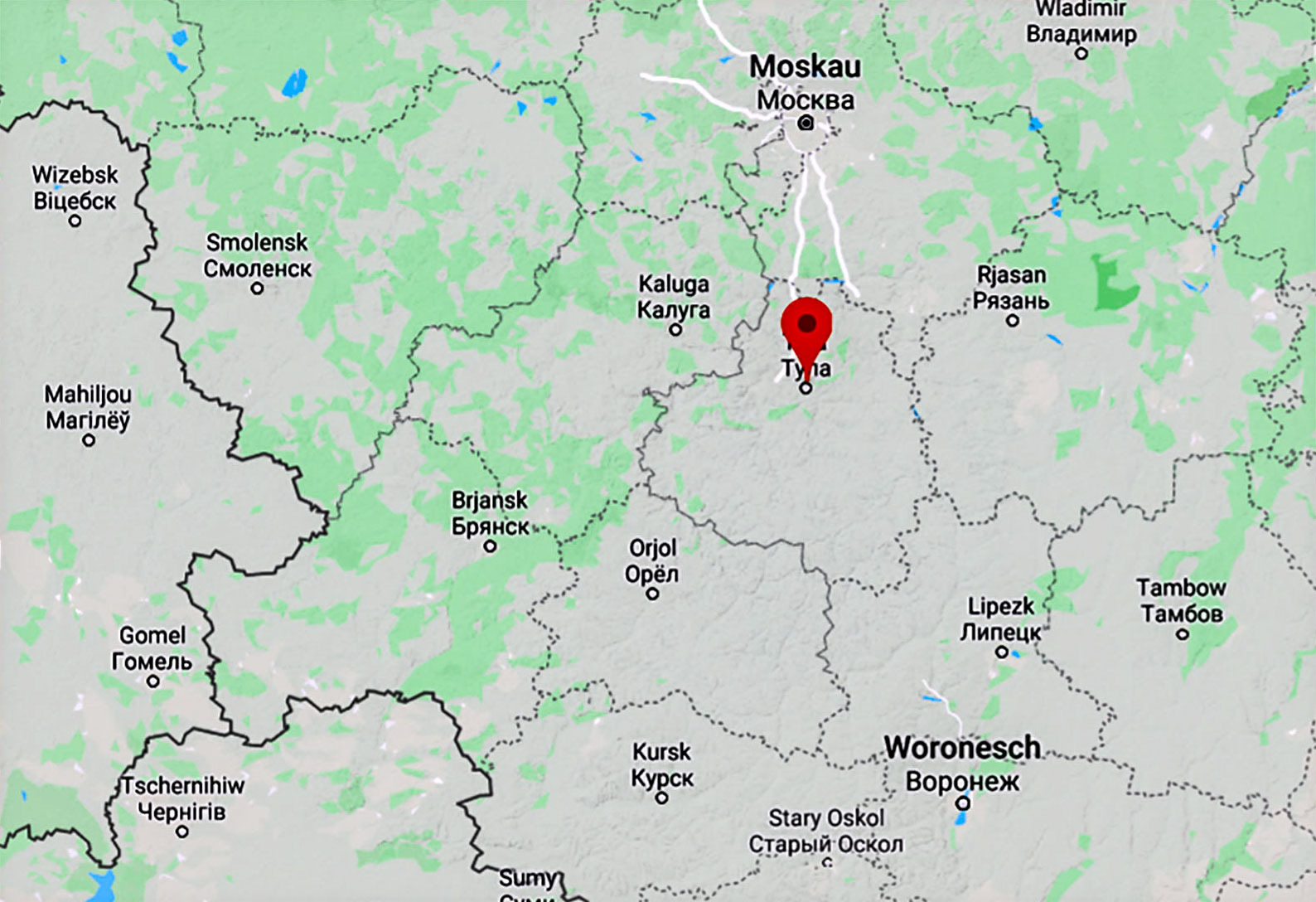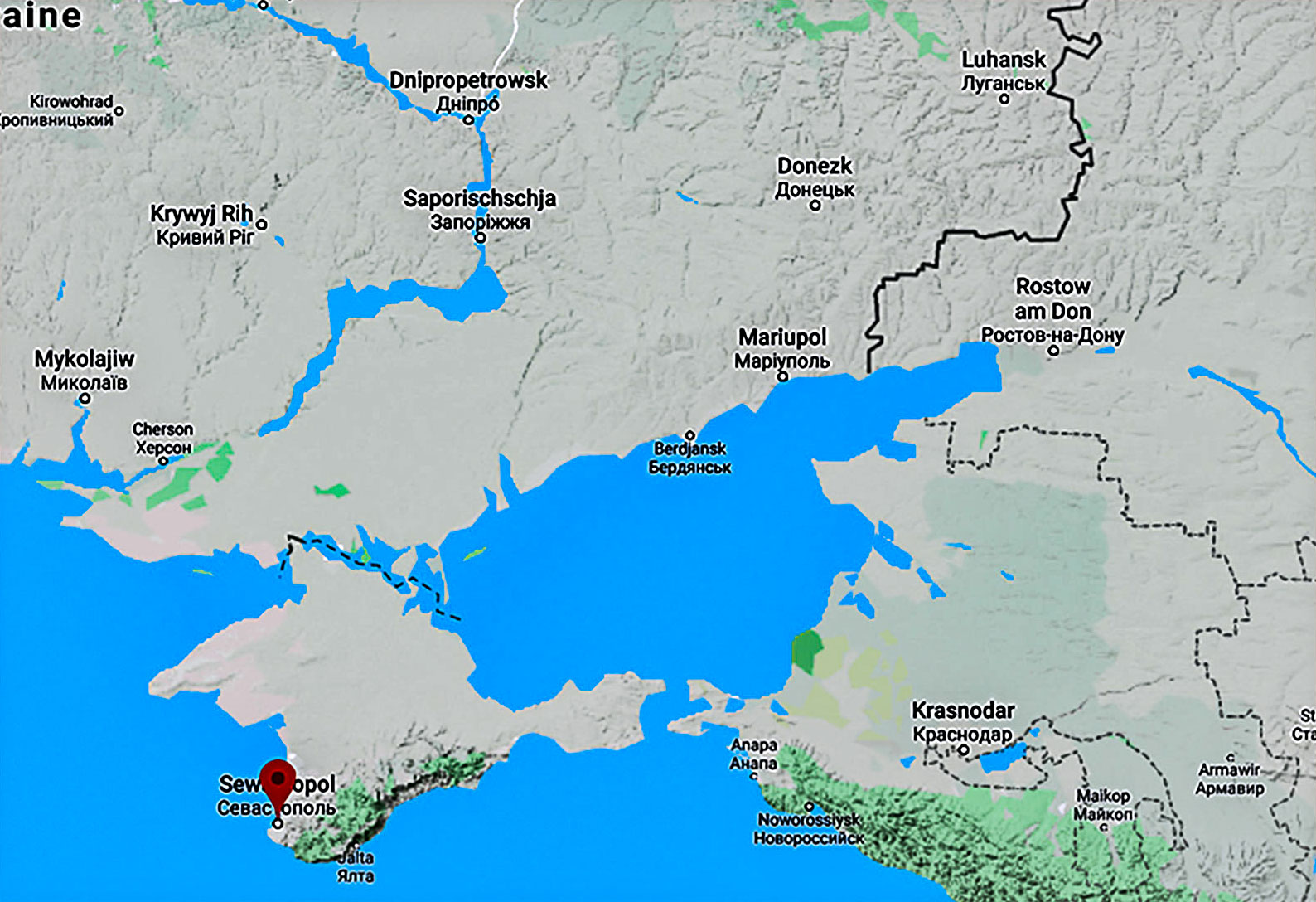Folgeschlachten Unternehmen Barbarossa
Datenherkunft: (Wikipedia)
aus-der-zeit.site > Kriegszeit 1941
- Schlacht um Kiew (23.08.1941 – 26.09.1941)
- Leningrader Blockade (heute St. Petersburg) (08.09.1941 – 27.01.1944)
- Schlacht am Asowschen Meer (26.09.1941 – 21.09.1941)
- Schlacht um Rostow (17.09.1941 – 02.12.1941)
- Doppelschlacht bei Wjasma und Brjansk (30.09.1941 – 30.10.1941)
- Schlacht um Moskau (02.10.1941 – 31.01.1941)
- Schlacht um Tichwin (16.10.1941 – 30.12.1941)
- Schlacht bei Charkow (20.10.1941 – 24.10.1941)
- Schlacht um Tula (24.10.1941 – 05.12.1941)
- Schlacht um Sewastopol (30.10.1941 – 04.07.1942)
Schlacht um Kiew (23.08.1941 – 26.09.1941)
Die Schlacht um Kiew war eine Schlacht im Zweiten Weltkrieg zwischen der Sowjetunion und dem Deutschen Reich unter Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt. Die Schlacht fand von Mitte August bis zum 26. September 1941 statt.
Hintergrund
Nach den raschen Erfolgen der Wehrmacht zu Beginn des Russlandfeldzugs befahl Hitler am 21. August 1941 entgegen der anfänglichen Planung des Generalstabes, den Stoss auf Moskau vorläufig zugunsten der vollständigen Eroberung der Ukraine abzuändern.
Durch die Panzerschlacht bei Dubno-Luzk-Riwne war der Grossteil der mechanisierten sowjetischen Kräfte ausgeschaltet worden, so dass die verbleibenden Kräfte über unverhältnismässig wenige Panzer verfügten. Der Schwerpunkt der Heeresgruppe Süd war gegen das Industriegebiet am Donez angesetzt. Die zentrale Rolle wurde dabei der 17. Armee zugewiesen, welche in allgemeiner Richtung auf Woroschilowgrad vorgehen sollte. Die Aufgabe des Flankenschutzes nach Norden fiel dabei der 6. Armee, jener nach Süden der Panzergruppe 1 zu. Interessant ist, dass zu diesem Zeitpunkt nicht an eine Umfassungsoperation, sondern an ein keilförmiges Vortreiben gedacht war, da Generalstabschef Halder jenseits des Dnepr keine geschlossene Widerstandskraft der Roten Armee erwartete.
Die Möglichkeit eines offensiven Zusammengehens mit der Heeresgruppe Mitte zeichnete sich am 20. August ab, als die 2. Armee Gomel genommen hatte. Ungeduldig wegen der langen Bereinigung des Pripjat-Raumes traf Hitler am 21. August die später noch folgenreiche Entscheidung, dass die Heeresgruppe Mitte mit der Heeresgruppe Süd zusammenwirken solle und dabei ohne Rücksicht auf spätere Operationen so viele Kräfte anzusetzen habe, wie sie als notwendig betrachte. Dazu wurde die Panzergruppe 2 des Generalobersten Guderian angesetzt, welcher anfangs gegen diesen Kräfteansatz argumentierte, da er sich auf die Wege- und Treibstoffsituation und das Auffrischungsbedürfnis der schnellen Truppen unter der Prämisse des baldigen Vorgehens gegen Moskau berief. Erst nach einer Unterredung mit Hitler schlug Guderian sogar von sich aus den Einsatz der gesamten Panzergruppe 2 vor, was wiederum Reibungen mit dem Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte, Feldmarschall von Bock, mit sich brachte, da dieser seine Kräfte für den Stoss auf Moskau zusammenhalten wollte.
Operative Planung
Nach dem Plan des deutschen Oberkommandos hatte die Panzergruppe 2 der Heeresgruppe Mitte nach Süden abzuschwenken, um die vor der Front der 6. Armee zwischen Dnepr und Kiew aufgestellten vier (5., 21., 26. und 37.) sowjetischen Armeen den Rückweg abzuschneiden. Bei der Heeresgruppe Süd hatte die deutsche 17. Armee durch einen Vormarsch nach Nordost zum Dnepr zwischen Kanew und Krementschug aufzuschliessen und gemeinsam mit der Panzergruppe 1 einen Brückenkopf zu errichten, um den Verbänden der Heeresgruppe Mitte entgegenstossen zu können. Eine günstige Ausgangsbasis wurde geschaffen durch Erreichen und Sicherung der Dnepr-Linie zwischen Kanew und Tscherkassy durch das IV. Armeekorps (Gruppe Schwedler) und das XXXXIV. Armeekorps. Bei Krementschug hatte das XI. und LII. Armeekorps der 17. Armee einen Brückenkopf am anderen Dnepr-Ufer zu errichten, aus dem später der Angriff aus dem Süden erfolgen sollte.
Nach dem Plan des deutschen Oberkommandos hatte die Panzergruppe 2 der Heeresgruppe Mitte nach Süden abzuschwenken, um die vor der Front der 6. Armee zwischen Dnepr und Kiew aufgestellten vier (5., 21., 26. und 37.) sowjetischen Armeen den Rückweg abzuschneiden. Bei der Heeresgruppe Süd hatte die deutsche 17. Armee durch einen Vormarsch nach Nordost zum Dnepr zwischen Kanew und Krementschug aufzuschliessen und gemeinsam mit der Panzergruppe 1 einen Brückenkopf zu errichten, um den Verbänden der Heeresgruppe Mitte entgegenstossen zu können. Eine günstige Ausgangsbasis wurde geschaffen durch Erreichen und Sicherung der Dnepr-Linie zwischen Kanew und Tscherkassy durch das IV. Armeekorps (Gruppe Schwedler) und das XXXXIV. Armeekorps. Bei Krementschug hatte das XI. und LII. Armeekorps der 17. Armee einen Brückenkopf am anderen Dnepr-Ufer zu errichten, aus dem später der Angriff aus dem Süden erfolgen sollte.
Die sowjetische Südwestfront hatte ihr Hauptquartier in Kiew, stand unter dem Kommando von Generaloberst Michail Petrowitsch Kirponos und wurde mit fünf Armeen im Raum zwischen Dnepr und Desna immer mehr eingeengt. Die Stawka hatte Marschall Semjon Budjonny als zusätzlichen Oberbefehlshaber der Südwestfront eingesetzt.
Anfang August wurde die neugeschaffene 37. Armee unter General Andrei Wlassow mit 7 Schützendivisionen zum direkten Schutz in die Stadt Kiew verlegt.
Die 5. Armee (General Michail I. Potapow) verteidigte anfangs im Raum Korosten und wurde nach Bedrohung ihrer Nordflanke über den Dnjepr auf Tschernigow zurückgedrängt.
Die 21. Armee (General W. I. Kusnezow) kämpfte an der Nordseite an der Desna gegenüber Guderians Truppen und wurden auf Bachmatsch gedrängt.
Die 26. Armee (General F. J. Kostenko) war als Reserve verfügbar.
Die 38. Armee (General D. I. Rjabyschew) sicherte im Süden die Dnjeprlinie und blockierte den deutschen Brückenkopf gegenüber Krementschug.
Ablauf der Operationen
Westlicher Abschnitt
Die aus dem Raum Schitomir direkt nach Kiew anrückende deutsche 6. Armee kam mit dem XXIX. Armeekorps (General Obstfelder) nur schwer voran, weil sie an der Nordflanke starken Angriffen durch die sowjetische 5. Armee ausgesetzt war. An der Nordflanke der 6. Armee sicherte die 213. Sicherungsdivision gegen das schwer zugängliche Gebiet am Südrand der Pripjetsümpfe. Das neu eingeführte LI. Armeekorps (General Reinhard) nahm den Vorstoss in Richtung auf Malin auf, wo das sowjetische 22. mechanisierte Korps eine Verteidigungslinie aufbaute. Am linken Flügel marschierte das XVII. Armeekorps in Richtung auf Korosten vor, wo das sowjetische 31. Schützenkorps sicherte. Am 22. August besetzte die 62. Infanterie-Division Owrutsch. Der Rückzug des nördlichen Flügels der Armee Potapow über den Pripjat zum Dnjepr wurde über Tschernobyl abgewickelt. Das 31. Schützenkorps (193., 195. und 200. Schützendivision) übernahm gegenüber Kolypta die Verteidigung am östlichen Ufer des Dnjepr. Das 15. Schützenkorps (62., 45. und 135. Schützendivision) machte gegenüber der deutschen 2. Armee in Richtung Tschernigow Front nach Nordosten. Die Abwehr sowjetischer Gegenangriffe zwischen Teterew und dem Sdwish-Abschnitt wurde von der 296. Infanterie-Division getragen, die 75. Infanterie-Division wurde zur Schliessung des südlichen Ringes um Kiew bestimmt und die 113. und 168. Infanterie-Division zur Sicherung zwischen Sdwish und Irpen in den Raum Gostomel herangezogen.
Ebenfalls am 23. August erreichte die 111. Infanterie-Division die grosse Dnjeprbrücke bei Gornostaipol. Die dahinter folgende 11. Panzer-Division, die ihr über den Fluss gefolgt war, konnte am 24. August zügig zur Desna durchdringen, wurde aber durch Aktionen der sowjetischen Dnjepr-Flottille, der es gelang, die Brücke zu zerstören, abgeschnitten. Unter starken Feinddruck auf beide Flanken musste sich diese Vorhut bis 29. August wieder auf den Brückenkopf am Dnjepr zurückkämpfen. Am 4. September leitete das deutsche LI. Armeekorps den neuerlichen Angriff aus dem jetzt gesicherten Brückenkopf Okuninowo in Richtung Oster an der Desna ein, während südlicher das XXIX. Armeekorps gegen die südliche Befestigungslinie von Kiew vorging.
Nördlicher Abschnitt
Die am 25. August eröffnete Offensive der Panzergruppe 2 kam anfangs rasch in Gang, auch weil man in Nowgorod-Sewerski eine Desna-Brücke unversehrt in die Hand bekam. Da jedoch dieser Desna-Brückenkopf hart attackiert wurde und auch die mit sieben Divisionen angetretene 2. Armee nur schwer vorankam, verzögerte sich der Vormarsch. Am 31. August wurde auch die 4. Panzerdivision nach der Sicherung des Desna-Brückenkopf nach Süden nachgezogen. Die 3. Panzer-Division unter Generalmajor Model überschritt den Sudost und strebte weiter südwärts zum Sejm-Abschnitt. Gegenüber den Angriffen der sowjetischen 13. und 40. Armee aus dem Raum Trubtschewsk bis Gluchow sicherte das motorisierte XXXXVI. und XXXXVII. Armeekorps (mot.) die rechte Flanke der Panzergruppe 2. An der linken Flanke Guderians begleiteten das XIII. und XXXXIII. Armeekorps der 2. Armee das Vorgehen zur Desna und nach Tschernigow. Als die Truppen des Generals Geyr von Schweppenburg am 10. September Bachmatsch besetzen, brach die Linie der sowjetischen 21. Armee zusammen. Die Truppen der deutschen 2. Armee konnten ab 8. September die Front der sowjetischen 5. Armee eindrücken, von rechts nach links überwanden die 17., 134., 260., 131., 293., 112. und 45. Infanterie-Division den Desna-Abschnitt und erreichten die nächsten Tage den Raum zwischen Koselez und Neschin. Das XXIV. Armeekorps (mot.) hatte am 9. September den Sejm überschritten und erreichte einen Tag später Romny, womit der eigentliche Treffpunkt mit der Panzergruppe 1 geplant war. Die Panzergruppe 1 kam im Süden jedoch wegen nahezu unpassierbarer Schlammwege kaum voran, so dass Guderians Vorhut, die 3. Panzer-Division noch weiter bis Lochwiza vorgehen musste.
Südlicher Abschnitt
Die Heeresgruppe Süd befahl am 4. September den Angriff der 17. Armee aus dem Brückenkopf bei Krementschug nach Norden in Richtung auf Mirgorod und Lubny, um die Front der am mittleren Dnepr stehenden Feindkräfte (sowjetische 38. Armee) zu durchbrechen. Das XI. Armeekorps unter General Kortzfleisch setzte mit der 125. und 239. Infanterie-Division über den Dnjepr. Dem LII. Armeekorps (General der Infanterie von Briesen) fiel dabei an der Ostflanke der Schutz gegenüber sowjetischen Angriffen aus dem Raum Krasnograd zu. Zusätzlich wurde von der 6. Armee das im Raum Radomyschl freigewordene Generalkommando LV. A.K. (General Vierow) für den Aufbau der neuen Front im Raum Poltawa herangezogen.
Ab 12. September wurde zum Vorstoss nach Norden zuerst das XXXXVIII. Armeekorps (mot.) (General Kempf) und darauf das XIV. Armeekorps (mot.) (General von Wietersheim) an der Spitze des Angriffes gestellt. Das XXXXVIII. Armeekorps (mot.) stiess mit der 9. Panzer-Division, 25. Infanterie-Division (mot.), 13. und 16. Panzer-Division die Sula entlang nordwärts über Lubny nach Norden. Dahinter folgte das XIV. Armeekorps (mot.) mit der 14. Panzerdivision und 60. Infanterie-Division (mot.) nach. Am 15. September wurde die Verbindung zwischen den Panzertruppen der Generale Model und Hube hergestellt und der noch dünne Ring geschlossen. Neben dieser weit umspannenden Einschliessung der Hauptkräfte der sowjetischen Südwestfront kam es mit dem Dnepr-Übergang der 6. Armee zu einer Einschliessung Kiews, welches am 19. September fiel.
Ausklang
Vergeblich stellten Marschall Budjonny und General Kirponos mehrmals die Forderung zur Räumung Kiews und zum noch möglichen Ausbruch. Stalins Befehl, „stehen, halten und notfalls sterben“ führte unweigerlich zur Einkesselung. Am 16. September bekam Marschall Timoschenko den Oberbefehl über die Südwestfront, als Chef über die operative Führung wurde Generalmajor Hovhannes Baghramjan eingesetzt. Durch Neuzuführungen und noch aus den Kessel ausgebrochene Einheiten verfügte die Front bald wieder über eine neuformierte 21., 40. und 38. Armee, welche sofort im Raum Poltawa und am Sula-Abschnitt mit Gegenstössen begann, um die noch anhaltenden Ausbruchsversuche zu unterstützen. Am 20. September wurde das Hauptquartier von Kirponos selbst überraschend in ein Gefecht mit deutschen Truppen verwickelt. General Kirponos leitete die Kämpfe bei Drjukowtschina von einem Waldrand aus, wo er bald verwundet wurde. Kurze Zeit später erlitten er und sein Generalstabschef Tupikow bei Schumeikowo tödliche Verwundungen.
Die Kesselschlacht im Osten Kiews ging erst am 26. September zu Ende. Rund 665.000 sowjetische Soldaten gerieten in deutsche Kriegsgefangenschaft; zudem wurden 884 Panzer, 418 Pak und 3018 Geschütze erbeutet. Laut anderen Quellen verlor die Rote Armee in der Kiewer Verteidigungsoperation vom 7. Juli bis zum 26. September 1941 700.544 Soldaten (darunter 616.304 Tote, Vermisste und Gefangene).
Besetzung von Kiew
Die Einnahme Kiews sollte folgenreiche Probleme bezüglich der Sicherheit der Truppen in der Stadt mit sich bringen. Nach Abschluss der Kämpfe stellte sich heraus, dass nicht nur umfangreiches Material abtransportiert und die Bahnverbindungen nachhaltig unterbrochen worden waren, sondern auch umfangreiche nachträgliche Zerstörungen durch mit Funk auszulösende Sprengungen vorbereitet waren. So befahl bereits am 13. September das Oberkommando der 6. Armee, dass sich die Truppe in der Innenstadt nur mit schriftlicher Bestätigung des AOK aufhalten dürfe. Durch einen anonymen Hinweis erfuhren die Besatzungstruppen von vorbereiteten Sprengsätzen in grösseren, für Stabs- und Truppenunterkünfte geeigneten Gebäuden, was am 19. September eine teilweise erfolgreiche Suchaktion auslöste. Am 24. September löste dann ein sowjetischer Sprengsatz neben dem Hauptpostgebäude in einem Beute- und Munitionslager einen Grossbrand aus, welcher rasch Teile der Stadt ergriff und durch das Feuerwehrregiment „Sachsen“ nicht gelöscht werden konnte. Zur Eindämmung des um sich greifenden Feuers mussten grosse Brandschneisen gesprengt werden. Erst am 29. September konnte das Grossfeuer unter Einsatz der Truppe, der Technischen Nothilfe, der einheimischen und der deutschen Feuerwehr gelöscht werden. Aufgrund der grossen Verluste der deutschen Verbände in der Stadt befahl Hitler, dass befestigte Grossstädte zukünftig nicht mehr im direkten Angriff eingenommen, sondern nach einer Umgehung belagert und schliesslich mit Artillerie und Luftangriffen zu Fall gebracht werden sollten. Am 12. Oktober bestätigte er das Betretungsverbot für Verbände nochmals mit Blick auf Moskau und Leningrad, um die Truppen nicht Verlusten durch Spreng- oder Sabotageaktionen auszusetzen. Letztendlich wurde diese Verfahrensweise aber nie – abgesehen von der Leningrader Blockade – angewendet, und zwar schon deshalb nicht, weil die Truppe auf diese Verkehrsknotenpunkte und die Unterkünfte für Stäbe, Depots und sonstige Versorgungseinrichtungen nicht verzichten konnte.
Die Folgen
Kiew wurde bereits am 19. September besetzt, die Kämpfe an der östlichen Kesselfront dauerten aber noch bis zum 26. an. Den Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD fielen im Zusammenwirken mit regulären Heereseinheiten am 29. und 30. September 1941 beim Massaker von Babyn Jar mehr als 33.000 zusammengetriebener Juden aus dem Grossraum Kiew zum Opfer. Das Ende der Kesselschlacht und die hohen sowjetischen Verluste öffneten der Wehrmacht den Zugang in die Ostukraine, zum Asowschen Meer und zum Donbass. Das Oberkommando der Wehrmacht (OKW) hatte sogar die Hoffnung, noch vor Einbruch des Winters sowohl die Halbinsel Krim einnehmen als auch in den Kaukasus vorstossen zu können. Die starken Verluste der Roten Armee brachten die deutsche Heeresführung zu der letztlich falschen Annahme, dass der Stoss auf Moskau trotz der fortgeschrittenen Jahreszeit gelingen könne und Hitler befahl nun den direkten Marsch auf die sowjetische Hauptstadt. Die Stadt blieb für 778 Tage bis zur Befreiung am 6. November 1943 durch die Rote Armee nach der Schlacht um Kiew von den Deutschen besetzt.
Leningrader Blockade (heute St. Petersburg) (08.09.1941 – 27.01.1944)
Als Leningrader Blockade (russisch блокада Ленинграда blokada Leningrada) bezeichnet man die Belagerung Leningrads (seit 1991 erneut Sankt Petersburg) durch die deutsche Heeresgruppe Nord, finnische und spanische Truppen (Blaue Division) während des Zweiten Weltkriegs. Sie dauerte vom 8. September 1941 bis zum 27. Januar 1944.
Am 75. Jahrestag des Blockadeendes am 27. Januar 2019 kündigte die deutsche Bundesregierung durch das Auswärtige Amt an, die noch lebenden Opfer der Blockade sowie Projekte zur deutsch-russischen Verständigung mit rund zwölf Millionen Euro zu unterstützen. Die Projekte sollen zusammen mit der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) umgesetzt werden.
Deutsche Offensive
Nachdem die Truppen der sowjetischen Nordwestfront (8., 11. und 27. Armee) Ende Juni 1941 im Baltikum durch die Wehrmacht geschlagen worden waren, erzwang die an der Spitze vordringende Panzergruppe 4 der Wehrmacht den Weg nach Pskow und Ostrow; beide Städte konnten bis zum 10. Juli eingenommen werden. Die langsamer nachfolgende deutsche 18. Armee drängte derweil die sowjetische 8. Armee über Riga (das am 3. Juli fiel) nach Estland zurück und stand am 7. August am finnischen Meerbusen bei Kunda. Das ab dem 22. Juli dem Armeeoberkommando 18 zugeführte XXXXII. Armeekorps kämpfte derweil im westlichen Teil von Estland, eroberte bis zum 28. August Tallinn und bis Mitte Oktober die grossen baltischen Inseln. Mitte August erfolgte der Angriff der 18. Armee auf Narwa, das XXVI. Armeekorps erreichte am 17. August den Luga-Abschnitt bei Kingissepp. Die deutsche 18. Armee drängte vom Südwesten auf Leningrad vor, während die Panzergruppe 4 und die 16. Armee nördlich und südlich des Ilmensees vorstiessen, um Leningrad vom Osten abzuschneiden und sich mit den finnischen Truppen auf dem Ostufer des Ladogasees zu verbinden. Der Artilleriebeschuss der Stadt begann am 4. September. Am 8. September eroberte die Wehrmacht Schlüsselburg am Ufer des Ladogasees und unterbrach die Landverbindung nach Leningrad.
Sowjetische Verteidigung
Am 27. Juni 1941 entschied der Leningrader Sowjet, tausende Menschen zur Anlage von Befestigungen zu mobilisieren. Mehrere Verteidigungsstellungen wurden gebaut. Eine dieser Verteidigungsstellen verlief von der Mündung der Luga über Tschudowo, Gattschina, Urizk, Pulkowo zur Newa. Eine zweite verlief von Peterhof nach Gattschina, Pulkowo, Kolpino und Koltuschi. Eine dritte Stellung gegen die Finnen wurde in den nördlichen Vorstädten Leningrads gebaut. Insgesamt wurden 190 Kilometer Balkensperren, 635 Kilometer Stacheldrahtverhaue, 700 Kilometer Panzergräben, 5.000 Erd-Holz-Stellungen und Stahlbeton-Artilleriestellungen sowie 25.000 Kilometer Schützengräben von Zivilisten angelegt. Ein Geschütz des Kreuzers Aurora wurde auf den Pulkowskij-Höhen südlich von Leningrad installiert.
Der oberste Vorsitz über die „Kommission für die Verteidigung Leningrads“ wurde am 1. Juli 1941 an den Politkommissar Andrei Schdanow übertragen, der gleichzeitig als Mitglied des Kriegsrates der Leningrader Front fungierte. Die Parteikader Alexei Kusnezow und Pjotr Popkow waren für die Organisation des zivilen Lebens und die Verteilung der Nahrungsmittel innerhalb der Stadt zuständig. Sie ordneten den Bau provisorischer Zufahrtswege zum Westufer des Ladoga-Sees an.
Am 14. September hatte Armeegeneral Georgi Schukow auf Geheiss Stalins den Oberbefehl der Leningrader Front übernommen, welcher die 8., 23., 42. und 55. Armee unterstellt waren. Schon am 10. Oktober 1941 wurde Schukow jedoch durch General Iwan Fedjuninski und dieser am 27. Oktober durch Generalleutnant Michail Chosin abgelöst. Schukow wurde mit der entscheidenden Verteidigung Moskaus betraut, wohin auch starke deutsche Panzerkräfte aus dem Raum Leningrad abgezogen wurden.
Finnische Offensive
Im August, zu Beginn des Fortsetzungskrieges, hatten die Finnen den Isthmus von Karelien zurückerobert und rückten östlich des Ladogasees durch Karelien weiter vor, wodurch sie nun Leningrad im Westen und Norden bedrohten. Die finnischen Truppen hielten jedoch an der alten finnisch-russischen Grenze von 1939. Das finnische Hauptquartier wies deutsche Bitten um Luftangriffe gegen Leningrad zurück und rückte nicht weiter südlich über den Swir (160 Kilometer nordöstlich Leningrads) ins besetzte Ostkarelien vor. Der deutsche Vormarsch war dagegen sehr rasch und im September schlossen die deutschen Truppen Leningrad ein.
Am 4. September reiste der Chef des Wehrmachtführungsstabes, General Jodl, zum finnischen Hauptquartier, um den Oberkommandierenden Mannerheim zu überreden, die finnische Offensive fortzusetzen. Mannerheim lehnte dieses Ansinnen ab.
Nach dem Krieg gab der frühere finnische Präsident Ryti an:

„Ich besuchte am 24. August 1941 das Hauptquartier von Marschall Mannerheim. Die Deutschen forderten uns auf, die alte Grenze zu überschreiten und die Offensive gegen Leningrad fortzusetzen. Ich sagte, dass die Eroberung Leningrads nicht unser Ziel sei und wir uns nicht daran beteiligen sollten. Mannerheim und der Kriegsminister Walden stimmten mir zu und lehnten die Angebote der Deutschen ab. Das Ergebnis war eine paradoxe Situation: die Deutschen waren nicht in der Lage, sich Leningrad von Norden zu nähern“.
Belagerung
Mit der Schliessung des Blockaderings am 8. September wurden alle Versorgungslinien für die Millionenstadt abgeschnitten und die Versorgung war nur noch über den Ladogasee möglich. Allerdings war diese Route für die Erfordernisse der Stadt nicht ausgebaut, da es keine Anlegestelle und keine Zufahrtsstrassen gab. An der Verteidigung der Leningrader Front waren die 8. Armee (General Tscherbakow), 42. Armee (General Iwanow) und 55. Armee (General Lasarew) beteiligt.
Am 8. September begann der Generalangriff der deutschen 18. Armee und der Panzergruppe 4 (Generaloberst Erich Hoepner). Den Hauptangriff führte das XXXXI. Armeekorps (1. und 6. Panzer-Division, sowie 36. Infanterie-Division) im Zusammenwirken mit dem XXXVIII. Armeekorps (1. und 291. Infanterie-Division), der vom Westen über Krasnoje Selo und die Dudenhofer Höhen nach Norden angesetzt wurde. Im Süden aus dem Raum Gatschina und im Osten aus dem Raum Mga wurden die Divisionen des L. und XXVIII. Armeekorps zum Angriff auf den südlichen Festungsgürtel eingesetzt.
Am 16. September 1941 erreichte das XXXVIII. Armeekorps mit der 58. und 254. Infanterie-Division von Süden kommend bei Uritzk den Finnischen Meerbusen und schnitt starke sowjetische Kräfte von der Hauptmacht in Leningrad ab. Im Raum beidseitig von Peterhof konnte sich die Masse der abgeschnittenen 8. Armee im entstandenen Brückenkopf von Oranienbaum und auf der Insel Kotlin (mit der Festung Kronstadt) erfolgreich halten. Mitte September wurde die Lage der Heeresgruppe Nord kritisch, weil das südlich des Ilmensees stehende X. und II. Armeekorps der 16. Armee zwischen Cholm und Staraja Russa starken Gegenangriffen der sowjetischen Nordwestfront ausgesetzt war.
Anfang Oktober verzichteten die Deutschen zugunsten des Angriffes auf Moskau auf den weiteren Angriff auf die Stadt. In der Weisung Nr. 37 vom 10. Oktober 1941 heisst es: „Nachdem die Masse der sowjetrussischen Wehrmacht auf dem Hauptkriegsschauplatz zerschlagen oder vernichtet ist, liegt kein zwingender Grund mehr vor, russische Kräfte in Finnland durch Angriff zu fesseln. Um vor Eintritt des Winters Murmansk … zu nehmen oder … die Murmanbahn abzuschneiden, reichen die Stärke und die Angriffskraft der verfügbaren Verbände und die fortgeschrittene Jahreszeit nicht mehr aus“. Im Dezember 1941 gelang es der Roten Armee im Rahmen der Schlacht um Tichwin, den angesetzten Vorstoss des deutschen XXXIX. Panzerkorps nach Osten zu stoppen. Zudem konnte die im Raum östlich Leningrads neu etablierte sowjetische Wolchow-Front unter Armeegeneral Merezkow die Deutschen über den Fluss Wolchow zurückwerfen und einige Brückenköpfe am linken Ufer erobern.
Die Fortsetzung des deutschen Angriffes auf Leningrad wurde für das Frühjahr 1942 zwar geplant, aufgrund von logistischen Problemen aber immer wieder verschoben. Im September 1942 sah die Heeresgruppe Nord unter dem Decknamen „Unternehmen Nordlicht“ einen Angriff mit dem Ziel der Einnahme der Stadt vor. Wegen eines Entsatzangriffs der sowjetischen Armee auf den östlichen Belagerungsring im Raum Mga–Schlüsselburg (Erste Ladoga-Schlacht) musste die bereits aufmarschierte 11. Armee unter General Erich von Manstein dorthin verlegt werden. In diesen Kämpfen erlitten die deutschen Truppen so schwere Verluste, dass eine baldige Durchführung der geplanten Operation im Jahr 1942 ausschied. Weitere Angriffe mit dem Ziel der Einnahme der Stadt unterblieben.
In der Folgezeit versuchte die Sowjetunion in mehreren Schlachten die Blockade Leningrads aufzubrechen (siehe Abschnitt Sowjetische Entsatzangriffe). Während der Belagerung kamen in der Stadt und in den Gefechten in ihrer Umgebung 1,6 bis 2 Millionen Bürger der Sowjetunion ums Leben.
Luftangriffe
Vom 8. September 1941 an wurde Leningrad massiv bombardiert. Die Luftwaffe bombardierte zunächst vor allem die Lebensmittellager, die Wasser- und die Elektrizitätswerke, während Schulen, Krankenhäuser und Entbindungsheime von der deutschen Artillerie unter Feuer genommen wurden. Bei den ersten Bombardements fielen 5.000 Brandbomben auf den Moskowskij Rajon, 1.311 weitere auf den Smolnij Rajon mit dem Regierungsgebäude und 16 auf den Krasnogwardejskij Rajon. Die Bombardierung verursachte in der Stadt 178 Brände. Ab diesem Zeitpunkt erfolgten täglich schwere Angriffe auf die Stadt. Ganze Wohngebiete wurden schwer beschädigt (Awtowo, Moskowskij, Frunsenskij).
Schwere Angriffe waren gegen das Kirowwerk gerichtet, den grössten Betrieb der Stadt, der von der Front nur drei Kilometer entfernt war. Gezielt wurden von der deutschen Luftwaffe die Badajew-Lagerhäuser beschossen, in denen ein Grossteil der Lebensmittelvorräte der Stadt gelagert war. 3000 Tonnen Mehl und 2500 Tonnen Zucker verbrannten. Wochen nach Beginn der schweren Hungerkatastrophe wurde die süsse Erde, in die der geschmolzene Zucker gelaufen war, zu hohen Preisen auf dem Schwarzmarkt verkauft.
Bis zum Ende des Jahres 1941 warf die deutsche Luftwaffe 66.200 Brand- und 3.499 Sprengbomben über Leningrad ab, während der gesamten Dauer der Blockade waren es 102.520 Brandbomben und 4.653 Sprengbomben. Durch die Art der Bombardierung wurde die Zerstörung zahlreicher ziviler Einrichtungen, wie etwa Schulen, in Kauf genommen. Insgesamt kamen mindestens 16.000 Menschen bei Luftangriffen ums Leben und über 33.000 wurden verletzt.
Die mit den Luftangriffen verfolgte Strategie der völligen Zerstörung Leningrads kam in einem Schreiben des Chefs des SS-Sicherheitsdienstes Reinhard Heydrich vom 20. Oktober 1941 an Heinrich Himmler zum Ausdruck, in dem er sich über die mangelnde Effizienz des deutschen Beschusses beschwerte und den Reichsführer SS an eine Weisung Adolf Hitlers zur „Auslöschung“ der Stadt erinnerte:

„Ich bitte gehorsamst darauf hinweisen zu dürfen, dass die ergangenen strikten Weisungen hinsichtlich der Städte Petersburg und Moskau dann wieder nicht in die Tat umgesetzt werden können, wenn nicht von vorneherein brutal durchgegriffen wird. Der Chef der Einsatzgruppe A, SS-Brif. Dr. Stahlecker, berichtet mir z. B., dass eingesetzte Vertrauensleute, die über die Linie wechseln, von Petersburg zurückgekehrt erzählen, dass die Zerstörungen in der Stadt noch durchaus unbedeutend sind. Das Beispiel der ehemaligen polnischen Hauptstadt hat auch gezeigt, dass selbst intensivster Beschuss nicht diejenigen Zerstörungen hervorrufen kann, die erwartet worden sind. Meines Erachtens muss in solchen Fällen massenhaft mit Brand- und Sprengbomben gearbeitet werden. Ich bitte daher gehorsamst, anregen zu dürfen, den Führer nochmals darauf hinzuweisen, dass – wenn nicht absolut eindeutige und strikte Befehle an die Wehrmacht gegeben werden, die beiden Städte kaum ausgelöscht werden können“.
Hunger
Leningrad gilt als herausragendes Beispiel der deutschen Hungerpolitik in diesem Krieg. Am 2. September 1941 wurden die Nahrungsmittelrationen reduziert. Am 8. September wurde zusätzlich eine grosse Menge an Getreide, Mehl und Zucker durch deutsche Luftangriffe vernichtet, was zu einer weiteren Verschärfung der Ernährungssituation führte.
Am 12. September wurde berechnet, dass die Rationen für Armee und Zivilbevölkerung für die folgende Zeit ausreichen würden:
- Getreide und Mehl – für 35 Tage;
- Grütze und Makkaroni – für 30 Tage;
- Fleisch (inklusive Viehbestand) – für 33 Tage;
- Fette – für 45 Tage;
- Zucker und Süsswaren – für 60 Tage.
Der Abverkauf der Waren erfolgte sehr schnell, da die Menschen Vorräte anlegten. Restaurants und Delikatessläden verkauften weiterhin ohne Karten. Nicht zuletzt gingen auch deshalb die Vorräte dem Ende entgegen. Zwölf Prozent aller Fette und zehn Prozent des Fleisches des städtischen Gesamtkonsums wurden so verbraucht.
Am 20. November wurden die Rationen nochmals reduziert. Arbeiter erhielten 500 Gramm Brot, Angestellte und Kinder 300 Gramm, andere Familienangehörige 250 Gramm. Die Ausgabe von Mehl und Grütze wurde ebenfalls reduziert, aber gleichzeitig die von Zucker, Süsswaren und Fetten erhöht. Die Armee und die Baltische Flotte hatten noch Bestände an Notrationen, die aber nicht ausreichten. Die zur Versorgung der Stadt eingesetzte Ladoga-Flottille war schlecht ausgerüstet und von deutschen Flugzeugen bombardiert worden. Mehrere mit Getreide beladene Lastkähne waren so im September versenkt worden. Ein grosser Teil davon konnte später von Tauchern gehoben werden. Dieses feuchte Getreide wurde später zum Brotbacken verwendet. Nachdem die Reserven an Malz zur Neige gegangen waren, wurde es durch aufgelöste Zellulose und Baumwolle ersetzt. Auch der Hafer für die Pferde wurde gegessen, während die Pferde mit Laub gefüttert wurden.
Nachdem 2000 Tonnen Schafsinnereien im Hafen gefunden worden waren, wurde daraus eine Gelatine hergestellt. Später wurden die Fleischrationen durch diese Gelatine und Kalbshäute ersetzt. Während der Blockade gab es insgesamt fünf Lebensmittelreduzierungen.
Trotz der Beimischung verschiedener Ersatzstoffe zum Brot (Kleie, Getreidespelzen und Zellulose) reichten die Vorräte nicht aus und mit der Kürzung der Brotration am 1. Oktober begann die Hungersnot, Arbeiter erhielten zu diesem Zeitpunkt 400 Gramm und alle anderen 200 Gramm. Mitte Oktober litt bereits ein Grossteil der Bevölkerung am Hunger. Im Winter 1941/1942 verloren die Menschen bis zu 45 Prozent ihres Körpergewichtes. Die Folge war, dass die Körper begannen, Muskelmasse zu verbrennen und Herz und Leber zu verkleinern. Die Dystrophie (Unterernährung) wurde zur Haupttodesursache. Es begann das Massensterben.
Opfer der Zivilbevölkerung
Die folgende Tabelle gibt die Anzahl der monatlichen Todesfälle während des ersten Jahrs der Belagerung wieder.
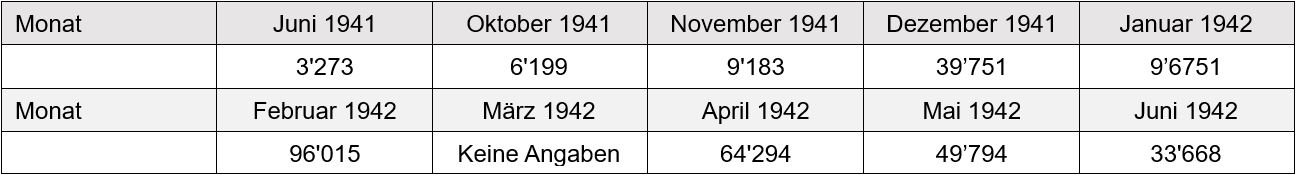
Insgesamt starben von Juni 1941 bis Juni 1942 etwa 470.000 Menschen.
Die Menschen richteten ihre gesamte Energie auf die Nahrungssuche. Gegessen wurde alles, was organischen Ursprunges war, wie Klebstoff, Schmierfett und Tapetenkleister. Lederwaren wurden ausgekocht und im November 1941 gab es in Leningrad weder Katzen oder Hunde noch Ratten und Krähen. Die Not führte zu einer Auflösung der öffentlichen Ordnung: Petr Popkow erzählte dem Militärberichterstatter Tschakowski, dass er neben der Nahrungsmittelversorgung seine Hauptaufgabe im Kampf gegen Plünderer und Marodeure sehe. Es traten die ersten Fälle von Kannibalismus auf. Insgesamt wurden dem NKWD bis zum Februar 1942 1025 Fälle bekanntgegeben.
Kinderschlitten wurden zum einzigen Transportmittel. Mit ihnen wurden Wasser, Brot und Leichen transportiert. In den Strassen lagen Leichen; Menschen brachen auf der Strasse zusammen und blieben einfach liegen. Der Tod wurde zur Normalität. In den eiskalten Wohnungen lebten die Menschen zusammen mit ihren toten Angehörigen, die nicht beerdigt wurden, weil der Transport zum Friedhof für die entkräfteten Menschen zu beschwerlich war.
Spezielle Komsomolzenbrigaden, die aus meist jungen Frauen bestanden, durchsuchten täglich hunderte von Wohnungen nach Waisenkindern, doch oft lebte in den Wohnungen niemand mehr.
Die Gesamtzahl der Opfer der Blockade ist immer noch umstritten und wird wohl nie richtig festgestellt werden können. Nach dem Krieg meldete die sowjetische Regierung 670.000 Todesfälle in der Zeit vom Beginn 1941 bis Januar 1944, wovon die meisten durch Unterernährung und Unterkühlung verursacht worden waren. Einige unabhängige Schätzungen gaben viel höhere Opferzahlen an, die von 700.000 bis 1.500.000 reichen. Die meisten Quellen gehen aber von einer Zahl von etwa 1.100.000 Toten aus.
Einzelne Opfer: Während der Blockade starb auch der in einer psychiatrischen Abteilung inhaftierte Schriftsteller und Oberiut Daniil Charms, vermutlich an Unterernährung. Ein weiteres ziviles Opfer war der populäre Naturwissenschaftler Jakow Perelman.
Leben in der belagerten Stadt
Zwar wurden bis zum Winter 1941/1942 etwa 270 Betriebe und Fabriken geschlossen, aber das riesige Kirow- und Ischorha-Werk und die Admiralitäts-Werft arbeiteten weiter.
Leningrader Arbeiter liefern weiter Geschütze und Munition für die Verteidiger ihrer Stadt. Aus den riesigen Kirow-Werken rollen sogar bis zum Ende der Blockade täglich T34-Panzer direkt an die Front. Nicht einmal ein Jahr nach dem Ende der Leningrader Blockade erreichen auch einige von ihnen Deutschland. Auch die Hochschulen und wissenschaftlichen Institute blieben geöffnet. 1000 Hochschullehrer unterrichteten im Blockadewinter und 2500 Studenten schlossen ihr Studium ab. 39 Schulen hielten den Lehrbetrieb aufrecht. 532 Schüler beendeten die 10. Klasse.
Selbst das kulturelle Leben (Konzerte, Theateraufführungen, Vorträge usw.) wurde, wenn auch in verringertem Masse, fortgeführt. Z. B. erlebte hier im Sommer 1942 Schostakowitschs siebte Sinfonie eine Aufführung.
Strom und Energie
Wegen mangelnder Stromversorgung mussten viele Fabriken geschlossen werden und im November 1941 wurde der Betrieb der Strassenbahnen und Oberleitungsbusse eingestellt, im April 1942 wurde der Strassenbahnverkehr der wichtigsten Linien teilweise wieder aufgenommen. Mit Ausnahme des Generalstabs, des Smolnij, der Distriktausschüsse, der Luftabwehrstellungen und ähnlicher Institutionen war die Nutzung von Strom überall verboten. Ende September waren alle Reserven an Öl und Kohle verbraucht. Die letzte Möglichkeit zur Energiegewinnung war, die verbliebenen Bäume im Stadtgebiet zu fällen. Am 8. Oktober beschlossen der Exekutivausschuss von Leningrad (Ленгорисполком) und der regionale Exekutivausschuss (облисполком), mit dem Holzeinschlag in den Distrikten Pargolowo und Wsewolschskij im Norden der Stadt zu beginnen. Es gab jedoch weder Werkzeug noch Unterkünfte für die aus Jugendlichen gebildeten Holzfällergruppen, die aus diesem Grund nur geringe Mengen an Holz liefern konnten.
Die „Strasse des Lebens“
Im Chaos des ersten Kriegswinters war kein Evakuierungsplan vorhanden, weshalb die Stadt und ihre Aussenbezirke bis zum 20. November 1941 in vollständiger Isolation hungerten. Zu diesem Zeitpunkt wurde eine Eisstrasse über den zugefrorenen Ladogasee eröffnet (offizielle Bezeichnung: „Militärische Autostrasse Nummer 101“, inoffiziell: „Strasse des Lebens“). Die über die Strasse herangeschafften Lebensmittel reichten aber bei weitem nicht aus, alle Einwohner der Stadt zu versorgen. Immerhin gelang es, über die Strasse eine grosse Anzahl von Zivilisten zu evakuieren. In den Sommermonaten des Jahres 1942 wurde die Versorgungsroute mit Hilfe von Schiffen aufrechterhalten. Im Winter 1942 wurde die Strasse durch eine Eisenbahnlinie über das Eis ergänzt. Nach der Schaffung eines schmalen Landkorridors am südlichen Ufer des Ladoga-Sees im Januar 1943 (siehe unten) schwand die Bedeutung des Weges über den See, obgleich er bis zum Ende der Belagerung im Januar 1944 in Benutzung blieb.
Sowjetische Entsatzangriffe
Nachdem die Sowjetunion das deutsche Vordringen Ende 1941 in der Schlacht um Tichwin stoppen konnte, wurde bereits im Januar 1942 eine erste Gegenoffensive zur Überwindung der Blockade eingeleitet (→ Ljubaner Operation). Sie scheiterte jedoch bereits im Ansatz an schlechter Planung durch die sowjetischen Befehlshaber, nicht vorhandener Tarnung sowjetischer Angriffsformationen und einer gut organisierten Abwehr der deutschen Heeresgruppe Nord. Nach verlustreichen Angriffen wurde die Offensive im April 1942 beendet. Ein deutscher Gegenangriff im Juni 1942 führte zur Vernichtung der sowjetischen 2. Stossarmee in einem Kessel.
Ein weiterer Versuch der Roten Armee, die Blockade zu beenden, wurde im August 1942 mit der Sinjawinsker Operation unternommen. Dieser in der deutschen Geschichtsschreibung als „Erste Ladoga-Schlacht“ bezeichnete Angriff endete im Oktober 1942 ebenfalls mit einem Misserfolg.
Die vollständige Blockade dauerte bis Anfang 1943. Am 12. Januar begann mit der Operation Iskra ein weiterer Grossangriff von Truppen der Leningrader und der Wolchow-Front. Nach schweren Kämpfen überwanden Einheiten der Roten Armee die starken deutschen Befestigungen südlich des Ladogasees und am 18. Januar trafen die Leningrad- und die Wolchow-Front aufeinander.
Ein schmaler Landkorridor in die Stadt war so geöffnet, der jedoch noch in der Reichweite deutscher Artillerie lag.
Im Rahmen der Operation Polarstern versuchte die Rote Armee im Februar und März 1943 die gesamte deutsche Front im Norden auszuhebeln, erreichte dabei aber nur lokale Erfolge. Der Landkorridor konnte dabei nur unwesentlich erweitert werden.
Im Juli 1943 startete die Rote Armee erneut eine Offensive mit dem Ziel, die Belagerung der Stadt vollständig zu beenden. Dieser in der deutschen Militärgeschichtsschreibung als „Dritte Ladoga-Schlacht“ bekannte Angriff führte nur zu geringen Geländegewinnen für die sowjetische Armee, die unter unverhältnismässig hohen Verlusten erkauft wurden.
Die dramatische Lage der deutschen Truppen an anderen Frontabschnitten führte im Herbst 1943 auch zu einer Schwächung der Leningrad belagernden deutschen Heeresgruppe Nord, die Einheiten an andere Grossverbände abgeben und zusätzliche Frontabschnitte verteidigen musste. Diese Reduzierung der deutschen Kampfkraft und ein wesentlich verbesserter Angriffsplan der Roten Armee führten wenig später zum Rückzug der Deutschen.
Im Januar 1944 wurde der deutsche Belagerungsring während der Leningrad-Nowgoroder Operation durch eine neue sowjetische Grossoffensive endgültig aufgebrochen. Am 12. Januar griff im Süden die 2. Baltische Front gegen die 16. Armee auf Nowosokolniki an, zwei Tage später begann die Offensive der über See herangeführten 2. Stossarmee aus dem Brückenkopf von Oranienbaum. Am 15. Januar trat auch die 42. und 67. Armee der Leningrader Front an, am folgenden Tag griff die 59. Armee der Wolchow-Front beidseitig von Nowgorod an. Am 17. Januar wurde die erste Verteidigungslinie der deutschen 18. Armee durchbrochen und Puschkin befreit. Der Durchbruch der 2. Stossarmee aus dem Kessel von Oranienbaum in Richtung auf Krasnoje Selo bedrohte die rückwärtigen Verbindungen der deutschen 18. Armee. Die Wehrmacht war gezwungen die Belagerung aufzuheben, die schwere Artillerie abzubauen und Krasnoje Selo, Ropscha und Urizk zu räumen. Am 27. Januar hatten die sowjetischen Verbände die Eisenbahnlinie von Leningrad nach Moskau abgeschnitten, der Heeresgruppe Nord drohte die Einschliessung. Ende Januar bis Mitte Februar musste sich die 18. Armee über den Luga- und Pljussa-Abschnitt auf die Landenge bei Narwa sowie südlich des Peipussee auf die Linie Pleskau – Ostrow zurückziehen.
Sechs Monate später wurden die Finnen schliesslich auf die andere Seite der Bucht von Wyborg und des Flusses Wuoksi zurückgeworfen (→Wyborg-Petrosawodsker Operation).
Viele Opfer der Blockade und Teilnehmer an der Verteidigung Leningrads, insgesamt etwa 470.000 Personen, sind auf dem Piskarjowskoje-Gedenkfriedhof begraben.
Der Friedhof in Krasnenkoe ordnet das Geschehen in grössere Zusammenhänge ein: Hier wird an alle erinnert, die zwischen dem 22. Juni 1941 und dem 8. Mai 1945 ums Leben gekommen sind, also während des gesamten Deutsch-Sowjetischen Krieges.
Darstellung der Blockade
Nach dem Ende des Krieges wurde die Leningrader Blockade schnell zum Gegenstand unterschiedlichster kultureller und wissenschaftlicher Darstellungen.
Westliche wissenschaftliche Literatur
Der Versuch, die deutschen Motive für die Durchführung und Art der folgenschweren Belagerung von Leningrad herauszuarbeiten und zu bewerten, hat in der deutschen Geschichtswissenschaft kontroverse Ergebnisse hervorgebracht. Umstritten ist dabei vor allem die Frage, wie das deutsche Vorgehen völkerrechtlich und moralisch zu bewerten sei.
Vor allem ältere (west-)deutsche Forschungen haben häufig einerseits, zum Teil basierend auf nach dem Krieg entstandenen Darstellungen von Wehrmachtoffizieren, Hitler persönlich die hauptsächliche Schuld zugewiesen. Der Diktator habe die Belagerung aus Hass und Verachtung gegenüber dem traditionellen kulturellen Zentrum des zaristischen Russland wie gegenüber der Wiege der bolschewistischen Revolution befohlen. Andererseits wird in diesen Darstellungen aber betont, dass die Strategie der Belagerung von Städten nicht ungewöhnlich, vielmehr in der Kriegshistorie häufig angewendet worden sei. In diesem Sinne könne zwar die hohe Anzahl von Opfern im Falle Leningrads als besonders tragisch betrachtet werden, jedoch nicht von einem Bruch mit gängiger militärischer Praxis und daher auch nicht von einem eine moralische Verurteilung der Wehrmacht legitimierenden Kriegsverbrechen die Rede sein. Hauptmotiv der Deutschen, auf eine militärische Eroberung der Stadt zu verzichten und stattdessen den Versuch zu unternehmen, diese durch Aushungern zur Aufgabe zu zwingen, sei nach diesen Interpretationen die Furcht vor dem erwarteten Widerstand von Roter Armee und Freischärlern und vor einem daraus folgenden, erbitterten und verlustreichen Strassenkampf gewesen. Eine wichtige Rolle hätten bei der Entscheidung Ende August, Anfang September 1941 aktuelle taktische Erwägungen, weniger langfristige Kriegsziele gespielt.
Demgegenüber setzt die jüngere deutsche Forschung die Belagerung Leningrads häufiger in den Kontext eines von den Nationalsozialisten in bewusstem Bruch mit Kriegs- und Völkerrechtstraditionen durchgeführten Vernichtungskrieges. Mit dessen Zielen und Praktiken hätten sich die meisten höheren Wehrmachtoffiziere identifiziert. Auch die konkrete Entscheidung für die Belagerung Leningrads sei nicht nur aus kriegstaktischen Gründen erfolgt. Verantwortlich sei vielmehr eine strategische Umorientierung nach dem bald zutage tretenden Scheitern des Blitzkrieg-Konzeptes im Falle der Sowjetunion gewesen, was eine Reduktion von eigenen Operationen und Risiken notwendig gemacht habe. In der Folge setzte sich demnach unter den deutschen Militärs schnell eine Rhetorik durch, in der die komplette Vernichtung der Stadt und ihrer Bevölkerung zum eigentlichen Ziel der Belagerung erhoben wurde. Der deutsche Historiker Jörn Hasenclever rechnet Hitlers Weisung, Leningrad auszuhungern, unter die verbrecherischen Befehle, die der Wehrmacht im Krieg gegen die Sowjetunion gegeben wurden. In einer Fachstudie bezeichnet der Historiker Jörg Ganzenmüller im Jahr 2005 den blockadebedingten Tod von Hunderttausenden von Leningradern so als von den Deutschen gezielt herbeigeführten „Genozid“, basierend auf einer „rassistisch motivierten Hungerpolitik“. Selbst Joseph Goebbels spricht in seinen Tagebuchnotizen vom „schaurigsten Stadtdrama, das sich hier entwickele“. Der britische Historiker Timothy Snyder bezeichnet das bewusste Aushungern Leningrads als „das grösste deutsche Verbrechen in der russischen Sowjetrepublik“. Der amerikanische Historiker Richard Bidlack bezeichnet die Belagerung als „die grösste Völkermordaktion in Europa während des Zweiten Weltkriegs“.
Der Völkerrechtler Christoph Safferling vertritt in einem Vortrag im Jahr 2014 demgegenüber die Ansicht, dass in den frühen 1940er Jahren noch keine explizite völkerrechtliche Vorschrift gegen den Einsatz von Hunger als Waffe gegen die Zivilbevölkerung existiert habe. Eine solche sei erst 1977 mit einem Zusatzprotokoll zu den Genfer Konventionen eingeführt worden. Dies sei auch der Grund dafür, dass die Leningrader Blockade in den Nürnberger Prozessen nicht als Kriegsverbrechen bezeichnet wurden.
Einen weiteren Aspekt für die Deutung der Belagerungsstrategie lieferte die Auswertung und Analyse von Dokumenten der Wehrmacht und des Rasse- und Siedlungshauptamtes durch Autoren wie Rolf-Dieter Müller. So entwickelten in den Jahren 1940/41 hochrangige Funktionäre der Wehrmacht, SS und der sogenannten Reichsgruppe Industrie Pläne zur Besiedlung des „neuen deutschen Ostraumes“ nach einem erwarteten erfolgreichen Abschluss des Russlandfeldzuges. Ein neues deutsches Kolonialgebiet von der Weichsel bis zum Uralgebirge wurde angestrebt, besiedelt von deutschen Wehrbauern. Das Gebiet sollte weiträumig entindustrialisiert und die „überflüssige“ Grossstadtbevölkerung beseitigt werden. Metropolen wie Leningrad und Moskau waren daher zu vernichten.
Sowjetische Literatur
In den Jahren, die kurz auf die Blockade folgten, wurde die grausame Realität der Leiden der Leningrader Bevölkerung in der sowjetischen Literatur ungeschönt und wirklichkeitsnah wiedergegeben. Gennadij Gor, Alexander Tschakowski, Olga Bergholz, Iwan Kratt oder Wera Inber gehören zu den heute bekannten Autoren von Werken über die Leningrader Blockade. Nachdem jedoch Alexei Kusnezow und Pjotr Popkow 1949 während der Leningrader Affäre verhaftet und hingerichtet worden waren, begann auch die Säuberung der sowjetischen Literatur über die Blockade. Eingezogen oder vernichtet wurden Bücher, die eine viel zu „aufrichtige und grausame“ Darstellung der Leiden der Leningrader Bevölkerung enthielten oder das Verhalten der Leningrader „unpatriotisch“ und „ideologielos“ schilderten. Deswegen wurden die Gedichte von Gennadij Gor (Blockade) erst viel später veröffentlicht (übersetzt und herausgegeben von Peter Urban 2007). Die Zensur allzu realitätsnaher Berichte über die Blockade hielt in der Sowjetunion bis in die 1980er-Jahre hinein an. Stattdessen wurden nur patriotisch überhöhte und parteiideologisch korrekte Werke zugelassen. Erst nach dem Ende der Sowjetunion konnten seriöse Schilderungen der Blockade in Russland ungehindert verbreitet werden.
Die Schülerin Tanja Sawitschewa führte während der Blockade ein Tagebuch und dokumentierte die Tode von Familienmitgliedern. Das Tagebuch wurde zum Beweismittel in den Nürnberger Prozessen. Sie starb knapp zwei Jahre nach ihrer im August 1942 erfolgten Evakuierung.
Einflüsse auf die Kultur
Der Belagerung von Leningrad wurde in den späten 1950er-Jahren durch den Grüngürtel des Ruhmes gedacht, ein Band von Bäumen und Denkmälern entlang des früheren Frontverlaufs. Leningrad wurde als erster Stadt der Sowjetunion der Titel Heldenstadt verliehen.
Dmitri Schostakowitsch schrieb seine Siebente, die Leningrader Symphonie:

„Ich widme meine Siebente Sinfonie unserem Kampf gegen den Faschismus, unserem unabwendbaren Sieg über den Feind, und Leningrad, meiner Heimatstadt …“
Der aufgrund der Evakuierung seiner Eltern am 28. November 1943 in Taschkent geborene Leningrader Komponist Alexander Knaifel gedenkt der Blockade mit seinem Werk Agnus Dei aus dem Jahre 1985: „Agnus Die“ may have been created as repentance for my nonexistent fault of being born outside Leningrad.
1986 erschien das Jugendbuch Oleg oder Die belagerte Stadt von dem niederländischen Schriftsteller Jaap ter Haar, das die Belagerung aus der Sicht eines sowjetischen Jungen erzählt.
Das 1987 veröffentlichte Lied Leningrad des amerikanischen Sängers Billy Joel behandelt zum Teil das Leben eines Russen namens Viktor, der 1944 geboren wurde und seinen Vater während der Einschliessung verlor.
- 2003 publizierte die US-Autorin Elise Blackwell Hunger, einen Roman über die Ereignisse am Rande der Belagerung.
- In dem Buch Stadt der Diebe des amerikanischen Autors David Benioff werden die Geschehnisse während der Belagerung der Stadt behandelt.
- 2009 entstand der Kinofilm Leningrad – Die Blockade (u. a. mit Armin Mueller-Stahl).
- 2012 erschien das Buch Leningrad Waltz von dem russischen Schriftsteller Grigorij Demidowtzew.
- 2014 veröffentlichte die Band Ring of Fire ein Album mit dem Namen Battle of Leningrad.
- 2017 entsteht in Regie von Carsten Gutschmidt, Christian Frey: Leningrad Symphonie, eine Stadt kämpft ums Überleben. Ein 90-Minuten-Spielfilm mit Dokumentarszenen (NDR und arte).
Schlacht am Asowschen Meer (26.09.1941 – 21.09.1941)
Die Schlacht am Asowschen Meer vom 26. September bis zum 21. November 1941 war eine Schlacht zwischen der deutschen Wehrmacht und der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg.
Hintergrund
Anfang September 1941 hatte die 11. Armee der Wehrmacht (unter Eugen von Schobert, ab dem 12. September Erich von Manstein) den Übergang über den unteren Dnepr bei Berislawl erzwungen und die Verfolgung des zurückgehenden sowjetischen Gegners aufgenommen. Damit war in südöstlicher Richtung der Zugang zur Krim in Reichweite. Weiter östlich sollte das Industrie- und Verkehrszentrum Rostow am Don erreicht werden. Für das zweite Ziel bestand kein direkter Anschluss zur Panzergruppe 1 (unter Ewald von Kleist; am 6. Oktober in 1. Panzerarmee umbenannt), die weiter nördlich stand. Aufgrund herangeführter sowjetischer Verstärkungen musste die Verfolgung jedoch am 21. September eingestellt werden.
Verlauf
Am 26. September starteten die sowjetische 9. und 18. Armee mit insgesamt zwölf Divisionen einen Grossangriff gegen die östliche Front der deutschen 11. Armee. Diese setzte sich aus dem XXX. Armeekorps (22. und 72. Infanterie-Division) und der rumänischen 3. Armee (1., 2. und 4. Gebirgs-Brigade, verstärkt durch die deutsche 170. Infanterie-Division) zusammen, während ein weiteres Korps am Zugang zur Krim stand (LIV. Armeekorps). Nach einem 15 km breiten Durchbruch bei der rumänischen 3. Armee wurde das in Richtung Krim marschierende XXXXIX. Gebirgskorps (1. und 4. Gebirgs-Division) herumgedreht, um die Ostfront zu verstärken. Bis zum 29. September spitzte sich die Lage weiter zu. Erst ein Gegenangriff des eingetroffenen Gebirgskorps in Verbund mit der SS-Brigade „Leibstandarte SS Adolf Hitler“ bereinigte die Situation bei der rumänischen 3. Armee.
In den folgenden Tagen verstärkten die beiden sowjetischen Armeen noch einmal den Druck, insbesondere auf das XXX. Armeekorps. Gleichzeitig waren weitgehend unbemerkt von der Roten Armee an deren Nordflanke die Vorbereitungen der Panzergruppe 1 zum Eingreifen zum Abschluss gekommen. Am 1. Oktober gingen schliesslich auch das XXX. Armeekorps und die rumänische 3. Armee zum Gegenangriff über. Das XIV. Armeekorps (mot.) unter General von Wietersheim hatte den Kessel am 9. Oktober durch den Vorstoss von Nordosten und Osten geschlossen. Die unterstellte 16. Panzerdivision hielt bei Andrejewka, die 60. Infanterie-Division (mot.) bei Semenowka und die SS-Division „Wiking“ im Raum östlich von Mermentschik. Bis zum 11. Oktober wurde die Masse der sowjetischen Armeen im Raum Bolschoi Tokmak–Mariupol–Berdjansk eingekreist oder in überholender Verfolgung geschlagen. Dabei wurden ca. 65.000 Gefangene gemacht und 125 Panzer und über 500 Geschütze erbeutet.
Folgen
Diese Schlacht war für die Wehrmacht ein grosser operativer Erfolg, der durch die Zusammenwirkung zweier Grossverbände (Teile der 11. Armee und Panzergruppe 1) ermöglicht wurde. In der Folge entstand eine neue Kräftegliederung am Südflügel der Ostfront, die die weiteren Operationen vorgeben sollte. Der bisherige Doppelauftrag der 11. Armee wurde geändert in die alleinige Eroberung der Krim-Halbinsel. Dazu wurde die Armee verkleinert und bestand aus nur noch zwei Korps mit je drei Divisionen sowie der rumänischen 3. Armee. Das weitere Vorgehen auf Rostow wurde der Panzergruppe 1 aufgetragen, die zu diesem Zweck durch das XXXXIX. Gebirgs-Korps und die SS-Brigade „Leibstandarte SS Adolf Hitler“ verstärkt wurde.
Schlacht um Rostow (17.09.1941 – 02.12.1941)
Die Schlacht um Rostow war eine der ersten Angriffsoperationen der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg und dauerte vom 17. November bis zum 2. Dezember 1941. In deren Verlauf gelang es erstmals, eine grössere Stadt zurückzuerobern, die zuvor von der Wehrmacht eingenommen worden war.
Hintergrund
Gemäss den ursprünglichen Angriffsplänen der Wehrmacht sollte die 11. Armee gleichzeitig die Halbinsel Krim und Rostow erobern und anschliessend in den Kaukasus vorstossen. Nach der für die deutsche Seite erfolgreichen Schlacht am Asowschen Meer wurde der Plan jedoch geändert: Während die 11. Armee von ihrer Doppelaufgabe entbunden wurde und nur noch die Krim einnehmen sollte, fiel die Eroberung von Rostow nun der 1. Panzerarmee zu, die zu diesem Zweck durch das XXXXIX. Gebirgs-Korps und die SS-Brigade „Leibstandarte SS Adolf Hitler“ verstärkt wurde. Die 1. Panzerarmee stiess entlang des Asowschen Meeres vor und konnte am 17. Oktober den Mius überschreiten, am selben Tag gelang die Einnahme von Taganrog. Starker Herbstregen und die dadurch verursachte Schlammperiode liessen den deutschen Angriff vor Rostow jedoch vorläufig zum Erliegen kommen.
Verlauf
Nachdem Bodenfrost eingesetzt hatte, konnte die 1. Panzerarmee am 17. November ihren Angriff wieder aufnehmen. Am 21. November wurde Rostow durch den Vorstoss des III. Armeekorps (mot.) (General von Mackensen) eingenommen und die sowjetische 56. Armee unter Generalleutnant Remessow zunächst hinter den Don zurückgedrängt.
Der Erfolg der Deutschen war jedoch nur von kurzer Dauer, denn die sowjetische 37. Armee unter dem Kommando von Anton Lopatin hatte zur selben Zeit eine Offensive gegen die nördliche Flanke der 1. Panzerarmee begonnen. Sie konnte durchbrechen und etwa 35 Kilometer weit vordringen und den Fluss Tuslow nordöstlich von Rostow erreichen. Die 13. Panzer- und SS-Division „Wiking“ wurden entsandt, um dem deutschen XIV. Armee-Korps (mot.) Hilfe zu leisten.
Die bereits in der Stadt kämpfenden deutschen Einheiten drohten nun von ihren rückwärtigen Verbindungen abgeschnitten zu werden. Die Reste der sowjetischen 31. Schützen-Division (Oberst Michail Iwanowitsch Ozimin) und das Schützen-Regiment 1175 der 347. Schützen-Division hielten sich in den nördlichen Aussenbezirken von Rostow in verstreuten Gruppen. Die 353. Schützen-Division (Oberst Grigori Filippowitsch Panchenko) musste am Morgen des 20. November auf das Dorf Kamenolomni in den nördlichen Aussenbezirken von Rostow zurückgehen und wurde auf das linke Don-Ufer zurückgezogen, wo sie die wichtige Eisenbahnbrücke besetzte. Um 14 Uhr durchbrach die deutsche 14. Panzer- und 60. Infanterie-Division (mot.) die Verteidigung der 347. Schützen-Division (Oberst Nikolai Iwanowitsch Seliverstow). Die sowjetischen Einheiten, die in der Mitte von Rostow und am Don operierten, drohten von den Hauptstreitkräften der Armee abgeschnitten zu werden. Letztere Division wurde mit dem Schützen-Regiment 1145 verstärkt, um den Feind in der Nähe des Hauptbahnhofs aufzuhalten. Gleichzeitig stiess die 343. Schützen-Division (Oberst Peter Pawlowitsch Tschuwaschow) den deutschen Truppen im Zentrum der Stadt erfolgreich in die Flanke.
Um der drohenden Einkesselung zu entgehen, die gleichzeitig von Norden durch die nach Süden vorgegangene 37. Armee drohte, ordnete der Befehlshaber der Heeresgruppe Süd, Gerd von Rundstedt, gegen die ausdrückliche Weisung Hitlers den Rückzug aus Rostow an. Da er die Absetzbewegung jedoch fortführte, wurde er am 1. Dezember entlassen und durch Walter von Reichenau ersetzt. Die sowjetische 56. Armee, die am 27. November ihre Gegenoffensive gegen Rostow gestartet hatte, stellte am 30. November eine mobile Gruppe (62. und 64. Kavalleriedivision sowie 54. Panzerbrigade) unter dem Kommando von Generalmajor Gretschkin zusammen, um die deutschen Truppen den Rückzug zu verlegen. Zwei Tage später konnte die Sowjets Rostow mit Hilfe von Partisanen und der Rostower Landwehr befreien. Den zurückweichenden deutschen Verbänden folgend, erreichten sowjetische Truppen am 2. Dezember den Mius, wo sie jedoch an einer von der Wehrmacht errichteten Verteidigungslinie gestoppt wurden.
Folgen
Die Rote Armee stiess auf einer 140 bis 180 Kilometer breiten Front 60 bis 80 Kilometer weit vor und verhinderte den deutschen Durchbruch zum Kaukasus. Dabei befreite sie mit Rostow am Don die erste grössere sowjetische Stadt, die zuvor von der Wehrmacht besetzt worden war. Im Verlauf der Kämpfe erlitt die Rote Armee Verluste in Höhe von 33.111 Mann (15.264 davon Tote und Vermisste). Die Wehrmacht verlor etwa 20.000 Mann bis 30.000 Mann. Die Quellen geben unterschiedliche Zahlen an.
Im Verlauf der deutschen Sommeroffensive 1942 wurde Rostow im Juli erneut von den Deutschen besetzt. Im Februar 1943 erfolgte die endgültige sowjetische Rückeroberung.
Doppelschlacht bei Wjasma und Brjansk (30.09.1941 – 30.10.1941)
Die Doppelschlacht von Wjasma und Brjansk war eine militärische Auseinandersetzung während des Zweiten Weltkriegs an der deutsch-sowjetischen Front. Sie begann unter dem Decknamen Unternehmen Taifun am 30. September 1941 mit dem Angriff der deutschen Heeresgruppe Mitte gegen die sowjetische West-, Reserve- und Brjansker Front. Ziel der deutschen Offensive war die Zerschlagung der Verbände der Roten Armee vor Moskau und anschliessend die Eroberung der Stadt selbst. Trotz anfänglicher Erfolge der Wehrmacht, die bei Wjasma und Brjansk grosse Teile der sowjetischen Verteidiger einkesseln und aufreiben konnte, lief sich der Vorstoss bis zum 30. Oktober 1941 im herbstlichen Schlamm und dem sich verstärkenden sowjetischen Widerstand fest. Erst nach mehr als zwei Wochen konnte sie mit dem Einsetzen von Frostwetter erneut zur Offensive übergehen und damit die Schlacht um Moskau eröffnen.
Hintergrund
Seit dem Beginn des Angriffs auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 hatten die drei deutschen Heeresgruppen die Verteidigung der Roten Armee durchbrochen und in mehreren Kesselschlachten zahlreiche sowjetische Verbände aufgerieben. Die Heeresgruppe Mitte war in die allgemeine Richtung Moskau angesetzt. Sie hatte die Kesselschlachten von Minsk und Smolensk für sich entschieden, erhielt jedoch am 30. Juli 1941 den Befehl, den Vormarsch vorläufig einzustellen.
In den Tagen zuvor war es in der deutschen Führung zu einer Krise hinsichtlich der Frage gekommen, wie die weiteren Operationen gestaltet werden sollten. Hitler war der Ansicht, dass der Eroberung Moskaus kein Vorrang zukam. Seiner Meinung nach waren zunächst die wirtschaftlich bedeutenden Gebiete der Ukraine zu besetzen und Leningrad zu erobern. Darum sollte die Heeresgruppe Mitte ihre Panzerstreitkräfte an die benachbarten Heeresgruppen Nord und Süd abgeben, in deren Operationsbereich diese Ziele lagen. Für den Vorstoss auf Moskau wären dann jedoch nur noch die geschwächten Infanterie-Armeen verblieben, die dieser Aufgabe angesichts andauernder sowjetischer Gegenangriffe nicht gewachsen waren. Die militärische Führung im Oberkommando des Heeres (OKH) betrachtete diese Entscheidung als falsch und versuchte Hitler davon abzubringen. Der Chef des Generalstabs des Heeres Generaloberst Franz Halder verwies auf die Gefahr, dass bei einem Verzicht des Vorgehens auf Moskau der Gegner Zeit gewinne und eine spätere deutsche Offensive bei Einbruch des Winters zum Stehen bringen könne, womit das militärische Ziel des Unternehmens Barbarossa nicht erreicht würde. Dennoch setzte Hitler am 28. Juli seine Vorstellungen durch, indem er die 2. Armee und die Panzergruppe 2 nach Süden in die Ukraine abdrehen liess, wo diese an der Schlacht um Kiew teilnahmen. Die Panzergruppe wurde in den Norden verlegt, um sich an der Eroberung von Leningrad zu beteiligen.
Erst nach einiger „Überzeugungsarbeit“ konnten sich das OKH und der Wehrmachtführungsstab Mitte August durchsetzen. Hitler legte in der Weisung Nr. 34 am 12. August fest, dass das „Staats-, Rüstungs- und Verkehrszentrum“ Moskau noch vor Einbruch des Winters besetzt werden solle. Allerdings hatten die Ziele Leningrad und Ukraine nach wie vor Vorrang, so dass zunächst die Kämpfe dort abgeschlossen werden sollten, bevor eine Offensive auf Moskau vorbereitet werden konnte. Die Kämpfe in der Ukraine und vor Leningrad zogen sich allerdings bis September hin. Schon vor ihrem endgültigen Abschluss erteilte Hitler jedoch am 6. September 1941 die Weisung Nr. 35, welche die Grundlage der zukünftigen Offensive darstellte:

„Die Anfangserfolge gegen die zwischen den inneren Flügeln der Heeresgruppen Süd und Mitte befindlichen Feindkräfte haben […] die Grundlage für eine entscheidungssuchende Operation gegen die vor der Heeresmitte stehende in Angriffskämpfen festgelegte Heeresgruppe Timoschenko geschaffen. Sie muss in der bis zum Einbruch des Winterwetters verfügbaren befristeten Zeit vernichtend geschlagen werden. Es gilt hierzu, alle Kräfte des Heeres und der Luftwaffe zusammenzufassen, die auf den Flügeln entbehrlich werden und zeitgerecht herangeführt werden können“.
Als Ziel des Unternehmens legte die Weisung fest „den im Raum ostwärts Smolensk befindlichen Gegner in doppelter, in allgemeiner Richtung Wjasma angesetzter Umfassung […] zu vernichten. […] Erst dann […] wird die Heeresgruppe Mitte zur Verfolgung Richtung Moskau – rechts angelehnt an die Oka, links angelehnt an die obere Wolga – anzutreten haben“. Damit war Hitler wieder auf die grobe Linie des OKH und der Oberkommandos der Heeresgruppe Mitte eingeschwenkt.
Deutsche Angriffsvorbereitungen
Der deutsche Generalstab hatte schon vor der Entscheidung zum Abdrehen der Panzerverbände gegen Kiew am 18. August 1941 einen Operationsplan vorgelegt, der eine doppelte Umfassung der sowjetischen Verbände vor der Heeresgruppe Mitte vorsah. Bei dieser Planung wurde zunächst offengelassen, ob nach einem gelungenen Vorstoss direkt zur Umfassung Moskaus übergegangen werden sollte oder ob zunächst die sowjetischen Verbände vor der Hauptstadt eingeschlossen und aufgerieben werden sollten. Bereits in einer Aussprache zwischen Hitler und dem Oberbefehlshaber des Heeres Generalfeldmarschall Walther von Brauchitsch am 30. August 1941 hatte man sich auf einen neuen Vorstoss in Richtung Moskau geeinigt. Bereits vor der offiziellen Weisung Hitlers wurden die Befehlshaber der betroffenen Armeen darüber informiert. Wenige Tage darauf erfolgte die Weisung Nr. 35 aus Hitlers Hauptquartier.
Das Oberkommando des Heeres (OKH) erliess am 10. September 1941 eine Weisung zur Fortführung der Operationen, in der Generalstabschef Franz Halder die Weisung Hitlers präzisierte und teilweise auch uminterpretierte. In Hitlers Plan war die Einnahme Moskaus erst nach einer Vernichtung der sowjetischen Streitkräfte vorgesehen, während Halder befahl, gleichzeitig Verbände auf die Hauptstadt vorrücken zu lassen. Weiterhin bezog er die 2. Armee und die Panzergruppe 2, die zu diesem Zeitpunkt noch vor Kiew gebunden waren, in die Planungen ein. Diese sollten aus dem Raum Romny gegen Orjol antreten. Damit hatte Halder zusätzlich eine dritte Stossgruppe für den Angriff nach Osten geschaffen. Die Weisung sah weiterhin die Abgabe von Truppen der anderen Heeresgruppen vor. Die Heeresgruppe Süd musste zwei Generalkommandos, vier Infanterie-Divisionen, zwei Panzer-Divisionen und zwei motorisierte Infanterie-Divisionen abgeben, während es bei der Heeresgruppe Nord mit der Panzergruppe 4 drei Generalkommandos, fünf Panzer-Divisionen und zwei motorisierte Infanterie-Divisionen waren.
Während Hitler die Zangenarme der Panzertruppen direkt auf Wjasma ansetzen wollte, wollte Generalfeldmarschall Fedor von Bock, der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte, die Umfassung des Feindes erst weit hinter Wjasma bei Gschatsk durchführen. Generaloberst Halder stimmte dem zu und versicherte von Bock seiner Unterstützung. Am 17. September 1941 besprachen beide die konkreten von Bock aus gearbeiteten Operationspläne. Am 24. September trafen sich die Oberbefehlshaber der Armeen, Panzergruppen und der Luftflotte 2 mit von Bock und Halder in Smolensk zu einer letzten Besprechung der Unternehmung, die am 19. September die Bezeichnung Unternehmen Taifun erhalten hatte. In ihr wurde festgelegt, dass die Panzergruppe 2 bereits am 30. September, also zwei Tage vor den übrigen Verbänden, zum Angriff übergehen sollte. Dies hatte Generaloberst Heinz Guderian durchgesetzt; da in seinem Angriffsbereich kaum feste Strassen vorhanden waren, war er der Auffassung, möglichst schnell bei Orjol feste Strassen und von dort aus Querverbindungen nach Brjansk gewinnen zu müssen.
Die endgültigen Aufträge an die einzelnen Armeen wurden am 26. September erteilt. Um die enge Kooperation zwischen Panzergruppen und Infanterie-Armeen zu gewährleisten, wurde die Panzergruppe 4 operativ der 4. Armee unterstellt. Sie sollte entlang der Strasse Roslawl–Moskau angreifen und nach dem gelungenen Durchbruch beiderseits von Wjasma gegen die Autobahn Smolensk–Moskau einschwenken. Nördlich davon hatte die Panzergruppe 3, die der 9. Armee unterstellt war, die sowjetischen Linien südlich von Bely zu durchbrechen und die Strasse Wjasma–Rschew zu gewinnen, bevor sie westlich von Wjasma eindrehen sollte. Die inneren Flügel beider Gruppierungen sollten derweil den Gegner vor ihnen binden. Die 2. Armee bekam den Auftrag, zum Schutz der Flanke der 9. Armee gegen Suchinitschi und Meschtschowsk vorzustossen. Die Panzergruppe 2 schliesslich, die direkt dem Oberkommando der Heeresgruppe Mitte unterstand, sollte die sowjetischen Stellungen von Süden her aufrollen. In Zusammenwirkung mit der 2. Armee sollte der Gegner im Raum Brjansk aufgerieben werden. Angriffsbeginn sollte (ausser für die Panzergruppe 2) der 2. Oktober 1941 um 5.30 Uhr sein.
Hitler hatte Halder gegenüber am 6. September verlangt, dass die Operation binnen acht bis zehn Tagen beginnen solle, was dieser angesichts der Verfassung der Truppen als unmöglich bezeichnete. Die Panzergruppe 2 und die 2. Armee mussten erst aus dem Einschliessungsring des Kessels von Kiew herausgelöst werden, zudem hatten die Verbände in den langen Abwehrkämpfen vor Smolensk ihre Offensivkraft eingebüsst. Die Verlegung von Verbänden von den anderen Heeresgruppen über mehr als 600 km Entfernung sowie die Heranführung der 2. und 5. Panzer-Division aus Deutschland beanspruchte viel Zeit. Ausserdem war es nicht mehr möglich, die personellen Verluste der Vormonate auszugleichen. Trotzdem konnte die Heeresgruppe Mitte am 2. Oktober 1941 insgesamt 1.929.406 Soldaten in 78 Divisionen (46 Inf.Div., 1 Kav.Div., 14 Pz.Div., 8 Inf.Div. (mot.), 6 Sich.Div., 1 SS-Kav.Brig.) ins Feld stellen, die jedoch nicht alle an der geplanten Offensive teilnahmen. Diese Verbände hatten allerdings erheblich an Kampfkraft eingebüsst, da sich sowohl die Soldaten als auch das Material seit Monaten ununterbrochen im Einsatz befunden hatten.
Zudem hielt Hitler grosse Mengen an Panzern zurück, die er für den Einsatz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion vorgesehen hatte. Da die dauernden Ausfälle deshalb nicht ersetzt wurden, lag der Panzerbestand der Panzergruppe 2 bei Beginn der Operationen bei nur 50 Prozent, derjenige der Panzergruppe 3 bei 70 bis 80 Prozent und nur derjenige der Panzergruppe 4 bei etwas unter 100 Prozent. Von diesen Beständen waren allerdings kaum alle Fahrzeuge einsatzfähig. Ausserdem gab es ein Defizit von 22 Prozent an Kraftfahrzeugen und von 30 Prozent an Zugmaschinen. Lediglich 125 Panzer wurden als Ersatz zugesagt, obwohl Generaloberst Halder vergeblich um die Freigabe weiterer 181 Panzer ersuchte. Aber selbst bei ihrer Zuführung hätte sich die Einsatzbereitschaft der besonders geschwächten Panzer-Divisionen nur um 10 Prozent erhöht. Die Behauptung der sowjetischen Geschichtsschreibung, die deutschen Angriffsverbände seien voll aufgefüllt und ausgerüstet gewesen, womit ihnen 1700 Panzer zur Verfügung gestanden hätten, entspricht nicht den Tatsachen. Der Historiker Klaus Reinhardt ermittelte für den tatsächlichen Bestand die Zahl von 1220 Panzern.
In Gomel, Roslawl, Smolensk und Witebsk wurden zudem Vorratslager für die Versorgung der Truppen während der geplanten Offensive angelegt. Allerdings wären zur Auffüllung der Lager im September täglich 27 Versorgungszüge notwendig gewesen, im Oktober sogar 29. Die tatsächliche Leistung belief sich jedoch nur in den ersten 13 Tagen auf diese Zahlen. Ende September und im Oktober kamen nur noch 22 Züge täglich an, bevor die Anzahl im November weiter auf 20 abfiel. Die Versorgung galt daher lediglich als „zufriedenstellend“.
Sowjetische Lage
Bereits kurz nach den Kämpfen um Smolensk verfügte das sowjetische Staatliche Verteidigungskomitee (GKO) den Ausbau von Verteidigungsstellungen vor Moskau. Seit dem 16. Juli 1941 wurde im Raum Moschaisk unter Heranziehung von Zivilisten der Aufbau einer befestigten Verteidigungslinie betrieben. Etwa 85.000–100.000 Moskauer, vorwiegend Frauen, sollen sich an den Arbeiten beteiligt haben. Bis zum Beginn der deutschen Offensive waren die verschiedenen Verteidigungsbauten (Bunker, Panzersperren, Gräben) erst zu je 40 bis 80 Prozent vollendet.
Am 12. September 1941 übernahm Generaloberst I. S. Konew den Befehl über die Westfront. Diese umfasste zu diesem Zeitpunkt die 22., 29., 30., 19., 16. und 20. Armee, die nebeneinander vom Seligersee im Norden bis Jelnja im Süden standen. Daneben existierte noch die Reservefront des Marschalls der Sowjetunion S. M. Budjonny, deren 24. und 43. Armee entlang der Desna standen und somit links an die Westfront anschlossen, die aber mit ihrer Hauptmasse (31., 49., 32. und 33. Armee) im Raum Wjasma 35 km hinter der Front auch eine zweite Abwehrlinie bildete. Weiter im Süden standen die 50., 3. und 13. Armee der Brjansker Front unter Generaloberst A. I. Jerjomenko im Raum zwischen Schukowka und Woroschba. Diese Fronten umfassten etwa 40 Prozent des Personals und der Artillerie sowie 35 Prozent der Panzer und Flugzeuge aller sowjetischen Streitkräfte.
Nach den gewaltigen Verlusten, welche die Rote Armee im Sommer 1941 erlitten hatte, mangelte es ihr nun an ausgebildeten Stabsoffizieren. Zudem fehlte es an Fernmelde-Gerät, sodass die Verbindung unter den einzelnen Stäben schlecht und anfällig für Störungen war. Teilweise war auch die Frontlinie zu dünn besetzt. Die sechs Armeen der Westfront verteidigten einen Abschnitt von 340 km, wobei jede Armee 5–6 Schützendivisionen in erster Linie und nur eine in Reserve hatte. Die Verbände bestanden nur noch teilweise aus ausgebildeten Veteranen, die man mit praktisch unausgebildeten Freiwilligen ergänzt hatte. Diesen fehlte es wegen ihrer hastigen Mobilmachung an Maschinengewehren und anderen Infanteriewaffen. Angeblich sollen je Frontkilometer nur 6 bis 9 Geschütze verfügbar gewesen sein. Auch hatte die Rote Armee die Verluste an Panzern in den zahlreichen Schlachten der Vormonate nicht ausgleichen können. Generaloberst Konew verfügte zwar über 479 Panzer, aber von diesen waren nur 45 von einem modernen Typ. In der offiziellen sowjetischen Darstellung wurde später die Zahl von 770 Panzern am gesamten Westabschnitt der Front genannt. Allerdings gibt es über den Umfang der sowjetischen Streitkräfte in den drei Fronten keine verlässlichen Angaben. In verschiedenen sowjetischen Publikationen reichen sie von 800.000 Soldaten, 6.800 Geschützen, 780 Panzern und 360–527 Flugzeugen bis maximal 1.250.000 Soldaten, 10.598 Geschützen, 990 Panzern und 930 Flugzeugen. Nach den auf Archivmaterial aufbauenden Angaben des russischen Historikers G. F. Kriwoschejew aus dem Jahr 2001 ist eher von den höheren Zahlen auszugehen.
Generaloberst Konew wies die Stawka am 26. September auf die erkannten deutschen Angriffsvorbereitungen hin, die eine Offensive für den 1. Oktober vermuten liessen. Allerdings rechnete er nur mit einem relativ begrenzten Vorstoss im Bereich der 19., 16. und 20. Armee. Die Stawka reagierte deshalb in ihrer Direktive vom 27. September lediglich mit allgemeinen Anweisungen. Sie befahl, den Ausbau der Verteidigungsstellungen zu beschleunigen. Die Front-Befehlshaber wurden angewiesen, geschwächte Divisionen abzulösen und zur Auffrischung hinter die Front zu verlegen. Auf diese Weise sollten Reserven geschaffen werden. Die Fronttruppen selbst wurden in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Allerdings wurden die einzelnen Armee-Befehlshaber nicht ausreichend informiert. Gen.Lt. K. K. Rokossowski, damals Befehlshaber der 16. Armee, schrieb später in seinen Memoiren: „Die Information der Armeeoberbefehlshaber war zu jener Zeit überhaupt schlecht organisiert. Praktisch wussten wir nichts vom Geschehen innerhalb, geschweige denn ausserhalb der Front, was unsere Arbeit stark behinderte“. Erst am 28. September wurde auch die Brjansker Front vor bevorstehenden Angriffen gewarnt. Generaloberst Jerjomenko schlug aufgrund dessen eine Umgruppierung der Truppen vor. Allerdings kam es nicht dazu, weil der deutsche Angriff bereits zwei Tage später begann. Im Bereich der Westfront verbot Generalleutnant Konew jede Form des Ausweichens. Die Truppen sollten jeden Meter Boden verteidigen. Um auf eventuelle Durchbrüche des Gegners vorbereitet zu sein, versammelte er bei Wadino nördlich von Dorogobusch eine operative Reserve unter seinem Stellvertreter Generalleutnant I. W. Boldin.
Auf ausdrücklichen Befehl Stalins unternahmen die Front-Befehlshaber weiterhin begrenzte Offensiv-Operationen, was die Abwehrkraft der Truppen schwächte und sie schon vor Beginn des deutschen Angriffs grosse Verluste kostete. So führte zum Beispiel die 43. Armee unter Generalmajor P. P. Sobennikow bei Roslawl einen Vorstoss durch, während am 29. September Generalmajor A. N. Ermakow den Befehl erhielt, mit seiner operativen Gruppe die Stadt Gluchow zurückzuerobern. In beiden Fällen stiessen die Sowjets direkt in die Aufmarschzonen der deutschen Truppen und erlitten hohe Verluste. In den folgenden Tagen erleichterte dies den deutschen Truppen den Durchbruch durch die sowjetischen Linien.
Verlauf
Kessel von Brjansk
Am 30. September begann die Panzergruppe 2 bei besten Wetterbedingungen unter Generaloberst Guderian östlich von Gluchow ihren Angriff gegen die Brjansker Front. Bis gegen 13.00 Uhr am 1. Oktober hatte das XXIV. motorisierte Armeekorps (AK (mot.)) den linken Flügel der Gruppe Ermakow durchbrochen und ging auf Sewsk vor, während dasXXXXVII. AK (mot.) auf Karatschew vorstiess. Stalin und Generalstabschef B. M. Schaposchnikow befahlen noch in der Nacht, die eingebrochenen deutschen Verbände durch Flankenangriffe der 13. Armee (Gen. Maj. Gorodnjanskij) und der Gruppe Ermakow abzuschneiden.
Diese isolierten Gegenangriffe einzelner Panzerbrigaden trafen zwar das in der Flanke eingesetzte deutsche XXXXVIII. motorisierten Armeekorps, dessen Vormarsch auch verlangsamt wurde, doch durch den Einsatz der 9. Panzer-Division wurde die Lage schnell wiederhergestellt. Am 3. Oktober konnten deutsche Vorausverbände der 4. Panzer-Division das strategisch wichtige, aber aufgrund von Versäumnissen des örtlichen Kommandanten Gen.Lt. A. A. Tjurin unverteidigte Orjol einnehmen.
Die deutsche 2. Armee unter Generaloberst Maximilian von Weichs trat ab dem 2. Oktober gegen den rechten Flügel der Brjansker Front an und traf dort auf erbitterten Widerstand der sowjetischen 3. (Gen.Maj. J. G. Kreiser) und 50. Armee (Gen.Maj. M. P. Petrow). Erst mit dem Durchbruch der Panzergruppe 4 durch die weiter nördlich gelegenen Stellungen der sowjetischen 43. Armee (Gen.Lt. Stepan Akimow) gelang es der 2. Armee, durch die entstandene Lücke die sowjetische Front zu umgehen. Bis zum 5. Oktober nahm sie schliesslich Schisdra ein. Fast gleichzeitig erfolgte von Süden her der Vorstoss des XXXXVII. AK (mot.) über Karatschew auf Brjansk, welches am 6. Oktober mitsamt seinen wichtigen Desna-Brücken eingenommen wurde. Damit waren die Nachschub- und Kommunikationslinien der Brjansker Front abgeschnitten.
Auf sowjetischer Seite herrschte in diesen Tagen grösste Verwirrung. Schon die ersten deutschen Luftangriffe unterbrachen die Verbindung zwischen dem Front-Stab und den unterstellten Armeen. Die operative Reservegruppe bei Brjansk konnte nicht eingesetzt werden, weil sie schon bald selbst von deutschen Truppen angegriffen wurde. Gen.Lt. Jerjomenko erkannte bald die Gefahr, die seinen Truppen drohte. Er ersuchte deshalb bei Generalstabschef Schaposchnikow in Moskau um die Genehmigung, zu einer flexiblen Verteidigung mit Ausweichmöglichkeiten übergehen zu dürfen. Dies wurde verweigert und Jerjomenko angewiesen, jeden Meter Boden zu verteidigen. Am 5. Oktober meldete der Befehlshaber der Brjansker Front, dass er gezwungen sei, sofort nach Osten auszuweichen. Bis zum Morgen des 6. Oktober erhielt er jedoch keine Antwort. Am Mittag tauchten nahe seinem Gefechtsstand deutsche Panzer auf, sodass er mit drei Panzern und einigen Infanteristen fliehen musste. Damit war eine einheitliche Führung auf sowjetischer Seite zeitweise nicht mehr gegeben. Die Stawka konnte später den Befehl zum Rückzug nicht mehr übermitteln. Da sie davon ausging, dass Jerjomenko gefallen sei, beauftragte sie den Befehlshaber der 50. Armee Gen.Maj. M. P. Petrow mit der Führung der Front.
Bis zum 9. Oktober führte ein weiterer Vorstoss der 167. Inf.Div. (2. Armee) zu einer Vereinigung mit der 17. Pz.Div. (2. Panzerarmee) bei Brjansk, wodurch sich der Ring um die südwestlich um Trubtschewsk stehende sowjetische 3. und 13. Armee schloss. Noch am gleichen Tag befahl Gfm. von Bock, dass die Ausräumung dieses Kessels der 2. Panzerarmee übertragen werde. Die 2. Armee sollte sich um die Vernichtung des nördlich stehenden Gegners kümmern. Tatsächlich stiess sie weiter vor, und am 12. Oktober konnte bei Bujanowitschi ein weiterer Kessel um die sowjetische 50. Armee geschlossen werden. Da jedoch sowohl die 2. Panzer- als auch die 2. Armee auf Befehl des OKH und des Oberbefehlshabers der Heeresgruppe Mitte mit starken Teilen weiter nach Osten vorgehen mussten, ohne zuvor die Kessel „ausgeräumt“ zu haben, standen zur Einschliessung des Gegners nur wenige Kräfte zur Verfügung.
Am 12., 13. und 14. Oktober traten die sowjetischen Armeen zum Ausbruch an. Der 3. Armee gelang an der Nawlja, der 13. Armee bei Chomutowka ein Ausbruch. Die 50. Armee scheiterte hingegen unter hohen Verlusten an der Resseta. Letzten sowjetischen Gruppen gelang erst am 22./23. Oktober ein Ausbruch in Richtung Beljow. In der Linie Beljow–Fatesch sammelte Jerjomenko zwischen dem 17. und 24. Oktober erneut die Brjansker Front. Die Truppen hatten jedoch enorme Verluste erlitten. So hatte die 13. Armee beim Durchbruch ihre gesamte Artillerie und rückwärtigen Dienste verloren. Ausserdem lag die Gefechtsstärke ihrer sieben Schützendivisionen bei nur noch 1.500–2.000 Mann. Die fünf Schützendivisionen der 3. Armee hatten eine durchschnittliche Gefechtsstärke von nur 2.000 Mann. Die 50. Armee hatte hingegen noch einiges Material retten können. Gen.Lt. Jerjomenko war am 12. Oktober verwundet und anschliessend ausgeflogen worden. Gen.Maj. Petrow starb noch während der Kämpfe an den Folgen einer Gangrän. Deutsche Berichte sprechen von allein 108.000 sowjetischen Gefangenen neben 257 Panzern und 763 Geschützen, die zerstört oder erbeutet worden waren. Andererseits berichtete Gen.Lt. Jerjomenko später in seinen Memoiren, dass allein die 3. sowjetische Armee bei ihrem Ausbruch den deutschen Truppen Verluste in Höhe von 5.500 Toten und Verwundeten, sowie 100 Gefangene, 250 Kfz. und 50 Panzer beigebracht hätte.
Kessel von Wjasma
Am 2. Oktober traten auch die Panzergruppen 3 und 4 sowie die 4. und 9. Armee zur Offensive an. Der Angriff der Panzergruppe 4 des Generaloberst Erich Hoepner durchbrach am Morgen um 5.30 Uhr die sowjetischen Verteidigungslinien der 43. Armee (Gen.Maj. P. P. Sobennikow) an der Desna. Das XXXX. AK (mot.) stiess in den rückwärtigen Raum vor und konnte schon am 4. Oktober mit der 10. Panzer-Division Kirow und Mossalsk einnehmen, das 110 km von der Ausgangsstellung lag. Am folgenden Tag fiel auch Juchnow. In Moskau blieb die Stawka zunächst ohne Nachrichten von der Front. Als die Fliegerkräfte des 120. Jagdfliegerregiments das Vorgehen motorisierter Kolonnen auf Juchnow meldeten, wurde deren Nachrichten kein Glaube geschenkt. Der Chef der Moskauer Fliegerkräfte Oberst Sbytow wurde vom Chef des NKWD Lawrenti Beria sogar wegen „Verbreitung von Panikmache“ angeklagt. Der Einbruch der Panzergruppe 4 lag im Bereich der sowjetischen Reservefront des Marschalls Budjonny. Nachdem er schon früh seine wenigen Reserven zum Einsatz gebracht hatte, meldete er am 5. Oktober an die Stawka: „Die Lage am linken Flügel der Reservefront ist ausserordentlich ernst. Für die Abriegelung des […] entstandenen Einbruchs sind keine Kräfte vorhanden. […] Die Kräfte der Front reichen nicht aus, um den Angriff des Gegners […] aufzuhalten“. Gen.Ost. Hoepner konnte deshalb relativ frei operieren und drehte zunächst das XXXX. AK (mot.) nach Nordwesten in Richtung Wjasma ab, um hier mit den Truppen der Panzergruppe 3 zusammenzutreffen. Auf dem linken Flügel davon ging das XXXXVI. AK (mot.) gegen stärkeren sowjetischen Widerstand vor. Es nahm am 4. Oktober Spas-Demensk und wurde auf Anweisung des Befehlshabers der 4. Armee, Gfm. Günther von Kluge, danach nach Norden abgedreht, um den Südteil des geplanten Kessels zu bilden. Die Sicherung der Operationen nach Osten übernahm das LVI. AK (mot.).
Der Vorstoss der Panzergruppe 3 unter Generaloberst Hermann Hoth gestaltete sich schwieriger. Zwar durchbrach sie die sowjetischen Stellungen an der Naht der 19. (Gen.Lt. Lukin) und 30. Armee (Gen.Maj. Chomenko) und errichtete am 3. Oktober einen Brückenkopf über den Dnepr, dann aber brachte Generaloberst Konew hier seine operative Gruppe unter I.W. Boldin (3 Pz.Brig.; 1 Schützendivision (mot.); 1 Schützendivision) zum Einsatz, um den deutschen Durchbruch abzuriegeln. Am 3./4. Oktober griff sie bei Cholm-Schirkowski an. Der Ort wechselte zwar mehrfach den Besitzer, aber letztlich mussten sich Gen.Lt. Boldins Truppen zurückziehen. Nach sowjetischen Angaben sollen dabei 59 deutsche Panzer zerstört worden sein. Nun aber traten bei der Panzergruppe 3 Versorgungsengpässe beim Betriebsstoff auf, wodurch der Vormarsch der Panzer-Divisionen zum Erliegen kam. Erst nach Zuführungen durch die Luftflotte 2 war die Einsatzbereitschaft am Nachmittag des 5. Oktober wiederhergestellt. Die 4. und 9. Armee gingen derweil hinter den Panzergruppen vor, um diese später an der Kesselfront abzulösen. Gleichzeitig griffen sie jedoch auch frontal von Westen her die sowjetischen Stellungen an, um den sich bildenden Kessel zu verengen.
Nachdem die Gegenangriffe gescheitert waren, beantragte Generaloberst Konew noch am 4. Oktober eine Zurücknahme seiner Front in die Linie Gschatsk-Wjasma. Doch erst am Nachmittag des 5. Oktober traf die Stawka eine Entscheidung. Es wurde Konew gestattet, in die Linie Rschew-Wjasma zurückzugehen. Gleichzeitig unterstellte sie ihm die 31. und 32. Armee der Reservefront, um die Führung im Raum Wjasma zu vereinheitlichen. Doch auch diese beiden weit zurückgestaffelten Verbände waren bereits in Gefechte verwickelt, so dass sie als echte Verstärkung der Westfront ausfielen. Ein ähnlicher Rückzugsbefehl erreichte auch die Reservefront. So begann nun ein langsamer und ungeordneter Rückzug der sowjetischen Verbände. Die Deckung des Rückzuges wurde der Gruppe Boldin und der 31. Armee übertragen, während die 22. und 29. Armee auf Rschew und Stariza, die 49. und 43. Armee auf Kaluga und Medyn zurückging. Da schon bald die Verbindung zur Gruppe Boldin und der 31. Armee verloren ging, wurde die Führung des Rückzuges und dessen Deckung der 32. Armee des Gen.Maj. Wischnewski übertragen. Bis zum 7. Oktober um 10.30 Uhr geriet Wjasma jedoch in die Hand des XXXX. AK (mot.) der Panzergruppe 4 und noch im Lauf des Vormittags traf dort auch das LVI. AK (mot.) der Panzergruppe 3 ein. Damit war der Kessel geschlossen.
In der Einkreisung befanden sich neben der Gruppe Boldin die sowjetische 19. Armee (Gen.Lt. Lukin), 24. Armee (Gen.Maj. Rakutin), 32. Armee (Gen.Maj. Wischnewski) und die 20. Armee (Gen.Lt. Erschakow). In den Bestand der letzten waren zuvor allerdings auch die Truppen der 16. Armee (Gen.Lt. Rokossowski) übergegangen, sodass insgesamt mehr als fünf Armeen eingekesselt waren. Gen.Lt. M.F. Lukin übernahm den Oberbefehl über die eingeschlossenen Verbände. Er erhielt lediglich am 10. und am 12. Oktober jeweils eine Anweisung vom neuen Befehlshaber der Westfront Armeegeneral G.K. Schukow mit dem Auftrag, nach Osten durchzubrechen. Diese Funksprüche blieben jedoch unbeantwortet. In den ersten Tagen richteten sich die Ausbruchsversuche gegen das vor Wjasma stehende XXXX. und XXXXVI. AK (mot.). Als dies keinen Erfolg hatte, verlegte Gen.Lt. Lukin die Angriffe in das unübersichtlichere Gelände im Süden, wo der schwerste Angriff in der Nacht vom 10./11. Oktober gegen die deutsche 11. Panzer-Division stattfand. Dabei gelang es mindestens zwei Divisionen, aus der Einkreisung auszubrechen. Ab dem 12. Oktober klangen diese Ausbruchsversuche ab und in den folgenden Tagen gelang es nur kleineren Gruppen, sich zu den sowjetischen Linien durchzuschlagen. Am 14. Oktober, noch vor dem „Ausräumen“ des Kessels, meldete allein die Panzergruppe 4 in ihrem Bereich 140.000 Gefangene sowie 154 Panzer und 933 Geschütze, die erbeutet oder zerstört werden konnten. Gen.Lt. Lukin liess die Geschütze und Fahrzeuge in den folgenden Tagen sprengen, bevor die Masse seiner Truppen bis zum 20. Oktober 1941 in deutsche Gefangenschaft ging.
Reorganisation der sowjetischen Verteidigung
Am 6. Oktober traf sich die Staatliche Verteidigungskommission (GKO) zu einer Krisensitzung angesichts der sich abzeichnenden Zerschlagung von drei Fronten und der Bedrohung der Hauptstadt. Die Kommission bestimmte die zumindest teilweise ausgebaute Stellung bei Moschaisk zur neuen Verteidigungslinie und wies die Stawka an, diese schnellstens in Verteidigungszustand zu bringen. Zunächst wurden vier Schützendivisionen der Westfront dorthin befohlen, um eine notdürftige Verteidigung zu organisieren. Gleichzeitig wurden alle zurückgehenden Verbände und alle greifbaren Reserven in diese Stellung geworfen. Am 10. Oktober hatten sich dort neben den vier Schützendivisionen noch drei Schützenregimenter, fünf MG-Bataillone und die Jahrgänge verschiedener Militärschulen versammelt. Weitere neu aufgestellte fünf MG-Bataillone, fünf Panzer-Brigaden und zehn Panzerabwehrregimenter (welche jeweils nur Bataillonsstärke hatten) befanden sich im Anmarsch. Bis Mitte Oktober sammelten sich bei Moschaisk 11 Schützendivisionen, 16 Panzerbrigaden, 40 Artillerie-Regimenter, alles in allem etwa 90.000 Mann. Nach und nach trafen auch weitere Verstärkungen von anderen Frontabschnitten sowie sibirische Schützendivisionen im Raum Moskau ein. Aus diesen Verbänden organisierte die Stawka zwei neue Armeen. Im Raum Wolokolamsk entstand erneut eine 16. Armee unter Gen.Lt. Rokossowski und bei Moschaisk übernahm Gen.Maj. D. D. Leljuschenko den Befehl über die 5. Armee. Nach einer Verwundung Leljuschenkos wurde jedoch am 18. Oktober Gen.Maj. L.A. Goworow Befehlshaber der Armee. Die bei Mzensk stehenden Truppen des 1. Gardeschützenkorps bildeten den Grundstock für die Aufstellung der 26. Armee unter General A. W. Kurkin. In die neue Verteidigungslinie konnten sich bei Naro-Fominsk auch Teile der 33. Armee (Gen.Lt. M. G. Jefremow) und bei Malojaroslawez Teile der 43. Armee (Gen. Golubew), bei Kaluga Teile der 49. Armee (Gen. I. G. Sacharkin) zurückziehen. Nach ihrem Ausbruch konnten auch die Reste der 3., 13. und 50. Armee (nach Petrows Tod kommandiert von Gen.Maj. Ermakow) der Brjansker Front wieder in die Frontlinie integriert werden.
In einem zweiten Schritt versuchte das GKO die Ordnung in dem Chaos der militärischen Führung zu schaffen. Zunächst wurden die bei Moschaisk gesammelten Truppen am 9. Oktober als Front der Moschaisker Verteidigungslinie unter Gen.Lt. P.A. Artemjew (Chef des Moskauer Verteidigungsbezirkes) zusammengefasst. Gleichzeitig ging eine Kommission des GKO, bestehend aus Molotow, Mikojan, Malenkow, Woroschilow und Wassilewski, an die Front, um dort im Sinne des Hauptquartiers tätig zu werden. Unabhängig davon berief Stalin auch den ehemaligen Generalstabschef und bisherigen Befehlshaber der Leningrader Front, Armeegeneral G.K. Schukow, nach Moskau, um die kritischen Frontbereiche für ihn zu besichtigen und zu beurteilen. Diese Vertreter fanden an der Front ein Chaos vor. So wusste niemand im Stab der Reservefront zu sagen, wo sich ihr Befehlshaber aufhielt. In Medyn, einer Zufahrtsmöglichkeit zu Moskau, war bis auf drei Soldaten keine Verteidigung organisiert. Die drei Fronten hatten keinerlei Kontakt untereinander und oft hatten sie auch die Verbindung zu ihren Armeen verloren. Die Stawka reagierte, indem sie die oberste Führung reorganisierte. Am 9. Oktober übernahm Armeegeneral Schukow die Führung der Westfront. Dieser wurde am folgenden Tag auch die Truppen der Reservefront und am 12. Oktober die Verbände der Front der Moschaisker Verteidigungslinie unterstellt. Damit befanden sich die Verteidigungstruppen unter einem einheitlichen Kommando. Am 17. Oktober erfolgte insofern noch eine Änderung, als die sowjetische 22., 29. und 30. Armee im Raum Kalinin zu einer neuen Kalininer Front zusammengefasst und Generaloberst Konew unterstellt wurden, um die Führung in diesem Sektor zu vereinheitlichen.
Da seine Truppen zahlenmässig schwach und angeschlagen waren, versuchte Armeegeneral Schukow, die Front mit allen Mitteln zu stabilisieren. In seinem Befehl Nr. 0345 vom 13. Oktober 1941 forderte er vollsten Einsatz von allen Soldaten und kündigte an: „Feiglinge und Panikmacher, die das Schlachtfeld verlassen, die ohne Genehmigung die eingenommenen Stellungen im Stich lassen, die ihre Waffen und Geräte wegwerfen, sind auf der Stelle zu erschiessen“. Um den Verlust an Kraftfahrzeugen auszugleichen, liess er zudem alle greifbaren Fahrzeuge im Raum Moskau requirieren. Die einsetzende Schlammperiode begünstigte zudem die sowjetische Verteidigung. Schukow erkannte schnell, dass die Wehrmachtverbände nur noch auf den festen Strassen vorgehen konnten. Er konzentrierte die wenigen verfügbaren Verbände deshalb auf die wenigen festen Zufahrtsstrassen nach Moskau bei Wolokolamsk, Istra, Moschaisk, Malojaroslawez, Podolsk und Kaluga. Ebenso verfuhren die stark dezimierten Verbände der Brjansker Front, die schwerpunktmässig die Strasse Orjol-Tula verteidigten. Gleichzeitig befahl der Befehlshaber der Rückwärtigen Dienste der Roten Armee, General A.W. Chrulew, Nachschubverbände mit Panjewagen aufzustellen, da der Schlamm auch den sowjetischen Nachschub zum Erliegen brachte und Versorgungsflugzeuge nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung standen. Diese Massnahme half, die Versorgungskrisen auf sowjetischer Seite zu überwinden.
Deutsche Verfolgungsoperationen
Noch während der Kämpfe um die Kessel gingen die deutschen Truppen dazu über, die Lücken auszunutzen, die sie in die sowjetischen Linien geschlagen hatten. Dies entsprach den Planungen des OKH und des Oberbefehlshabers der Heeresgruppe Mitte. So hatte Gfm. von Bock der Panzergruppe 2 gleich nach der Einnahme Orjols am 4. Oktober den Befehl „sich in den Besitz von Mzensk … zu setzen“ und nach Möglichkeit in Richtung Tula vorzugehen. Die Stawka hatte derweil jedoch Massnahmen getroffen, um einen deutschen Durchbruch über Tula in Richtung Moskau zu verhindern. Im Lufttransport verlegte sie 5.500 Soldaten nach Mzensk. Auch andere Reserven trafen dort ein. Als um Mzensk schliesslich die 5. und 6. Garde-Schützendivision, die 4. und 11. Panzerbrigade, das 5. Luftlandekorps, das 36. Kradschützen-Regiment und ein Arbeiterregiment aus Tula versammelt waren, fasste man diese Verbände als 1. Gardeschützenkorps unter dem Befehl von Gen.Lt. D.D. Leljuschenko (der wenige Tage später die 5. Armee übernahm) zusammen. Als die 4. Panzer-Division am 6. Oktober vor Mzensk eintraf, geriet sie in einen Hinterhalt der 4. Panzerbrigade (Oberst Michail Katukow), die mit überlegenen T-34 ausgerüstet war. Die 4. Panzer-Division erlitt schwere Verluste und musste zurückweichen. Erst am 12. Oktober konnte sie Mzensk endlich einnehmen, ohne jedoch weiter vorgehen zu können. Auch die Kesselkämpfe selbst hielten den deutschen Vormarsch auf. Laut einem Heeresgruppen-Befehl vom 4. Oktober sollten die Kessel lediglich von einem Teil der Panzergruppe 2 ausgeräumt werden, doch schon bald zeigte sich, dass dazu auch die 2. Armee nötig war. Die Ausbruchsversuche der Brjansker Front verhinderten auch in den folgenden Tagen zunächst eine Verstärkung der deutschen Verfolgungskräfte.
Bei Wjasma kam es darauf an, die Panzergruppen 3 und 4, welche den Kessel am 7. Oktober geschlossen hatten, durch die infanteristischen Kräfte der 4. und 9. Armee abzulösen und diese somit für einen weiteren Vorstoss in Richtung Moskau freizumachen. Doch diese Armeen kamen aufgrund von zähem sowjetischen Widerstand nur langsam vorwärts. Nach dem Abschluss des Kessels waren OKH und das Oberkommando der Heeresgruppe Mitte der Ansicht, dass der Gegner keine wesentlichen Kräfte mehr zur Verteidigung Moskaus hätte. Am 7. Oktober trafen sich Generaloberst Halder und Gfm. von Bock im Hauptquartier der Heeresgruppe. Man beschloss umgehend, die Gunst der Stunde auszunutzen. Gfm. von Bock war der Überzeugung, stark genug zu sein, um die Kessel auszuräumen und zugleich nach Moskau vorzustossen. Nur über die Richtung der Verfolgung herrschte Unstimmigkeit. Im OKH war man der Überzeugung, dass der Gegner so schwach sei, dass es ausreiche ihn nur mit einem Teil der Kräfte in Richtung Moskau zu verfolgen. Hitler verlangte die Eroberung von Kursk durch die 2. Panzerarmee. Ausserdem sollten die Panzergruppe 3 und Teile der 9. Armee nach Norden abgezweigt werden, um dort in Kooperation mit der Heeresgruppe Nord die sowjetischen Kräfte im Raum Ostaschkow zu zerschlagen. Gfm. von Bock stimmte dieser Zersplitterung seiner Kräfte nicht zu, doch am folgenden Tag legte ein Führerbefehl das Abdrehen der Panzergruppe 3 fest, sobald dies die Kesselkämpfe zuliessen. Das XXXXI. AK (mot.) trat deshalb kurze Zeit später zum Angriff auf Kalinin an. Die Panzergruppe 4 blieb mit ihren XXXVI. und XXXX. AK (mot.) bis Mitte Oktober an der Front des Kessels von Wjasma gebunden. So standen letztlich nur noch das LVII. AK (mot.) (19. und 20. Pz.Div. 3. Inf.Div. (mot.)) sowie das XII. und XIII. AK für die Verfolgung nach Moskau zur Verfügung.
Am 11. Oktober konnten die deutschen Verfolgungskräfte zunächst Medyn und am folgenden Tag Kaluga einnehmen, womit sie bereits in die Verteidigungslinie von Moschaisk eingebrochen waren. Diese Erfolge konnten sie ausnutzen, um auch Tarussa einzunehmen und Malojaroslawez zu umgehen. Danach kam es im Raum Borowsk zu schweren Kämpfen zwischen dem LVII. AK (mot.) und der sowjetischen 110. Schützendivision und 151. Schützenbrigade (mot.), die bis zum 16. Oktober andauerten. Die Deutschen sollen allein dabei 20 Panzer verloren haben, bevor die Sowjets auf Naro-Fominsk ausweichen mussten. Nachdem auch Malojaroslawez gefallen war, musste die sowjetische 43. Armee am 18. Oktober hinter die Nara zurückgehen. Nördlich davon fiel nach sechstägigem Kampf und dem Verlust von angeblich 60 Panzern Moschaisk selbst an die deutschen Truppen.
Obwohl am 14. Oktober auch Kalinin gefallen war, kamen die deutschen Kräfte kaum mehr gegen den sich versteifenden Widerstand der sowjetischen Verbände an, da auf deutscher Seite, aufgrund der andauernden Kesselkämpfe noch nicht genügend Verfolgungskräfte freigemacht werden konnten. Diese konnten mit Masse erst ab dem 15. Oktober zur Verfolgung antreten. Doch bis dahin hatten vor allem die gepanzerten Verbände empfindliche Verluste erlitten. Die 6. Pz.Div. verfügte nur noch über 60 Panzer, die 20. Pz.Div. hatte 43 ihrer 283 Panzer verloren. Die 4. Pz.Div. verfügte nach dem verlustreichen Kämpfen gegen das 1. Gardeschützenkorps vor Mzensk nur noch über 38 Panzer. Die Heeresgruppe Mitte hatte in der Zeit vom Beginn der Operationen bis zum 17. Oktober 47.430 Soldaten und 1.791 Offiziere verloren. Die geschwächten Verbände stiessen in ihrer Verfolgung zudem auf einen motivierten Gegner in ausgebauten Stellungen. Nicht wenige Einheiten berichteten von den „härtesten Kämpfen seit Beginn des Ostfeldzuges“ (Kriegstagebuch des LVII. AK (mot.)). Bald sollten auch die schlechten Witterungsbedingungen die deutschen Operationen behindern.
Festlaufen der Offensive
Ab Mitte Oktober kam die 2. Panzerarmee nicht mehr voran und auch die Verfolgungs-Verbände der 2. Armee lagen fest. Die Panzerarmee meldete am 12. Oktober, dass ihre motorisierten Verbände nur noch 1 km in der Stunde vorankämen. Eine geordnete Versorgung war bald nicht mehr möglich. Dieser Zustand, so bemerkte das Hauptquartier der 2. Armee am 18. Oktober, würde solange andauern „solange nicht die Versorgung neu aufgebaut“ würde. Auch die 4. Armee kam nicht weiter voran, da sie selbst von ständigen sowjetischen Gegenangriffen bedrängt wurde. Sie stellte das Vorgehen ihres rechten Flügels am 16. Oktober ein. Im Bereich der 9. Armee und Panzergruppe 3 waren die Verbände auf die Autobahn Wjasma-Moskau angewiesen, doch gerade diese Route war durch zahlreiche Sprengungen, Bombenschäden und Überbelegung stark beschädigt. Schliesslich musste am 19. Oktober die gesamte 5. Infanterie-Division zu Reparaturarbeiten an der Autobahn herangezogen werden. Zusätzlich wurde die Panzergruppe 3 durch Gegenangriffe der Kalininer Front auch in die Verteidigung gezwungen. Auch die Verbände der Luftflotte 2 waren aufgrund der schlechten Witterung immer weniger in der Lage, in die Kämpfe einzugreifen. Gfm. von Bock notierte, nachdem am 19./20. Oktober praktisch alle Angriffsbewegungen hatten eingestellt werden müssen, am 25. Oktober in sein Tagebuch:
Text

„Das Auseinanderreissen der Heeresgruppe in Verbindung mit dem fürchterlichen Wetter hat dahin geführt, dass wir festsitzen. Dadurch gewinnt der Russe Zeit, seine zerschlagenen Divisionen aufzufüllen und die Verteidigung zu stärken […] Das ist sehr schlimm“.
Die einzigen Geländegewinne konnten noch im Bereich der Brjansker Front erzielt werden, und dies nur, weil deren rechte Flanke durch die deutschen Erfolge gegen die Westfront nicht mehr gedeckt war. Um die fast 60 km breite Lücke zu schliessen, befahl die Stawka deshalb am 24. Oktober, die Armeen der Brjansker Front in die Linie Dubna-Plawsk-Werchowje-Liwny-Kastornoje zurückzunehmen. Dieser Rückzug begann am 26. Oktober und war vier Tage später weitgehend abgeschlossen. Als die 2. Panzerarmee die Verfolgung aufnahm und ab dem 29. Oktober versuchte, die Stadt Tula einzunehmen, traf sie dort auf starken sowjetischen Widerstand der 50. Armee. Daraus entwickelten sich noch einige Kämpfe, vor allem in der Flanke der Panzerarmee, die noch bis zum 7. November andauerten, aber ergebnislos verliefen.
Angesichts der aussichtslosen Lage gab Gfm. von Bock am 1. November 1941 den Befehl, „dass vorläufig im Grossen nicht weiter vorgegangen wird, dass aber alles für den Angriff vorbereitet wird und Versorgungsschwierigkeiten so schnell als möglich behoben werden, damit bei Einsetzen guter Witterung (Frost) sofort angetreten werden kann“. Damit hatte das deutsche „Unternehmen Taifun“ praktisch ein Ende gefunden.
Folgen der Schlacht
Obwohl sowohl Hitler und der Wehrmachtführungsstab als auch der Generalstab des OKH nach den ersten Erfolgen im „Unternehmen Taifun“ in eine optimistische Stimmung verfielen und bereits Pläne für weitere Operationen mit weitgesteckten Zielen über Moskau hinaus entwarfen, hatte sich die Offensive Ende Oktober 1941 festgelaufen. Auch hatte Hitler schon am 12. Oktober Befehle zur Behandlung Moskaus erlassen, das eingeschlossen und dann beschossen werden sollte und dessen Kapitulation, auch wenn angeboten, nicht angenommen werden durfte. Stattdessen war der deutsche Vormarsch etwa 80 km vor der sowjetischen Hauptstadt zum Stehen gekommen. Es war weder gelungen, das primäre Ziel, die Vernichtung der Masse der gegnerischen Streitkräfte, noch das sekundäre Ziel der Einnahme Moskaus zu erreichen.
Jedoch hatte die Rote Armee grosse Verluste erlitten. Da genaue sowjetische Angaben fehlen, ist man auf deutsche Quellen wie den Wehrmachtbericht angewiesen, der nach Abschluss der Kämpfe um die Kessel die Vernichtung von 67 sowjetischen Schützen-, 6 Kavallerie- und 7 Panzerdivisionen mit 1.242 Panzern und 5.412 Geschützen sowie die Gefangennahme von 663.000 Rotarmisten meldete. Da nach sowjetischen Angaben Mitte Oktober zum Schutz Moskaus weniger als 100.000 Soldaten zur Verfügung standen, ist diese Darstellung plausibel.
In Moskau selbst führten die Ereignisse zu einer Krise. Am 13. Oktober erklärte der Vorsitzende des Moskauer Stadtkomitees, A.S. Schtscherbakow, öffentlich, dass die Hauptstadt bedroht sei. Im Zuge dessen wurden Tausende Moskauer zum Ausbau der Verteidigungsanlagen um die Stadt herangezogen und 25 Arbeiter-Bataillone aus 12.000 Freiwilligen aufgestellt, die diese Stellungen ab dem 17. Oktober besetzten. Dennoch entschloss sich Stalin am 16. Oktober zur Evakuierung der Stadt, sodass die meisten Organisationen der Regierung, der Partei und des Militärs anfingen nach Kuibyschew überzusiedeln. Auch Industrie-betriebe wurden evakuiert. Daraufhin brach in der Hauptstadt eine Panik aus, die auch dadurch nicht gebremst wurde, dass Stalin sich entschloss, in Moskau zu bleiben. Viele Einwohner flüchteten und es kam zu Plünderungen der rar gewordenen Lebensmittel. Deshalb wurde am 19. Oktober der Belagerungszustand erklärt und das Kriegsrecht verhängt.
In den ersten beiden November-Wochen, die von einem weitgehenden Stillstand der Operationen gekennzeichnet waren, füllten beide Seiten ihre geschwächten Verbände auf. Keiner Seite gelang es dabei, ihre vorangegangenen Verluste völlig zu ersetzen, vor allem nicht der Wehrmacht mit ihren sehr lang gewordenen Nachschubwegen. Während sich eine Reihe von deutschen Frontkommandeuren dafür aussprach, nunmehr zur Verteidigung überzugehen und eine günstige Stellung für die Wintermonate zu wählen, war man im OKH der Ansicht, dass es nur noch eines letzten „Kraftaktes“ bedürfe, um das Ziel des Feldzuges gegen die Sowjetunion doch noch zu erreichen. Nach dem Eintritt der Frostperiode, in der die Wege besser befahrbar wurden, traf man während einer Besprechung der höchsten militärischen Befehlshaber in Orscha am 13. November die Entscheidung, den Angriff zu erneuern. Am 17. November 1941 begann daraufhin mit der neuerlichen deutschen Offensive die Schlacht um Moskau. Auch in diesem Anlauf sollte der Wehrmacht kein durchschlagender Erfolg gelingen. Am 5. Dezember ging die Rote Armee mit ihren Reserven zur Gegenoffensive über und konnte bis zum Frühjahr 1942 grosse Teile des im Herbst verlorenen Geländes zurückgewinnen.
Bewertung und Rezeption
Gemessen an der Höhe der Verluste, waren die Kesselschlachten bei Wjasma und Brjansk eine der grössten militärischen Niederlagen der Sowjetunion während des Zweiten Weltkrieges. Sie wird in der russischen Historiographie fast immer mit zur „Schlacht um Moskau“ (Битва за Москву) gerechnet, die schliesslich mit einem sowjetischen Erfolg endete. Dabei wurde gelegentlich versucht, die Ursachen für diesen ersten Rückschlag zu finden. Neben der Betonung der zahlenmässigen Überlegenheit der Wehrmachtverbände wiesen einige Kommandeure, wie zum Beispiel I.S. Konew oder K.K. Rokossowski in ihren Memoiren darauf hin, dass es seitens des Oberkommandos in Moskau zu schweren Versäumnissen gekommen war. Marschall Wassilewski kritisierte vor allem die verworrene Befehlsstruktur

„Der Misserfolg bei Wjasma ist nicht nur aus der gegnerischen Überlegenheit und dem Mangel an Reserven zu erklären, sondern auch daraus, dass der Generalstab und das Hauptquartier die Hauptstossrichtung des Gegners falsch bestimmt und demzufolge auch die Verteidigung falsch aufgebaut hatte. […] Der operative Aufbau war für die Truppenführung und das Zusammenwirken der Fronten denkbar ungünstig“.
In der offiziellen sowjetischen Darstellung des Krieges wurde darauf nicht eingegangen und behauptet, dass die Stawka oder das Staatliche Verteidigungskomitee zu spät von den deutschen Plänen erfahren und deshalb nichts mehr hätte unternehmen können. Dennoch hielt der Historiker Joachim Hoffmann 1983 zusammenfassend fest: „Die Fehler und Unterlassungen der sowjetischen Führung sind auf jeden Fall ein wesentlicher Grund dafür, warum die Heeresgruppe Mitte die Verteidigung an den entscheidenden Punkten relativ rasch zu durchbrechen vermochte“.
In den ersten sowjetischen Publikationen nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Einkesselung und Vernichtung eines grossen Teiles der Roten Armee teilweise überhaupt nicht erwähnt. Später hingegen erfuhr vor allem der Widerstand der sowjetischen Verbände im Kessel von Wjasma eine Heroisierung. Sowohl in der offiziellen Darstellung als auch in den Memoiren Schukows oder Wassilewskis fand man die Aussage, dass das Opfer der fünf eingekesselten Armeen notwendig für die Rettung der Hauptstadt gewesen sei. Dass die oberste deutsche Militärführung tatsächlich einen Grossteil der vorhandenen Kräfte (Teile der Pz.Gr. 3 und der 9. Armee) nach Norden gegen Kalinin lenkte, anstatt mit diesen auf das genauso weit entfernte Moskau vorzustossen, blieb unerwähnt. Auch die spätere sowjetische Geschichtsschreibung betonte, dass durch den Widerstand der eingeschlossenen Truppen schliesslich deutsche Divisionen für etwa zwei Wochen gebunden und damit vom Durchbruch auf Moskau abgehalten worden wären:

„Doch die Kampfhandlungen der eingekreisten Truppen machten den Einsatz von 28 Divisionen des Gegners erforderlich, wodurch Zeit für die Organisation der Verteidigung auf der Linie Moschaisk gewonnen wurde. Die Kämpfe bei Wjasma banden die Hauptkräfte der Panzergruppen und Armeen von Bocks in jener kritischen Zeit, als dessen einzelne Korps und Divisionen in die bei Moskau entstandenen Breschen vorstiessen und als der Aggressor für eine kurze Zeit keine geschlossene Verteidigung vor sich hatte“. – A.M. Samsonow (Historiker).
Auf deutscher Seite kam es bei der späteren Darstellung der Operationen zu zahlreichen „Ungenauigkeiten“. So behaupteten einige Kommandeure, wie zum Beispiel Heinz Guderian, fälschlicherweise, dass die eingekreiste 50. Armee bereits am 17. Oktober kapituliert habe und der Kessel bei Brjansk bis zum 20. Oktober ausgeräumt worden sei. Den erfolgreichen Ausbruch von Teilen der 3., 13. und 50. sowjetischen Armee aus dem Kessel liess er unerwähnt. In anderen Darstellungen wurde die Kapitulation des Kessels von Wjasma auf den 13. Oktober datiert. Tatsächlich endeten mit dem 12.10. zwar die grossen Ausbruchsversuche, die letzten eingeschlossenen Truppen kapitulierten aber erst sieben Tage später, was in der Zwischenzeit bedeutende deutsche Kräfte band. Die neuere Forschung hat versucht, diese Fehler zu korrigieren, aber dennoch finden sich in zahlreichen Publikationen die übernommenen falschen Daten.
In der Memoirenliteratur der Nachkriegsjahre rief vor allem die Entscheidung Hitlers und des OKH, die Panzergruppe 3 und grosse Teile der 9. Armee auf Kalinin abzudrehen, grosse Kritik hervor. So schrieb zum Beispiel Walter Chales de Beaulieu, ehemals Generalstabschef der Panzergruppe 4, nach dem Krieg:
„Das XXXXI. Korps dieser Panzergruppe war mit seinen schnellen Divisionen am Wjasma-Einschliessungsring nicht beteiligt, stand ab dem 8.10. für weiteres Vorgehen nach Osten, auf Moskau, nördlich der Autobahn bequem zur Verfügung, hätte, verstärkt durch die SS-Division „Reich“, an diesem besonders geeignetem Operationsstrang – Entfernung Wjasma, Moskau nur 200 km! – weiter vorstossen können und zum damaligen Zeitpunkt kaum unüberwindlichen Widerstand angetroffen. Bedenkt man, dass dieses Korps – nach Norden angesetzt – am 13. Oktober bereits Kalinin erreichte, das auch nur 200 km von Wjasma entfernt liegt, wohin jedoch wesentlich ungünstigere Wege führen, so kann man sich berechtigte Aussichten auch für einen Erfolg vor Moskau ausmalen“.
Zudem ist in der deutschen Geschichtsschreibung oft die These zu finden, dass der ungewöhnlich frühe Witterungsumschwung die deutschen Truppen überrascht hätte und dieser Umstand zu einem Scheitern der Operation geführt habe. Tatsächlich glaubte die deutsche Führung die Rasputiza, mit der sie für Mitte Oktober rechnete, ignorieren zu können, da die Operationen dann abgeschlossen sein sollten. Fachleute von der meteorologischen Abteilung wurden nicht in die Planungen einbezogen. Allerdings blieben die Niederschläge des Oktobers unter den Durchschnittswerten, sodass der Herbst 1941 verhältnismässig trocken war. Zudem setzte der Frost sogar früher ein als sonst, was die Schlammperiode noch einmal verkürzte. Angesichts der Tatsache, dass die Schlammperiode 1941 also kürzer und trockener war als gewöhnlich, kann die These vom überraschenden Witterungsumschwung als ein Versuch „die Schuld des eigenen Versagens einer höheren Gewalt zuzuschreiben“ angesehen werden.
Schlacht um Moskau (02.10.1941 – 31.01.1941)
Die Schlacht um Moskau war eine Schlacht an der deutsch-sowjetischen Front im Zweiten Weltkrieg. Sie begann am 2. Oktober 1941 mit der Wiederaufnahme der Offensive der Heeresgruppe Mitte gegen die West-, Reserve- und Brjansker Front. Das Ziel der Operation war die Ausnutzung der durch die Doppelschlacht bei Wjasma und Brjansk geschaffenen günstigen Bedingungen zur Einnahme der sowjetischen Hauptstadt Moskau. Nachdem der Vorstoss in der Doppelschlacht bis zum 30. Oktober 1941 aufgrund des herbstlichen Schlamms und des verstärkten sowjetischen Widerstands ins Stocken geraten war, konnte die Offensive rund zwei Wochen später fortgesetzt werden. Die zweite Offensive scheiterte jedoch, nachdem am 5. Dezember 1941 die Rote Armee eine grossangelegte Gegenoffensive unternahm, die zu einem Rückzugsbefehl von Hitler am 15. Januar 1942 führte.
In der Moskauer Angriffsoperation (5. Dezember 1941 bis 7. Januar 1942) stiess die Rote Armee auf einer etwa 1000 km breiten Front bis zu 250 km nach Westen vor. Das eigentliche Ziel, die Vernichtung der Heeresgruppe Mitte, wurde nicht erreicht.
Hintergrund
Bisheriger Verlauf des Krieges
Im Verlauf des Krieges gegen die Sowjetunion waren die drei Heeresgruppen der deutschen Wehrmacht sowie die Streitkräfte der mit dem Deutschen Reich verbündeten Staaten seit dem 22. Juni 1941 weit auf sowjetisches Territorium vorgedrungen. In der Kesselschlacht bei Smolensk war eine erste sowjetische Verteidigungsstellung vor Moskau durchstossen worden. Hitler verhinderte jedoch einen sofortigen Vorstoss auf Moskau, indem er am Freitag, 28. Juli die Panzergruppe 3 unter Generaloberst Hermann Hoth nach Norden und die Panzergruppe 2 unter Generaloberst Heinz Guderian mit der 2. Armee unter dem Kommando von Generaloberst Maximilian von Weichs nach Süden abdrehen liess, da seiner Meinung nach der Eroberung der wirtschaftlich wichtigen Gebiete der Ukraine und der Eroberung Leningrads eine höhere Priorität zukam. Die Panzergruppe 4 nahm am Vormarsch auf Leningrad teil, während sich die Panzergruppe 2 und die 2. Armee an der Schlacht um Kiew beteiligten.
Meinungsverschiedenheiten im Vorfeld der Offensive
Nach Hitlers Plänen sollten vor der Eroberung Moskaus die sowjetische militärische Verteidigungskraft weitgehend ausgeschaltet und gleichzeitig die wirtschaftlich wichtigsten Gebiete im Norden und Süden Russlands sowie der Ukraine in Besitz genommen werden. Ausserdem wünschte Hitler die Einnahme der Krim, um die Bedrohung der rumänischen Erdölfelder durch Luftangriffe der Roten Luftflotte auszuschliessen. Die deutsche Generalität sah im Gegensatz dazu das vorrangige Ziel allein in der sofortigen Einnahme Moskaus. Moskau hatte nicht nur aus geographischer Sicht eine grosse Bedeutung, sondern auch als Verkehrs- und Nachrichtenzentrale, als politischer Mittelpunkt und als wichtiges Industriegebiet.
Deutsche Planungen
Nach der Weisung des Generalstabes des Heeres vom 18. August 1941 sollten zwei Flügel gebildet werden, um die sowjetische Hauptstadt nördlich und südlich zu umfassen und einzukesseln. Der südliche Flügel sollte über die Linien Brjansk-Roslawl und Kaluga-Medyn verlaufen, der nördliche Flügel sollte zwei Ansätze haben. Ersterer war aus dem Gebiet von Bjeloj und zweiter aus der Umgebung von Toropez geplant. Allgemein sollte über Rschew nach Osten angegriffen werden. Laut dieser Planung sollte der Mittelabschnitt hauptsächlich defensiv mit zehn Infanteriedivisionen bleiben. Nach der Meinung des Generalstabes des Heeres sollte die Entscheidung über die beiden offensiv ausgerichteten Flügel herbeigeführt werden. Das weitere Vorgehen nach einem erfolgreichen Durchbruch wurde von der Situation an der Front abhängig gemacht. In seiner Weisung vom 6. September 1941 gab Adolf Hitler den Befehl, die entscheidende Operation gegen die „vor der Heeresmitte in Angriffskämpfen festgelegte Heeresgruppe Timoschenko“ vorzubereiten.
Der Operationsbefehl Hitlers sah zunächst lediglich die Umfassung der „Heeresgruppe Timoschenko“ in „allgemeiner Richtung Wjasma“ durch starke Panzerverbände vor, die für diesen Zweck zusammengefasst wurden. Die Kräfte am Südflügel begrenzte Hitler auf die 2. und die 5. Panzer-Division, der Nordflügel sollte aus der 9. Armee inklusive Verbänden aus dem Bereich der Heeresgruppe Nord bestehen.
Der zweite Teil sah nach der Zerschlagung des Grossteils der Westfront in der „scharf zusammengehaltenen Vernichtungs-operation“ die Verfolgung der sowjetischen Truppen in Richtung Moskau vor. Als operative Begrenzungen sollten rechts die Oka und links die obere Wolga dienen. Gedeckt werden sollte der Angriff durch aus dem Raum Kiew freiwerdende Truppen der Heeresgruppe Süd im Süden und durch Vorstösse entlang beider Seiten des Ilmensees im Norden.
Am 10. September 1941 erging aufgrund von Hitlers Weisung vom Oberkommando des Heeres die „Weisung zur Fortführung der Operationen“. Der Generalstabschef des OKH Franz Halder verschaffte sich Freiraum, indem es ihm gelang, den Kampfauftrag bei augenscheinlich gleichen Formulierungen zu verändern. Damit ging Halder weit über seine Aufgaben hinaus und interpretierte die Weisung Hitlers zugunsten seiner Pläne, die mit denen des Oberbefehlshabers der Heeresgruppe Mitte, Generalfeldmarschall Fedor von Bock übereinstimmten.
Die Pläne Halders schränkten die von Hitler gesetzte eindeutige Priorität auf die Vernichtung der Westfront ein. Wörtlich notierte er:

„Erst nach sicherer Einschliessung und Gewährleistung einer Vernichtung der ostwärts Smolensk zwischen Strasse Roslawl, Moskau und Bjeloj umfassten Feindkräfte ist die Verfolgung in Richtung Moskau einzuleiten“.
Halders Plan sah Hitlers Weisung erweiternd einen vom Diktator ausgesparten Frontalangriff von schnellen Verbänden und Infanteriedivisionen direkt auf Moskau vor. Dabei präzisierte er die von Hitler angesprochenen freiwerdenden Kräfte aus dem Raum der Heeresgruppe Süd mit der 2. Armee unter Generaloberst Maximilian von Weichs und der Panzergruppe 2 unter dem Kommando von Generaloberst Heinz Guderian. Diese beiden Verbände sollten den Angriff am rechten Flügel aller Voraussicht nach gegen Orjol aus dem Raum Romny Richtung Nordosten führen, um die sowjetischen Truppen vor der neu aufgestellten 2. Armee aus dem Süden aufzurollen.
Weitere grosse Unterschiede zur ursprünglichen Planung waren die Herausnahme des Grossteils der 2. Armee aus dem Einkesselungsansatz östlich von Kiew und die wahrscheinlich werdende Bildung einer dritten Gruppe, die direkt gegen die sowjetische Hauptstadt vorstossen sollte und unabhängig von den Operationen rund um Wjasma war. Aus diesem Grund war Halder auch sehr daran interessiert, die von Hitler in seiner Weisung erwähnten freiwerdenden Kräfte aus dem Raum der Heeresgruppe Süd innerhalb eines möglichst kurzen Zeitraums in maximaler Zahl aus der Kiewer Operation freizumachen. Die 6. Armee, welche direkt neben der 2. Armee stand, bezog der Generalstabschef des Heeres nicht in seine Planungen mit ein. Die Panzergruppe 1 unter dem Kommando von Generaloberst Ewald von Kleist sollte mit dem Schwerpunkt gegen die Linie Romny–Sula im Anschluss an die Panzergruppe 2 angreifen. Zum Schutz der Ostflanke sollte der Grossteil der 17. Armee in die Angriffsrichtung Charkow–Poltawa vorstossen. Entgegen Hitlers Weisung, die besagte, dass schnelle Kräfte „aus dem Raum der Heeresgruppe Süd“ (vermutlich der Panzergruppe 1) freigemacht werden sollten, beauftragte Halder die Panzergruppe 2 und die 2. Armee, den Angriff gestaffelt vorstossend zu decken. Dabei erliess der Generalstab des Heeres folgende Einschränkung:

„Auftrag für die 11. Armee zur Wegnahme der Krim bleibt unverändert. Soweit nach Lage möglich, ist durch Ansatz einzelner schneller – gegebenenfalls ungarischer und rumänischer – Verbände die Grundlage für ein frühzeitiges Vorgehen von Teilkräften gegen die Nordküste des Asowschen Meeres zu schaffen“.
Die Heeresgruppe Mitte begann währenddessen mit der Zusammenziehung der Verbände und der Generalstäbe, seit dem 19. September 1941 unter dem angeordneten Decknamen Unternehmen Taifun. Neben dem Vorstoss auf Moskau sollten die Truppen in Zusammenarbeit mit der Heeresgruppe Nord – wie bereits am 30. August von Halder befohlen – die Ausgangslage für den Angriff am nördlichen Flügel verbessern.
Probleme vor Beginn des Angriffs
Der Transport der Panzer zur Bildung der geplanten konzentrierten Schwerpunkte führte zu einer starken Belastung der gesamten Verkehrswege, da neben dem Transport von weit entfernt stehenden Verbänden der Panzergruppen 1 und 2 am Nordflügel die Verlegung der schnellen Truppen aus dem Bereich der Heeresgruppe Nord sowie der Nachschub aus der Heimat bewältigt werden musste. Dies führte zu Verzögerungen, die durch die ausserplanmässige längere Dauer der Operationen östlich von Kiew und den langsamer als erwarteten Vorstoss auf Leningrad verstärkt wurden. Im Fall der 8. Panzer-Division resultierte daraus die Aufhebung des Bereitstellungsbefehls für die Heeresgruppe Mitte.
Bereits während der Planungen bezog Halder die sich aufgrund der dauerhaften Einsätze ohne Auffüllungen weiter verringernde Stärke der Panzerdivisionen mit ein. Nach dem Stand des 4. September 1941 waren 30 % der Panzer komplett ausgefallen, darüber hinaus befanden sich 23 % in der Instandsetzung. Insgesamt verfügte die Hälfte der in die Operationsplanungen einbezogenen Panzerdivisionen über durchschnittlich rund 34 % ihrer Sollstärke an Panzern. Dieser Prozentsatz verbesserte sich auch nur unwesentlich durch die 125 neu zugeführten Exemplare. Als problematisch erwies sich auch die dauerbelastete hauptsächlich in der Heimat durchgeführte Reparatur der Panzer, von denen eine schwache Widerstandsfähigkeit zu erwarten war. Aufgrund dieser Tatsache ersuchte Halder das OKW um weitere 181 Panzer, die gemeinsam mit den bereits bei Orsa und Dünaburg stehenden neuen 125 Stück eine Auffrischung der am stärksten geschwächten Panzerdivisionen um 10 % ihres Bestandes bedeutet hätte. Insgesamt wirken die Zahlen eher geringfügig, wenn man die beiden noch laufenden Operationen und den Begriff „feldzugsentscheidende Schlacht“ in Relation dazu setzt.
Ein weiteres Problem war der akute Fehlbestand an Kraftfahrzeugen, der zum Beginn der Offensive auf mehr als 22 % geschätzt wurde. Bei den im Einsatz verbliebenen Fahrzeugen handelte es sich zum Grossteil um lediglich provisorisch instandgesetzte Typen, welche zum grössten Teil seit Juni ununterbrochen im Einsatz waren und bei denen mit einer hohen Ausfallquote zu rechnen war. Daraus hätte sich ergeben, dass die Beweglichkeit des Heeres aufgrund der Witterung, des Kampfes und den Strassenverhältnissen erheblich vermindert worden wäre, wobei dieses Problem nur durch eine sofortige Autorisation zur Neufertigung von Kraftfahrzeugen durch Hitler persönlich gelöst werden konnte. Berechnungen des Generalbevollmächtigten für das Kraftfahrwesen Generalmajor Adolf von Schell zufolge blieben dann genügend Kraftfahrzeuge zur Ausrüstung einer tropenfähigen Panzerdivision übrig. Nach seiner Meinung würde ein Liegenbleiben der Truppen „auf breiter Front im tiefen russischen Raum bei Einbruch des Winters“ wesentlich gravierendere Auswirkungen haben als die der Freigabe, wobei diese jedoch nie erfolgte.
Problematisch war auch die Versorgung mit Treibstoff, da die Vorräte der Versorgungsbasen der Heeresgruppen Mitte und Süd zum Grossteil verbraucht waren. Lediglich die Heeresgruppe Nord verfügte noch über Auslagerungen in ihrer Versorgungsbasis, da der Nachschub, von dem dort stärker ausgebauten und wieder instand gesetzten Schienennetz und der Versorgung über die Ostsee profitierte. Hauptsächlich aufgrund des Versorgungsnetzes auf Schienen war es lediglich der Heeresgruppe Nord und im begrenzten Ausmass der Heeresgruppe Mitte möglich, Vorräte anzulegen. Bei vier Verbrauchssätzen als Reserve benötigten die Vorbereitungen für den Angriff auf Moskau 27 Züge täglich, von denen das Oberkommando der Wehrmacht bis zum 16. September 22, ab dem 30. September 27 Stück zusagen konnte. Für den Zeitraum der Operationen im Oktober wurde ein Bedarf von 29 Zügen errechnet, wobei lediglich 20 zugesagt werden konnten. Im November lagen die Versprechungen des OKW bei drei Zügen täglich, da man von dem Abschluss der Operation und der Nutzung zur Ausstattung und Bevorratung für den Winter ausging. Die beim Rückzug der Roten Armee zerstörte Infrastruktur musste erst wieder aufgebaut werden, war aber auch dann eher unzulänglich. Es gab kaum befestigte Strassen und die Bahn konnte auch nicht einfach wiederaufgebaut werden.
Es war im Allgemeinen nicht möglich, die Verluste aus den bisherigen Schlachten zu kompensieren.
Endgültige Entscheidung zum Angriff auf Moskau
Nach einem Lagevortrag des Generalstabschefs des Heeres, Generaloberst Franz Halder, erliess Hitler am 12. August 1941 die Weisung Nr. 34, die besagte, dass „Moskau als Staats-, Rüstungs- und Verkehrszentrum dem Gegner noch vor Eintritt des Winters“ zu entziehen sei. Dies stellte für den Generalstabschef des Heeres jedoch nur einen Teilerfolg dar, da Hitler zwar die von Halder energisch vertretene Wichtigkeit Moskaus anerkannte. Er blieb jedoch unverändert der Meinung, dass die Reihenfolge der Angriffsoperationen durch die Zerschlagung der Feindverbände und die Eroberung von kriegswirtschaftlich wichtigen Gebieten bestimmt wurde. Hitler argumentierte auch gegen den Vorstoss auf Moskau, indem er die These seiner Generalität aufgriff, dass der Grossteil der Roten Armee vor der sowjetischen Hauptstadt konzentriert war und sie an den anderen Fronten so stark geschwächt war, dass nach seinem Verständnis diese geschwächten Frontabschnitte Priorität hatten.
Nach dem durch eine Studie des Diktators begründeten Entschluss vom 22. August 1941, der besagte, die Operationen gegen Moskau bis auf weiteres zu stoppen, bahnte sich der abschliessende Akt der Debatte über die feldzugsentscheidende „letzte Schlacht“ an. Nach der Auffassung Hitlers sollten alle westlich von Moskau stehenden Armeen vor der Fortsetzung des Angriffs endgültig geschlagen werden. Diese von Hitler bereits in der frühen Phase vertretene Denkweise stand in einem starken Kontrast zu dem strategischen Konzept der weiträumigen Umfassung von Halder, da ersteres dem Feind zwangsläufig die Initiative überliess.
In einer Hitler vorgelegten Denkschrift kam das OKW am 26. August 1941 zu der Feststellung, dass es unmöglich sei, den Feldzug im Osten in diesem Jahr noch zu beenden. Diese Darstellung fand schliesslich auch Hitlers Zustimmung. Nach dem sich abzeichnenden Fiasko der Roten Armee im Raume Kiew Anfang September änderte Hitler jedoch überraschend seine Meinung und er erteilte am 6. September 1941 mit der Führerweisung Nr. 35 den Befehl an die Heeresgruppe Mitte, die Vorbereitungen für einen Angriff auf Moskau bis Ende September abzuschliessen. Wörtlich heisst es:

„Die Anfangserfolge gegen die zwischen den inneren Flügeln der Heeresgruppen Süd und Mitte befindlichen Feindkräfte haben […] die Grundlage für eine entscheidungssuchende Operation gegen die vor der Heeresmitte stehende in Angriffskämpfen festgelegte Heeresgruppe Timoschenko geschaffen. Sie muss in der bis zum Einbruch des Winterwetters verfügbaren befristeten Zeit vernichtend geschlagen werden. Es gilt hierzu, alle Kräfte des Heeres und der Luftwaffe zusammenzufassen, die auf den Flügeln entbehrlich werden und zeitgerecht herangeführt werden können“.
Verteidigungsvorbereitungen in Moskau
Ende Juli 1941 nahm Moskau nach den ersten deutschen Luftangriffen langsam das Aussehen einer Frontstadt an. Die Schaufenster der Geschäfte wurden mit Sandsäcken oder Brettern verbarrikadiert, an denen zum Teil riesige Propagandaplakate hingen. Nachts herrschte strenge Verdunkelung und der Strassenverkehr wurde auf das Nötigste minimiert. Bei den Tarnungsanstrengungen vor der deutschen Luftwaffe wurden keine Mühen gescheut. Die Umrisse fast der gesamten Stadt wurden in Kleinstarbeit umgeändert. So sahen zum Beispiel der Swerdlow-Platz und das Bolschoi-Theater aus der Luft betrachtet wie eine Gruppe kleiner Häuser aus. Die Kreml-Mauern wurden mit Farbe zu Reihenwohnhäusern umstilisiert, die goldenen Kuppeln der Kirchen wurden grün angemalt. Auf allen grossen Strassen malte man Zickzack-Linien, die von oben wie Hausdächer aussahen. Alle grossen Plätze wurden mit Hausdächern bemalt und freie Flächen wie Sportstadien wurden mit Attrappen von Hausdächern aus Holz bedeckt. Sogar einige Schleifen der Moskwa wurden vollständig mit Holz überdeckt, um den deutschen Fliegern die Orientierung zu erschweren. In den Wäldern der Vorstädte wurden Hunderte von Flak-Scheinwerfern und schwere Flak-Batterien aufgestellt und an den Moskauer Ausfallstrassen stiegen Fesselballons empor, um Tiefflieger abzuhalten. Die Moskauer Luftverteidigung war stärker ausgebaut als die von Berlin und London gemeinsam.
Der Moskauer U-Bahn-Betrieb lief nur auf wenigen wichtigen Strecken planmässig weiter. Entlang der Schienen wurden Holzbretter aufgestellt und die unterirdischen Bahnhöfe und Bahnschächte zu einem riesigen Luftschutzkeller für die Moskauer Zivilbevölkerung umfunktioniert. Jeder Moskauer, der nicht irgendwie an der Luftverteidigung beteiligt war, musste in einen Keller gehen. Zuwiderhandlungen wurde durch Geldstrafen oder Haft geahndet. Beim ersten Nachtangriff der Deutschen, genau einen Monat nach Kriegsbeginn, flogen die deutschen Maschinen zum ersten und einzigen Mal in sehr geringer Höhe über Moskau. In der ersten Nacht kamen sie gewöhnlich in einer Höhe von 300 Metern. Danach änderten die Deutschen ihre Taktik und bombardierten Moskau aus grosser Höhe. Die Zahl der einfliegenden deutschen Bomber wurde jedoch von Angriff zu Angriff geringer. Waren es in der Nacht vom 21./22. Juli 1941 noch 127 Maschinen, die Moskau angriffen, so waren es bereits eine Nacht später 115, und in der Nacht zum 24. Juli dann 100 Maschinen. Bis zum Jahresende 1941 wurden in 59 von 76 Angriffen auf Moskau weniger als zehn deutsche Flugzeuge vom Typ He 111 und Ju 88 eingesetzt.
In Moskau bereitete man sich auf die Möglichkeit eines plötzlichen Zusammenbruchs der Front oder die Landung von Fallschirmtruppen vor. Dazu wurden sowjetische Jägerbataillone und Komsomolbrigaden in einzelnen Kasernen zusammengezogen. Das gesamte Verteidigungssystem, die sogenannte Moskauer Verteidigungszone, wurde dem Kommando des Moskauer Militärbezirks (Generalleutnant Pawel Artemjewitsch Artemjew) unterstellt, dem die Mobilisierung der Bevölkerung zu Schanz- und Befestigungsarbeiten sowie die Aufstellung und Bewaffnung von Arbeiterbataillonen unterlag. Artemjew war ausserdem für die Industrieproduktion, das Transportwesen, die Nachrichtenverbindungen und für die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung verantwortlich. So lagen die wichtigsten Lebensfunktionen der Hauptstadt in den Händen des Militärs, genauer gesagt des NKWD.
Vergleich der Streitkräfte
Die Gliederung der Roten Armee unterschied sich von der deutschen durch das Fehlen eines Korpsverbandes. Bei den Divisionsstärken entsprachen etwa 2 1/2 sowjetische Divisionen einer deutschen Division. Die Luftflotte war der Armee unterstellt und bildete keine eigene Waffengattung wie die deutsche Luftwaffe.
Die deutschen Streitkräfte
Die Heeresgruppe Mitte (GFM von Bock) wurde für den Angriff auf Moskau durch die Panzergruppe 4 (Hoepner) erheblich verstärkt, die von Leningrad zur Mittelfront abgezogen wurde. Insgesamt verfügten die Deutschen über 14 Panzerdivisionen, neun motorisierte Divisionen und 56 Infanteriedivisionen. Unterstützung aus der Luft kam von der Luftflotte 2 (Kesselring) und von Teilen der Luftflotte 4 (Löhr).
Insbesondere die motorisierten und gepanzerten Einheiten der Heeresgruppe Mitte waren wegen ihrer hohen Kilometerleistung auf ungeeigneten Strassen unter fast ständiger Feindeinwirkung stark in Mitleidenschaft gezogen und hätten dringend der Überholung und Auffrischung bedurft, was aus zeitlichen und organisatorischen Gründen nur unzureichend geschah.
Ausserdem stellten die von den deutschen Streitkräften gewonnenen Kesselschlachten zwar für sich gesehen taktische Erfolge dar, jedoch verschafften sie den sowjetischen Streitkräften Zeit für Verteidigungsvorbereitungen an wichtigen Abschnitten. Die deutschen Truppen hingegen wurden schwächer, die Flugzeuge, Panzer und Fahrzeuge verschlissen, die begrenzten Ressourcen an Treibstoff und Munition wurden aufgebraucht. Ersatz konnte nur notdürftig gestellt werden. Völlig fehlte es an warmer Kleidung für die Soldaten, obwohl der russische Winter in einigen Wochen beginnen würde.
Die Verluste der Wehrmacht im Deutsch-Sowjetischen Krieg vom 22. Juni bis 26. September 1941 beliefen sich auf 534.086 Tote, Verwundete und Vermisste, also rund 15 % der Anfangsstärke.
Die sowjetischen Streitkräfte
Die Rote Armee konnte die Front vor Moskau, die östlich Smolensk etwa 300 km westlich der Hauptstadt verlief, im Verlauf des Sommers sichern und ausbauen. In einigen Abschnitten führte die Rote Armee heftige Gegenangriffe durch. So musste Anfang September 1941 die Heeresgruppe Mitte einen Frontvorsprung bei Jelnja, etwa 70 km südöstlich von Smolensk, unter dem Druck der Roten Armee räumen. Dabei handelte es sich um den ersten operativen Rückzug deutscher Truppen im Zweiten Weltkrieg überhaupt.
Im Norden und Süden der Rollbahn Smolensk–Moskau standen acht sowjetische Armeen der Westfront unter Oberbefehl Marschall Timoschenkos und mit Hauptquartier in Wjasma. Ausserdem entstand die fast 300 km lange Moschaisk-Verteidigungslinie von Kalinin im Norden über Wolokolamsk, Borodino und Moschaisk bis südlich von Kaluga im rückwärtigen Gebiet rund 100 km vor Moskau. Diese Verteidigungsstellung bestand aus drei Hauptlinien mit Fallgruben, Panzergräben, breiten Minengürteln, elektrisch gesteuerten Flammenwerfern und PaK-Stellungen.
Im Moskauer Raum befand sich ein Grossteil der sowjetischen Stawka-Reserven; die sowjetischen Luftstreitkräfte konzentrierten dort fast 40 % der einsatzbereiten Flugzeuge und hatten den Vorteil, dass sie friedensmässig ausgebaute Flugplätze nahe der Front zur Verfügung hatten.
Mitte August 1941 funkte aus Japan der als Korrespondent der Frankfurter Zeitung getarnte Agent Dr. Richard Sorge nach Moskau, dass der japanische Kronrat beschlossen habe, den Kampf gegen die Sowjetunion von Mandschukuo aus endgültig einzustellen. Eher wäre Japan bereit, einen Krieg gegen die USA und das Vereinigte Königreich in Kauf zu nehmen, als auf die Rohstoffvorkommen Süd-Indochinas zu verzichten. Durch diese, aus historischer Sicht kriegsentscheidende Information besass das sowjetische Oberkommando die strategische Möglichkeit, grössere Reserven in Form von sibirischen Truppen aus dem Fernen Osten nach Westen zu verlegen. Die sibirischen Truppen, fast 700.000 Mann, waren die zu diesem Zeitpunkt letzten gut ausgerüsteten Reserveverbände der Roten Armee. Die Truppentransporte nahmen für die über 8.000 km lange Strecke zwischen Moskau und Wladiwostok mehrere Wochen in Anspruch. Während nur Restkommandos vor Ort verblieben, um mit fingierten Funksprüchen das Vorhandensein der Truppen vorzutäuschen, fuhren die Militärtransporte unter Verzicht auf das übliche Blocksystem direkt auf Sicht und rollten mit absolutem Vorrang mit einer Tagesleistung von etwa 750 km westwärts.
Die Panzergruppe 2 begann den Angriff bereits am 29. September und sollte aus den Raum Gluchow antretend, den Zangengriff von Südwesten her beginnen. Guderians Truppen hatten über Orjol, Tula bis nach Moskau mit über 600 km den längsten Weg zurückzulegen. Gleichzeitig begann der Angriff der Heeresgruppe Süd auf Kursk, Charkow und das Donezbecken.
Im Morgengrauen des Ersten Angrifftages wurde den deutschen Soldaten Hitlers Tagesbefehl vorgelesen, in dem der Beginn der letzten Entscheidungsschlacht dieses Jahres angekündigt wurde, mit dem Hinweis auf die grosse Gefahr, „die seit den Zeiten der Hunnen und später der Mongolenstürme entsetzlicher nicht mehr über dem Kontinent schwebte“.
Am 2. Oktober 1941 um 05:30 Uhr traten etwa 350 km vor Moskau von Nord nach Süd an: 9. Armee (Strauss), Panzergruppe 3 (Hoth), Panzergruppe 4 (Hoepner), 4. Armee (von Kluge), die Panzergruppe 2 (Guderian) und die 2. Armee (von Weichs). Beabsichtigt war, beiderseits der Rollbahn Smolensk–Moskau vorzugehen und Moskau durch die PzGr. 3 im Norden und die PzGr. 4 im Süden zu umfassen. Bei der sogenannten „Rollbahn“ handelte es sich um die Hauptverkehrsstrasse zwischen Moskau und Smolensk, die streckenweise vierspurig ausgebaut war (heute Magistrale Nr. 1). Einige Streckenabschnitte bestanden jedoch noch aus unbefestigten Sandwegen bzw. aus Kopfsteinpflaster.
Zu diesem Zeitpunkt verfügten die motorisierten Verbände der Heeresgruppe Mitte nur noch über etwa 30–40 % ihres Bestandes. Die Versorgung der Truppen machte der Wehrmacht Probleme, da die sowjetische Eisenbahn auf Breitspur ausgelegt war und die Schienen daher erst umgenagelt werden mussten. Zudem stiessen die Transportkapazitäten der Deutschen Reichsbahn an ihre Grenzen, zusätzlich verschärft durch Überfälle sowjetischer Partisanen.
Am 3. Oktober wurde die Stadt Orjol durch das XXIV. Armeekorps (mot.) der Panzergruppe 2 derartig überraschend eingenommen, dass die elektrischen Bahnen in der Stadt noch fuhren. Eine offensichtlich geplante Räumung der Industrieanlagen konnte nicht mehr durchgeführt werden. Zwischen Fabriken und dem Bahnhof lagen grossflächig Maschinen und Kisten mit Werkzeugen und Rohstoffen an den Strassen. Vom Westen her ging die deutsche 2. Armee aus dem Raum Potschep nach Osten vor und hielt die Frontruppen der sowjetischen 3. und 13. Armee fest.
Nach dem Schwenk der 17. und 18. Panzer-Division in Richtung Nordwesten wurde am 6. Oktober Brjansk erobert und die nordöstlich der Stadt eingesetzte sowjetische 50. Armee eingekesselt. Armeegeneral Schukow wurde von Stalin aus Leningrad abberufen und mit der Verteidigung Moskaus beauftragt. Tags darauf schloss sich ein weiterer Kessel um die sowjetische 16., 19., 20., 24. und 32. Armee bei Wjasma. Das sowjetische Komitee der Staatsverteidigung traf den Beschluss, etwa 15 bis 20 km vor Moskau eine halbkreis-förmige Verteidigungsstellung zu errichten, die aus mehreren Verteidigungslinien bestehen sollte. Ebenfalls am 7. Oktober verbot Hitler jegliche Annahme einer eventuell unterbreiteten Kapitulation Moskaus. Durch den Reichspressechef Otto Dietrich wurde am 8. Oktober der in- und ausländischen Presse mitgeteilt, dass der „Russlandkrieg mit der Zertrümmerung der Heeresgruppe Timoschenko entschieden“ und die UdSSR geschlagen sei.
Am 14. bzw. 17. Oktober wurden die Kessel von Wjasma und Brjansk geräumt. Das OKW meldete die Vernichtung von 80 Divisionen; 663.000 Gefangene wurden gemacht, 1242 Panzer und 5412 Geschütze zerstört oder erbeutet.
Reorganisation der sowjetischen Verteidigung
Um die Verteidigung im westlichen Vorfeld Moskaus zu reorganisieren wurde die Reservefront am 10. Oktober aufgelöst und deren Armeen der Westfront angegliedert und am 12. Oktober Armeegeneral G.K. Schukow unterstellt.
Die zum Schutz Moskaus neu reorganisierte Westfront zählte am 10. Oktober nach der Eingliederung der Verbände der Reservefront 6 Armeen mit wieder 62 Schützen- und 9 Kavallerie-Divisionen, unterstützt von 11. Panzerbrigaden:
- Armee, Generalmajor W. A. Juschkewitsch
- Armee, Generalmajor K. K. Rokossowski
- Armee, Generalleutnant Leljuschenko, ab 15. Oktober L. A. Goworow
- Armee, Generalleutnant M. G. Jefremow
- Armee, Generalmajor K. D. Golubjew
- Armee, Generalleutnant I. G. Sacharkin
Am 12. Oktober eroberten Einheiten der deutschen 4. Armee Kaluga. Um diese Zeit begann die Schlammperiode (Rasputiza), und es kam zu ersten Gefechtsberührungen zwischen Wehrmacht und Truppen der Fernostarmee. Am 14. Oktober gelang dem deutschen VI. Armeekorps der 9. Armee mit der Einnahme von Rschew die Überschreitung der Wolga. Rechts davon nach Nordosten vorgehend, besetzte das XXXXI. Panzerkorps am 14. Oktober Kalinin. Der rechte Flügel der sowjetischen Westfront, die 22., 29. und 30. Armee wurden darauf am 17. Oktober dem einheitlichen Kommando Konjews unterstellt, dabei wurde die Kalininer Front gebildet. Am 23. Oktober trat auch die 31. Armee aus dem Bestand der Westfront zur Kalininer Front über.
Am 14. Oktober erreichten Panzerspitzen des XXXXVI. Panzerkorps die Moskauer-Schutzstellung bei Moshaisk, die sich fast 300 km lang von Kalinin über Wolokolamsk bis nach Kaluga erstreckte. Zunächst war die sowjetische 33. Armee mit der Errichtung der Befestigungsanlagen im Raum Moshaisk beauftragt, diese Truppen wurden aber bald an die bedrohte Front zwischen Rshew und Wjazma verlegt. Generalmajor Leljuschenko befehligte darauf diesen wichtigen Abschnitt mit Moskauer Milizen und der neu formierten 5. Armee, die aus dem Stab und Truppen des I. Garde-Schützenkorps aufgestellt worden war. Die bald zugeführte 32. Schützen-Division unter Oberst Polosukhin, besetzte mit etwa 12.000 Mann den zentralen Verteidigungs-Abschnitt der Moskauer-Schutzstellung bei Borodino und unterstützte die Moskauer Miliz bei der Verteidigung der Zugänge nach Moshaisk. Am 14. Oktober begannen auf dem historischen Schlachtfeld von Borodino, mehrtägige schwere Kämpfe, in der die SS-Division „Das Reich“ auf frische sibirische Elitetruppen traf und am 17. Oktober das Dorf Gorki einnehmen konnte. Die 10. Panzerdivision konnte bei diesen Kämpfen bei Utizy durchbrechen, im Süden über Psarewo umfassen und Moshaisk am 18. Oktober einnehmen. In dieser Zeit standen in der Moskauer Schutzstellung noch die 16. Armee mit zwei Kavalleriedivisionen unter Generalmajor L. M. Dowator, der 316. Schützen-Division (Generalmajor Iwan Panfilow), einem Kadetten-Regiment unter Oberst S. Mladentsev und die aus Moskauer Arbeiter gebildete 18. Miliz-Schützen-Division (Generalmajor P. Tschernyshew). Die sowjetische 43. Armee sicherte die Schutzstellung bei Malojaroslawez, die 49. Armee bei Kaluga und die 50. Armee begann sich bei Tula zu formieren.
In Moskau brach zwischen dem 16. und 18. Oktober eine Massenpanik unter der Bevölkerung aus, nachdem sie erstmals über die Bedrohung durch die Deutschen informiert wurde. Zu diesem Zeitpunkt waren fast zwei Millionen Menschen aus der Stadt evakuiert. In den Stadtbezirken wurden Arbeiterbataillone aufgestellt. Viele Kunstwerke aus den Museen und des Kremls – selbst der einbalsamierte Leichnam Lenins – wurden aus der Stadt nach Osten in Sicherheit geschafft. Über 200.000 Arbeiter verliessen mit ihren Arbeitsausrüstungen die Stadt. Die meisten Betriebe standen still, viele Geschäfte und Warenhäuser wurden geplündert, erhebliche Teile der Bevölkerung versuchten die Stadt zu verlassen. Am 19. Oktober wurde über Moskau das Standrecht verhängt und Sperrverbände des NKWD unter dem Befehl von Generalleutnant Pawel Artemjew griffen hart durch. Meuterer wurden erschossen, Deserteure gehängt. An diesem Tage wurde auch in Tokio Richard Sorge durch die japanische Geheimpolizei Tokkō verhaftet. Er hatte mit seinem Funker Clausen (Deckname Fritz) seit 1939 insgesamt 141 Berichte mit über 65.000 Wörtern nach Moskau gefunkt sowie zahlreiche Mikrofilme per Kurier gesandt. Unterdessen wurden alle wichtigen Behörden, das Politbüro und fast sämtliche ausländische Diplomaten aus Moskau nach Kujbyschew (heute Samara) evakuiert. Stalin und das Hauptquartier des Obersten Befehlshabers (Stawka) blieben in der Stadt. In einer geheimen Mission wurde Moskau durch zwei Kompanien Bergbauspezialisten zur Sprengung vorbereitet. Unterdessen errichteten 500.000 Moskauer, überwiegend Frauen, Befestigungsanlagen vor Moskau.
Gegenangriffe und Schlammperiode
Am 18. Oktober setzte die sowjetische 29. Armee (Generalleutnant Maslennikow) im Abschnitt der Panzergruppe 3 bei Kalinin zum Gegenangriff an: am folgenden Tag musste das XXXXI. Armeekorps (mot) die Eisenbahnbrücke bei Mjednoje samt den dortigen Brückenkopf räumen. Das Eingreifen des 8. Fliegerkorps stabilisierte die bereits bedrohliche Lage bei der deutschen 1. Panzer-Division. Die Mitte Oktober einsetzende Schlammperiode mit den aufgeweichten Wegen und Strassen erwies sich bald als wirksamer Helfer der Sowjetunion im Kampf gegen die Wehrmacht. Der Nachschub der an den Angriffsoperationen unmittelbar beteiligten Divisionen sank schlagartig von 900 Tonnen täglich auf nur noch rund 20 Tonnen. Das Erlahmen des deutschen Angriffes nutzten die sowjetischen Truppen zum Ausbau der Verteidigungsanlagen.
Ab dem 1. November durfte die Rollbahn Smolensk-Moskau nur noch mit Sondergenehmigung befahren werden, um sie nicht noch mehr „aufzuwühlen“, bis am 3. November leichter Frost einsetzte und die Strassen und Wege wieder befahrbarer machte. Jedoch brauchte die Wehrmacht fast zwei Wochen, bis Munition und Treibstoff herangeschafft werden konnten, um den Angriff wieder aufzunehmen. Als bereits am 6. November strenger Frost einsetzte, waren die Soldaten der Wehrmacht immer noch ohne Winterbekleidung. Am gleichen Tage fand in der Metrostation Majakowskaja eine feierliche Sitzung des Moskauer Sowjet statt, in der Stalin in einer leidenschaftlichen Rede die Kampfkraft seiner Soldaten und die Widerstandskraft der sowjetischen Bevölkerung beschwor. Tags darauf wurde auf dem Roten Platz trotz der Gefahr deutscher Luftangriffe eine Militärparade zum Gedenken an die Oktoberrevolution abgehalten. Die teilnehmenden Truppen der Roten Armee marschierten anschliessend direkt zur nahen Front. Auf deutscher Seite wurde in dieser Zeit hingegen das VIII. Armeekorps (8. und 28. Infanterie-Division) sogar aus der Front herausgezogen, um in Frankreich umgerüstet zu werden.
Bereits am 13. November griffen sowjetische Truppen den rechten Flügel der 4. Armee mit dem Ziel an, die deutsche Angriffsfront zu zersplittern. Während dieser Kämpfe nutzte die Rote Armee die Zeit, um weitere Reservearmeen zur Vorbereitung der Offensive heranzuführen und für die deutsche Aufklärung möglichst unbemerkbar in die Front einzugliedern.
Zweite deutsche Angriffsphase im Vorfeld Moskaus
Mitte November begann am Nordabschnitt der Heeresgruppe Mitte die zweite Phase des deutschen Angriffs, der auf verbissenen Widerstand der Roten Armee traf. Da grössere Teile der deutschen Luftflotte 2 (Kesselring) in den Mittelmeerraum verlegt worden waren, fehlte es an der nötigen Luftunterstützung. Die sowjetischen Streitkräfte hingegen konnten ihrerseits in den wichtigsten Abschnitten die Luftherrschaft erringen. Am 15. November startete das XXVII. Armeekorps (86. und 161. Infanterie-Division) der deutschen 9. Armee einen Angriff nördlich von Selenzino-Iljinskoje am Nordrand des Wolga-Staubeckens. Während das XXXXI. Armeekorps (mot.) vor Kalinin festlag, versuchte das umgruppierte LVI. Armeekorps (mot.) beidseitig Lataschino in Richtung auf Klin durchzubrechen. Die 6. Panzer-Division erreichte die Lama und bildete einen Brückenkopf.
Am 18. November gelang im Süden während der Schlacht um Tula die Einnahme von Jepifan durch Truppen des XXXXVII. Armeekorps (mot.) und von Dedilowo durch Einheiten das XXIV. Armeekorps (mot.). Trotz schwerer Verluste durch Pak-Stellungen erreichte die 2. Panzerarmee am 22. November den Durchbruch auf Stalinogorsk und bedrohte Moskau von Südosten her. Am selben Tag wurde auf Anordnung des Kommandanten der Westfront, der im Raum Tula befehlende General A. N. Jermakow entlassen, am 19. Dezember verhaftet und vor ein Kriegsgericht gestellt.
Am 23. November nahm die 10. Infanterie-Division (mot.) Michailow, die 29. Infanterie-Division überschritt den Don-Abschnitt und gewann nach Norden über 40 km tief an Boden. Die 18. Panzer-Division drang an der rechten Flanke über das Dorf Skopin nach Gorlowo durch. Am gleichen Tag meldete Feldmarschall von Bock dem Oberkommando des Heeres die bedrohliche Lage sowie die Erschöpfung der Truppen. Die Heeresgruppen Mitte erhielt jedoch Befehl, die Offensive mit dem „letzten Kraftaufgebot“ fortzusetzen. Die deutsche Führung ging davon aus, dass auf beiden Seiten das letzte Bataillon im Einsatz stehe.
Bei der Panzergruppe 3 wurde am 25. November endlich das umkämpfte Klin (100 km nordwestlich von Moskau) durch die 7. Panzer-Division vollständig besetzt. Am folgenden Tag gelang der 6. Panzer-Division die Einnahme des Ortes Rogatschewo und am 27. November der Durchbruch nach Jachroma, wo die Kampfgruppe Manteuffel einen Brückenkopf am östlichen Ufer des Wolga-Moskau-Kanals errichtete.
Am 26. November wurde die Stadt Istra 35 km vor Moskau durch das IX. und XXXX. Armeekorps (mot.) der Panzergruppe 4 genommen. Am 27. November sanken die Temperaturen bereits unter 35 Grad Minus und forderten bei den Deutschen hohe Ausfälle an Erfrierungen, während die Rote Armee seit Mitte November vollständig mit warmer Kleidung ausgerüstet worden war.
Am 30. November nahmen das in den Norden Moskaus umgruppierte V. Armeekorps (General Ruoff) im Zusammenwirken mit dem XXXXVI. Armeekorps (mot.) die Orte Krasnaja Poljana und Putschki (heute beide Teil der Stadt Lobnja) ein und kamen dadurch bis auf 18 km an die Stadt heran. Am gleichen Tag meldete Schukow die Bereitschaft zur Gegenoffensive. Stalin beschloss aber mit dem Angriff noch bis zum 6. Dezember abzuwarten, um die Kräfte besser zu koordinieren und weitere Reserven heranzubringen.
Ende November war der Angriff des XXXX. Armeekorps (mot.) vor Krasnaja Poljana zum Stillstand gekommen. Die Panzergruppe 3 (Generaloberst Hoth) verfügte in der zugeteilten 1., 6. und 7. Panzer-Division noch immer über etwa 80 Panzer und die Panzergruppe4 (Generaloberst Hoepner) in der 2., 5., 10. und 11. Panzer-Division über etwa 170 Panzer. Die Heeresgruppe Mitte hatte bei den Kämpfen im November 45.735 Tote zu verzeichnen und weitere 300 Panzer und Sturmgeschütze verloren. Der Treibstoff und die Munition waren knapp, trotzdem gelang am2. Dezember einem Erkundungstrupp des Panzerpionierbataillons 62, noch bis zum Moskauer Vorort Chimki vorzudringen. (etwa acht Kilometer vor der Stadtgrenze, seit 1976 Denkmal Jeschi). Es war der dem Kreml nächstgelegene Punkt (23,7 km entfernt), den die Wehrmacht erreichte; dessen Türme waren durch die Scherenfernrohre zu sehen. Die Moskauer Festungsbatterien schossen nun in die vordersten deutschen Linien. Die an diesen Tagen auch am Südabschnitt eingeleiteten neuen Angriffe der 2. Panzerarmee auf Tula konnten durch die sowjetische 50. Armee (Generalleutnant I. W. Boldin) abgeschlagen werden.
Sowjetische Gegenoffensive
Planungen
Bereits am 25. November legte Marschall Schaposchnikow Stalin den Plan einer Gegenoffensive vor. Es standen bereits 21 der insgesamt 34 Fernosteinheiten im Raum Moskau bereit, die in der Planung eine entscheidende Rolle spielten. An diesem Tage beorderte Stalin die 20. Armee (A. A. Wlassow) und weitere Divisionen aus der strategischen Reserve der Stawka zur Vorbereitung einer Gegenoffensive in die vordere Front. Die Stawka aktivierte zudem zwei weitere Reservearmeen: die 1. Stossarmee (Generalleutnant W. I. Kusnezow) wurde zum Schutz des Moskau-Wolga-Kanal im Raum Dmitrow konzentriert und am Südabschnitt die 10. Armee (General Golikow) im Raum Rjasan. Die Meldungen der Luftaufklärung über erkannte Truppenausladungen im Raum Moskau wurden von der deutschen Führung als „Gespenstereien“ betrachtet.
Am 30. November stimmte Stalin dem Plan zur Gegenoffensive zu und betraute General Schukow mit der Führung, der bereits für seine Erfolge 1939 in der Schlacht am Chalchin Gol gegen Japan zum Held der Sowjetunion ernannt worden war. Bereits Mitte November des Jahres 1941 führte die Rote Armee auf den Flügeln Gegenoffensiven mit hohen Zielsetzungen. Diese waren jedoch primär zur Rückeroberung von strategisch wichtigen Punkten gedacht und nicht Teil einer frontübergreifenden Grossoffensive zur Vernichtung der deutschen Truppen. Als Resultat dieser ersten sowjetischen Gegenoffensiven wurde die Räumung von Rostow am Don durch die 1. Panzerarmee sowie die Aufgabe von Tichwin durch die 16. Armee erzwungen. Der sowjetische Gegenangriff sah vor, zuerst die für Moskau gefährlichsten deutschen Einheiten der Panzergruppe 3 und 4 einzukesseln, abzuschnüren und zu vernichten. Danach sollte im Zuge weit nach Westen reichender Operationen und Kesselschlachten die gesamte Heeresgruppe Mitte ausgeschaltet werden, während an den übrigen Frontabschnitten in Norden und Süden gleichzeitig stattfindende Stör- und Tarnangriffe ein Abziehen deutscher Reserven an die Mitte der Front unmöglich machen sollten. Das sowjetische Oberkommando stellte aus der strategischen Reserve etwa 1.060.000 Mann, fast 700 Panzer und starke Artilleriekräfte zur Verfügung. Die sowjetischen Luftstreitkräfte konnte dafür fast 1.400 Flugzeuge einsetzen.
Offensiven der West- und Kalininfront
Einen Tag vor Beginn der Grossoffensive der Kalininer Front und der Westfront am 5. Dezember beurteilte die Abteilung „Fremde Heere Ost“ des Generalstabes des Heeres die Lage so, dass die sowjetischen Truppen „zur Zeit“ ohne Zuführungen von nennenswerten Verstärkungen nicht zu einem Grossangriff im Abschnitt der Heeresgruppe Mitte in der Lage seien. In Wirklichkeit hatte die Stawka die Kalinin- und West-Front auf 106 Grossverbände in Divisionsstärke gebracht, darunter 21 frische Elitedivisionen aus Sibirien. Diesen gegenüber konnte Feldmarschall von Bock nur 68 zumeist abgekämpfte Divisionen entgegenstellen, das Truppenverhältnis lag jetzt bei 1,5:1 zugunsten der Roten Armee. Auch bei den Luftstreitkräften konnte die sowjetische Luftwaffe mit 1370 Flugzeugen gegenüber etwa 550 deutsche Maschinen eine klare Überlegenheit erzielen.
Die unerwartet starken Angriffe auf die von der 9. Armee sowie von den Panzergruppen 3 und 4 besetzten Frontabschnitte begannen am 5. Dezember 1941. Der sowjetische Hauptangriff wurde im Norden beiderseits des Wolga-Staudammes mit südwestlichem Angriff auf Klin durch die Kalininer Front (Generaloberst Konew) geführt. Im Anschluss führte die Westfront (Armeegeneral Schukow) Frontalstösse beiderseits der Rollbahn Moskau–Smolensk nach Westen durch. Die 30. Armee (Leljuschenko) hatte den Feind im Raum Rogatschewo-Borschtschewo zu schlagen und zusammen mit der 1. Stossarmee über den Abschnitt Reschetnikowo-Klin auf die Linie Kostljakowo und Lotoschino vorzudringen. Die 1. Stossarmee (Kusnezow) hatte die Teile der deutschen Panzergruppe 3, welche über den Wolga-Moskwa Kanal vorgedrungen waren, zu vernichten, sich dann im Raum Dmitrow-Jachroma zu konzentrieren und zusammen mit der 30. und 20. Armee (Wlassow) über Klin auf Terjajewa Sloboda vorzugehen. Südlich davon sollte die 5. Armee (Goworow) aus dem Raum Poljana Krasnaja zusammen mit dem rechten Flügel der 16. Armee auf Solnetschnogorsk angreifen. Der linke Flügel der 16. Armee (Rokossowski) hatte über Krjukowo auf Istra durchzubrechen. Die bisher in der Mitte der Westfront stehende 5., 33., 43. und 49. Armee waren für Angriffe zu geschwächt und hatten den Gegner (deutsche 4. Armee) nur zu fesseln. Die noch im Raum Tula in Abwehrkampf stehende 50. Armee (Boldin) sollte einen Gegenangriff in Richtung Bolochowo und Schtschekino ansetzen. Die Kavalleriegruppe Below hatte über Wenew in Richtung Stalinogorsk und Dedilowo anzugreifen, während entlang der Linie Serebrjanje Prudy-Michailow die neu herangeführte 10. Armee (Golikow) ihren Angriff zwischen Uslowaja und Bogorodizk ansetzen und südlich des Flusses Upa vordringen sollte. In der Nacht zum 5. Dezember landeten 416 sowjetische Fallschirmjäger nahe der Stadt Juchnow und sollten den dortigen Flugplatz sichern, gleichzeitig zerstörten sowjetische Partisanen im Hinterland die wenigen nutzbaren Schienenwege und von deutschen Pionieren umgespurten Gleise auf europäische Normalspur (die wenigen intakt eroberten Schienenstränge hatten die von den Deutschen nicht nutzbare russische Breitspur) oder besetzten wichtige Strassenkreuzungen. Die durch die sowjetische 10. Armee und dem 1. Garde-Kavalleriekorps bei Wenew und Michailow angegriffene deutsche 2. Panzerarmee musste ihren letzten Angriff auf Tula abbrechen und den dortigen Frontbogen aufgeben. Weiter südlich ging am 6. Dezember auch die 13. Armee (General Gorodnjanski) der Südwestfront (Timoschenko) zum Angriff über und schlug bei Jelez eine Bresche in die Front des deutschen XXXIV. Armeekorps.
Aufgrund der allgemeinen sowjetischen Gegenoffensive und der entdeckten gegnerischen Reserven erschienen die Einstellung des deutschen Angriffs und der geordnete Rückzug auf eine operativ günstig gelegene Winterstellung dringend nötig. Weitere Probleme waren die nachlassende Kampfkraft, die prekäre Lage beim Truppenersatz sowie die extreme Erschöpfung der Soldaten, was einen schnellen Entschluss notwendig machte. Daraus resultierte eine Bekanntgabe der neuen Rückzugslinie der 4. Armee sowie der Panzergruppen durch das Kommando der Heeresgruppe Mitte. Es war vorgesehen, dass ab dem 6. Dezember nach besonderem Befehl mit dem Rückzug begonnen werden konnte, für den rund zwei Nächte veranschlagt worden waren. Der endgültige Termin des Rückzugsbeginns wurde an Hitlers Einwilligung und eine neue Weisung zur Auslösung gebunden. Es herrschte jedoch die problematische Situation, dass der Grossteil der Heeresgruppe Mitte weder Truppen noch Ressourcen zur Verfügung hatte, die den Bau einer Stellung ermöglicht hätten, welche sowjetische Vorstösse oder eine Grossoffensive abfangen konnte. Als Folge dieser Tatsache zog der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte, Fedor von Bock, für sich den Schluss, dass grossräumige Rückzüge auf ausgebaute Stellungen nicht möglich waren und daher nur ein Haltebefehl als Möglichkeit verblieb. Die Grundvoraussetzung für diese Entscheidung war die sofortige Auffüllung der Truppen durch die Zuführung von neuem Personalersatz.
Am Anfang der sowjetischen Grossoffensive war es für die deutsche Militärführung oberste Priorität, einen Durchbruch der Roten Armee zu verhindern, weshalb allen Verbänden jegliche Lösung vom Feind verboten wurde. Die sowjetischen Truppen waren bestens auf den Winter vorbereitet und verfügten über Ski- und Schneeschuheinheiten, die der Infanterie im tief verschneiten Gelände hohe Bewegungsfähigkeit ermöglichten. Ausserdem war die Rote Armee mit dem neuen T-34-Panzer ausgestattet, der den deutschen Panzermodellen in vielerlei Hinsicht überlegen war und gegen den die Wehrmacht über keine effektive Panzerabwehr verfügte. Die deutsche Heeresgruppenführung reagierte nur zögerlich auf den sowjetischen Angriff, bis sie diesen als Grossangriff erkannte. Erst am Abend des 6. Dezember befahl sie, den eigenen Angriff auf Moskau einzustellen und in den Ausgangsstellungen zur Verteidigung überzugehen.
Am 7. Dezember wurde die sowjetische Bevölkerung zum ersten Mal durch das Sowinformbüro über die Offensive gegen die „deutsch-faschistischen Truppen“ informiert, die hohe Verluste erlitten hätten, während die eigenen Truppen im Vorgehen seien. Am selben Tag führten die Marineluftstreitkräfte Japans den Angriff auf Pearl Harbor durch, bei dem die in Pearl Harbor vor Anker liegende Pazifikflotte der USA schwer getroffen wurde. Am nächsten Tag, dem 8. Dezember 1941, erfolgte der Kriegseintritt der USA.
In der Nacht vom 7./8. Dezember kamen sowjetische Kosakenregimenter verstärkt zum Einsatz. Hinter der Front überfielen sie Versorgungslager, Trosse und rückwärtige Stäbe und stifteten einige Verwirrung. Zwei Tage später befahl die Heeresgruppe Mitte den allgemeinen Rückzug auf die Winterstellung. Am 11. Dezember folgte die Kriegserklärung Deutschlands und Italiens an die Vereinigten Staaten.
Hitler lehnte am 16. Dezember jede weitere Absetzbewegung ab und formulierte in einer Führerweisung vom 18. Dezember neue Richtlinien der Kampfführung und zwang dadurch die Truppen, „fanatisch“ in ihren Stellungen auszuhalten.
An die Heeresgruppe Mitte
1. Der Führer hat befohlen:

„Grössere Ausweichbewegungen können nicht durchgeführt werden. Sie führen zum völligen Verlust von schweren Waffen und Gerät. Unter persönlichem Einsatz der Befehlshaber, Kommandeure und Offiziere ist die Truppe zum fanatischen Widerstand in ihren Stellungen zu zwingen, ohne Rücksicht auf durchgebrochenen Feind in Flanke und Rücken. Nur durch eine derartige Kampfführung ist der Zeitgewinn zu erzielen, der notwendig ist, um die Verstärkungen aus der Heimat und dem Westen heranzuführen, die ich befohlen habe. Erst wenn Reserven in rückwärtigen Sehnenstellungen eingetroffen sind, kann daran gedacht werden, sich in diese Stellungen abzusetzen“.
Am 16. Dezember wurde Kalinin von zwei Divisionen der 29. Armee (General Schwezow) im Zusammenwirken mit der 256. Schützen-Division der 31. Armee befreit. Am 19. Dezember entliess Hitler von Brauchitsch und übernahm selbst den Oberbefehl über das Heer. Am 21. Dezember versuchte die Rote Armee handstreichartig Kaluga zu besetzen und es begannen drei Tage dauernde Strassenkämpfe. Am 25. Dezember konnte die Rote Armee Istra, Rusa und Wolokolamsk befreien. Generaloberst Guderian nahm in diesen Tagen seine Truppen entgegen ausdrücklicher Haltebefehle eigenmächtig zurück und wurde deswegen seines Kommandos enthoben und zur Führerreserve versetzt. Die 2. Panzerarmee wurde danach General der Panzertruppe Schmidt unterstellt.
Am 30. Dezember fiel Kaluga endgültig wieder in sowjetische Hand, am 7. Januar Moschaisk. Am 8. Januar musste Hoepner seine Truppen zwingend zurücknehmen, um sie der drohenden Einkesselung zu entziehen. Auch hier lag ein strikter Haltebefehl des OKH vor. Da sich derartige „Rebellionen“ häuften, statuierte Hitler ein Exempel an Hoepner, indem er ihn seines Kommandos enthob und unehrenhaft aus der Wehrmacht ausschloss. Von diesem Tage an musste jeder Rückzugsbefehl bis Kriegsende persönlich von Hitler genehmigt werden.
Am 15. Januar befahl Hitler in Anbetracht der Notwendigkeiten den Rückzug auf die Winterstellung. Doch kam dieser Befehl viel zu spät, und die grösstenteils zu Fuss zurückweichenden deutschen Truppen mussten mangels Pferden, Zugmaschinen oder Betriebsstoff das gesamte schwere Gerät zurücklassen. Der Begriff „Winterstellung“ hatte seinen Ursprung in der NS-Propaganda, die dem deutschen Volk einen geordneten Rückzug auf ausgebaute Stellungen vorgaukeln sollte. Von einer im militärischen Sinne ausgebauten Stellung mit Schützengräben, Bunkern, Artilleriestellungen und sonstigen Befestigungsanlagen war nicht die Rede. Tatsächlich wurde hier eine von Hitler willkürlich gezogene Linie auf der Landkarte, die sich hauptsächlich an logistischen Notwendigkeiten im Sinne von nahen Versorgungspunkten und kurzen Wegen entlang der Entladebahnhöfe des Nachschubes, der fast vollständig mit der Deutschen Reichsbahn erfolgte, sowie eventuellen strategisch günstigen Aufmarschgebieten für kommende Offensiven orientierte, als „Winterstellung“ bezeichnet.
Folgen
In der deutschen Angriffsoperation (30. September bis 5. Dezember 1941) war die Rote Armee auf der 700 bis 1110 km breiten Front 250 bis 300 km nach Osten zurückgedrängt worden und hatte gewaltige Verluste von etwa 656.000 Mann (514.000 Tote) erlitten. In der Moskauer Angriffsoperation (5. Dezember 1941 bis 7. Januar 1942) stiess die Rote Armee auf einer etwa 1000 km breiten Front elf bis 250 km nach Westen vor und verlor dabei 370.000 Mann (140.000 davon Tote).
Die deutsche Wehrmacht verlor für den gesamten Zeitraum schätzungsweise 500.000 Mann an Toten oder Verwundeten sowie zusätzlich mindestens 100.000 Mann an Ausfällen durch Erfrierungen, dazu 1300 Panzer, 2500 Geschütze und über 15.000 Kfz. Dennoch konnte die Wehrmacht Ende Januar 1942 bei Rschew und Juchnow grössere Abwehrerfolge erringen, die den Aufbau einer neuen Verteidigungslinie ermöglichten. Stalin hatte zwar nur einen Teil seines Planes verwirklichen können, da die Heeresgruppe Mitte nicht vernichtet wurde, aber die Schlacht um Moskau war für das Deutsche Reich verloren.
Im Zuge der sowjetischen Winter- und Gegenoffensive wurden in Demjansk (Kesselschlacht von Demjansk) und Cholm an der Nahtstelle zur Heeresgruppe Nord grössere deutsche Truppenverbände eingeschlossen, die erst im Frühjahr 1942 nach mühseliger und verlustreicher Luftversorgung entsetzt werden konnten.
Das Scheitern des „Unternehmens Taifun“ bedeutete gleichzeitig den völligen Fehlschlag des gesamten „Unternehmens Barbarossa“ und der deutschen Blitzkriegstrategie in der Sowjetunion. Die angestrebte Linie Archangelsk–Astrachan lag in unerreichbarer Ferne, die Rote Armee war keinesfalls entscheidend geschwächt und die Feindkoalition begann sich wirkungsvoll gegen Deutschland zu formieren. Nach Hitlers Kriegserklärung an die USA unmittelbar nach Pearl Harbor und mitten im Verlauf der sowjetischen Gegenoffensive im Winter vor Moskau weitete sich der Krieg auch zu einer tatsächlich global geführten militärischen Auseinandersetzung mit allen ihren Folgen aus. Das Kräfteverhältnis verschob sich kriegsentscheidend zu Ungunsten Deutschlands. Militärisch und wirtschaftlich war der Krieg bereits Ende 1941 für das Deutsche Reich nicht mehr zu gewinnen, obwohl es noch über 40 Monate dauerte, bis es schliesslich kapitulierte.
Rezeption
Nachdem die Sowjetunion durch den deutschen Überfall militärisch in ernste Bedrängnis geriet, konnte sie mit dem ersten grossen Sieg über Deutschland die Lage wieder ausgleichen. Dies sorgte nicht nur für eine Verbesserung der Moral in der Bevölkerung und der Roten Armee, sondern auch die Westalliierten erkannten die Sowjetunion als gleichwertigen Bündnispartner an und ebneten den Weg zur Konferenz von Teheran. Anlässlich der erfolgreichen Verteidigung Moskaus stiftete Stalin am 1. Mai 1944 die Medaille „Für die Verteidigung Moskaus“. Zum 50. Jahrestag der Schlacht gab die sowjetische Staatsbank 1991 eine Gedenkmünze im Wert von 3 Rubeln aus. Die deutsche Führung erliess nach dem desaströsen Debakel des deutschen Heeres vor Moskau die Direktiven zum Winterkrieg.
Schlacht um Tichwin (16.10.1941 – 30.12.1941)
Die Schlacht um Tichwin war eine militärische Auseinandersetzung im Norden der Deutsch-Sowjetischen Front während des Zweiten Weltkrieges und dauerte insgesamt vom 16. Oktober bis 30. Dezember 1941.
Schlacht um Tichwin (16.10.1941 – 30.12.1941)
Vorgeschichte
Nach der Einschliessung Leningrads (Leningrader Blockade) stiess die deutsche Heeresgruppe Nord weiter nach Osten vor. Die Kämpfe begannen am 16. Oktober 1941 mit einer Offensive der deutschen Truppen über den Wolchow hinweg, die das Ziel verfolgte, die Stadt Tichwin zu erobern.
Nachdem das XXXIX. Armeekorps (mot.) der Wehrmacht die Stadt am 8. November eingenommen hatte, konnte es wegen des Wintereinbruchs und fehlender Versorgung nicht weiter vordringen.
Die eigentliche Schlacht
Sowjetische Verbände traten im Rahmen der Tichwiner Angriffsoperation (russisch Тихвинская наступательная операция) zum Gegenangriff an. Die 4., 52. und 54. Armee hatten 186.000 Mann, 374 Geschütze und Mörser und 154 Panzer (26 davon schwere und mittlere).
Die 18. Armee der Heeresgruppe Nord unter Generaloberst Georg von Küchler hatte zwischen Ladogasee und dem Ilmensee 14 Divisionen mit 140.000 Mann, 1.000 Geschützen und Mörsern und 200 Panzern (sie hatten nicht mehr als 60 % ihrer Sollstärke). Die deutschen Truppen befanden sich hier in einem Frontvorsprung.
Am 10. November griff die sowjetische Nowgoroder Armeegruppe nördlich von Nowgorod an, am 12. November die 52. Armee nördlich und südlich von Malaja Wischera, am 19. November die 4. Armee nordöstlich von Tichwin und am 2. Dezember die 54. Armee westlich von der Stadt Wolchow. Der 52. Armee gelang der Durchbruch erst am 18. November; sie eroberte am 20. November die Stadt Malaja Wischera zurück. Am 7. Dezember durchbrach die 4. Armee westlich von Tichwin die deutschen Linien und erreichte Sitomlja; hier drohte sie die rückwärtigen Verbindungen der Wehrmacht abzuschneiden. Die deutschen Truppen begannen sich hinter den Fluss Wolchow zurückzuziehen. Am 9. Dezember nahmen sowjetische Truppen Tichwin wieder ein und zerschlugen die deutsche Garnison in Bolschaja Wischera am 16. Dezember. Zeitgleich begann die Wehrmacht mit dem Rückzug, weil ihren Truppen hier die Einschliessung durch sowjetische Verbände drohte. Am 28. Dezember warf die 52. Armee deutsche Truppen hinter die Eisenbahnlinie Mga–Kirischi zurück. Ende Dezember erreichte die sowjetische Wolchow-Front unter Kirill Afanassjewitsch Merezkow, die am 17. Dezember aus der 4. und 52. Armee gebildet worden war, den Fluss Wolchow und eroberte einige Brückenköpfe am linken Ufer.
Die Rote Armee stiess rund 100 bis 120 km vor, fügte zehn deutschen Divisionen hohe Verluste zu und zwang die Wehrmacht, zusätzliche fünf Divisionen an diesen Teil der Front zu verlegen. Insgesamt verlor sie dabei rund 49.000 Mann (18.000 davon Tote und Vermisste).
Die deutschen Truppen wurden bis zum 30. Dezember 1941 in ihre Ausgangsstellung am Wolchow zurückgedrängt.
Folgen
Der deutsche Vormarsch im Norden Russlands war beendet, die Leningrader Blockade wurde jedoch aufrechterhalten. Die Sowjets versuchten bereits wieder Anfang Januar 1942 in der Schlacht am Wolchow – erfolglos – diese Belagerung zu durchbrechen.
Schlacht bei Charkow (20.10.1941 – 24.10.1941)
Die Erste Schlacht bei Charkow vom 20. bis 24. Oktober 1941 bezeichnet die Kämpfe während der Eroberung der ostukrainischen Stadt Charkow (jetzt Charkiw) während des Zweiten Weltkrieges in der Sowjetunion. Den Angriff auf die Stadt leitete die deutsche 6. Armee der Heeresgruppe Süd, gegenüber verteidigte die 38. Armee, als Teil der sowjetischen Südfront.
Verlauf
Am 6. Oktober begann der Angriff der deutschen 6. Armee unter General von Reichenau über Sumy und Ochtyrka in Richtung auf Belgorod und Charkow, am selben Tag folgte die Offensive der 17. Armee aus dem Raum Poltawa in Richtung auf Losowaja und Isjum zum Fluss Donez. Der bedrohte Stadtbereich von Charkow fiel in den Verteidigungsbereich der sowjetischen 38. Armee unter Generalleutnant Zyganow. Während des deutschen Vormarsches bis zum Ende der Kämpfe um die Stadt, gelang es den sowjetischen Behörden einen grössten Teil der kriegsrelevanten Betriebe zur Verlagerung in den Osten abzubauen oder diese nachhaltig zu zerstören.
Am 20. Oktober 1941 hatten die deutschen Truppen den westlichen Rand der Stadt erreicht, das LV. Armeekorps unter General der Infanterie Vierow wurde mit dem Angriff auf die Stadt betraut. Während die 101. leichte Division noch etwa sechs Kilometer westlich von Charkow stand, wurde die 57. Infanterie-Division unter General Dostler direkt auf den Südteil der Stadt angesetzt. Am 21. Oktober gelang es dem Infanterie-Regiment 217 die wichtige Brücke über den Udy nördlich Guki kampflos einzunehmen und einen Brückenkopf zu bilden.
Die Stadt selbst wurde von der sowjetischen 216. Schützen-Division (Oberst D. F. Makshanow) und der 57. NKWD-Brigade (Oberst M. G. Sokolow) verteidigt, welche ihre Stellungen am West- und Nordostteil der Stadt gut ausgebaut hatten und auch im Wald von Grigorowka konzentriert waren. Nachdem im Laufe der Kämpfe auch die 101. leichte Division unter Generalleutnant Brauner von Haydringen im Nordteil von Charkow vordrang und rechts die 100. leichte Division (General Sanne) den Vorort Nowo Bavaria genommen hatte, konnte sich die 57. Division bis 24. Oktober durch den Ostteil der Stadt durchkämpfen. Die nachrückende 239. Infanterie-Division säuberte die Stadt. Gleichzeitig rückte das XVII. Armeekorps (General Kienitz) der 6. Armee weiter nach Osten vor und errichtete am 29. Oktober bei Stary Saltow einen Brückenkopf am Donez.
Schlacht um Tula (24.10.1941 – 05.12.1941)
Die Schlacht um Tula (russisch: Тульская оборонительная операция) vom 24. Oktober bis 5. Dezember 1941 war während des Zweiten Weltkrieges eine Angriffsoperation der deutschen Wehrmacht und Teil der Schlacht um Moskau. Sie spielte sich an der Ostfront am rechten Flügel der Heeresgruppe Mitte ab. Nach 45 Tagen auf beiden Seiten verlustreicher Kämpfe mit erheblichen Zerstörungen in der Stadt Tula gelang es der Roten Armee Anfang Dezember dank gut organisierter Waffen- und Nachschublieferungen, die deutschen Truppen in einer Gegenoffensive zurückzuschlagen.
Schlacht um Tula (24.10.1941 – 05.12.1941)
Vorgeschichte
Die deutsche 2. Panzerarmee unter Generaloberst Guderian hatte Anfang Oktober im Rahmen des Unternehmens Taifun den Angriff auf Moskau eröffnet und zusammen mit der 2. Armee unter Generaloberst von Weichs die Kesselschlacht bei Brjansk durchgeführt. Während die Armeekorps der deutschen 2. Armee die eingeschlossene Masse der sowjetischen 3., 13. und 50. Armee niederkämpften, nahm das XXIV. Armeekorps (mot.) den Vorstoss nach Orel auf. Die 18. und 17. Panzerdivision unter Generalleutnant von Arnim konnte am 5. und 6. Oktober Karatschew und Brjansk besetzen, der 3. Panzer-Division gelang die Einnahme von Belew, aber die 4. Panzer-Division wurde beim Vorstoss auf Mzensk durch Gegenangriffe der sowjetischen 4. Panzerbrigade unter Oberst Katukow zeitweilig gestoppt. Der Kommandeur der eingekesselten sowjetischen Brjansker Front, General Jerjomenko wurde vermisst und zwischenzeitlich durch General M. P. Petrow abgelöst. Am 8. Oktober tauchte Jerjomenko wieder auf und koordinierte die 3. und 13. Armee selbst. Die 50. Armee war inzwischen durch einen weiteren deutschen Vorstoss vom Rest der Brjansker Front getrennt und weitgehend eingeschlossen. Teilen der Armee gelang es bis zum 17. Oktober auszubrechen; General Petrow galt als verschollen, daher wurde General Jermakow mit dem Kommando der im Raum nördlich von Brjansk eingekreisten sowjetischen 50. Armee betraut.
Sowjetische Verteidigung
Tula liegt etwa 190 Kilometer südlich von Moskau, an beiden Ufern des Flusses Upa, einem rechten Nebenfluss der Oka. Am 22. Oktober wurde das Verteidigungskomitee der Stadt Tula formiert und der Kommissar W. G. Gurjew zum Vorsitzenden ernannt. Im südlichen Vorfeld der Stadt wurden Befestigungen wie Panzerabwehrgräben und Drahtsperren angelegt, für die Arbeiten wurden alle arbeitsfähigen Bewohner herangezogen. Zudem wurde ab 26. Oktober das Arbeiter-Regiment Tula unter Hauptmann A. P. Gorschkow aufgestellt, das die Verteidigungslinie besetzte. Die über die Resseta bei Chwastowitschi ausgebrochenen Teile der 50. Armee (Reste von 8 Schützen-, 1 Kavallerie- und 1 Panzerdivision) zogen sich über Belew führerlos auf Tula zurück. Die auf Jefremow zurückgehenden Reste der sowjetischen 13. Armee (General Gerassimenko), deren Reste sich am 22. Oktober aus der Einkreisung über die Oka zurückgekämpft hatten, nahm die „Operative Gruppe Jermakow“ in ihre Formation auf und besetzte die Linie zwischen Fatesch und Lgov. Generalmajor A. N. Jermakow hatte bereits die Führung der 50. Armee übernommen und sollte Tula verteidigen.
Am 27. Oktober bezog die 50. Arme die am südlichen Stadtrand angelegten Gräben, zusätzlich wurden das Tula-Arbeiterregiment unter Hauptmann Gorschkow, das 156. NKWD-Regiment unter Major S. F. Zubkow und ein Miliz-Bataillon unter Major M. I. Swiridow herangezogen. Das 732. Flak-Regiment unter Major M. T. Bondarenko schützte die Stadt gegen feindliche Luftangriffe. Am 29. Oktober wurden diese Stellungen durch das Artillerie-Regiment 447 unter Oberst A. A. Mawrin verstärkt. Ende Oktober hielt der linke Flügel der Westfront (Armeegeneral Schukow) und die Brjansker Front (Frontkommando am 10. November aufgelöst) mit der 49. Armee und den neu organisierten 3., 13. und 50. Armeen die Frontlinie Beljow-Mzensk-Fatesch-Lgov.
Deutscher Aufmarsch
Am 22. Oktober beauftragte General Guderian die Kampfgruppe Eberbach (Panzer-Reg. 6 und 18, Artillerie-Reg. 75, Schützen-Reg. 3 und Infanterie-Regiment „Grossdeutschland“ der 4. Panzer-Division (Generalmajor von Langermann)), in den Rücken der sowjetischen Verteidigung nördlich von Mzensk vorzustossen. Das XXIV. Armeekorps (mot.) bildete mit der 3. Panzer-Division (Generalmajor Breith) nördlich von Mzensk einen 6 km tiefen Brückenkopf am östlichen Suscha-Ufer. Das XXXXVII. Armeekorps (mot.) stand mit der motorisierten 29. Infanterie-Division noch dahinter im Raum Karatschew. Am 23. Oktober erreichte der Vormarsch des deutschen LIII. Armeekorps den Raum 20 km nordöstlich von Bolchow und nahm Vormarschrichtung auf Tepolje. Die 95. Infanterie-Division des Höheren Kdo. XXXV besetzte die Stadt Fatesch, während am äussersten südlichen Flügel das XXXXVIII. Armeekorps (mot.) (Kempf) mit der 9. Panzer-Division im Vorgehen auf Kursk stand.
Ab Mitte Oktober kam die 2. Panzerarmee nicht mehr voran, und die Verbände der 2. Armee lagen auch fest. Eine geordnete Versorgung war nicht mehr möglich. Dieser Zustand, so bemerkte das Hauptquartier der 2. Armee am 18. Oktober, würde solange andauern, solange die Versorgung nicht neu aufgebaut würde. Auch die nördlicher im Anschluss an das XIII. Armeekorps vorgehende 4. Armee (Generalfeldmarschall von Kluge) kam nicht weiter voran, da sie von ständigen sowjetischen Gegenangriffen bedrängt wurde. Sie stellte das Vorgehen ihres rechten Flügels am 16. Oktober ein. Am 25. Oktober drang die 3. Panzerdivision in den Raum 12 km nordöstlich von Tschern vor und nahm mit der auf der Strasse von Mzensk vorstossenden 4. Panzer-Division wieder Verbindung auf. Das LIII. Armeekorps schloss am 26. Oktober zum Oka-Abschnitt auf. Am 28. Oktober war der Raum Tula erreicht.
Für den Angriff war der rechte Flügel der Heeresgruppe Mitte auf Befehl des Oberbefehlshabers von Bock neu gegliedert worden: Die 2. Armee wurde nach Beendigung der Kesselschlacht von Brjansk an den rechten Flügel der 2. Panzerarmee verlegt. Guderian musste Generaloberst von Weichs die Höheren Kommandos XXXIV. und XXXV., sowie das XXXXVIII. Armeekorps (mot.) abgeben. Die bisher den äussersten linken Flügel deckende 1. Kavallerie-Division wurde nach Ostpreussen abberufen, um dort umgerüstet zu werden. Als Ersatz gebot die 2. Panzerarmee jetzt über zwei Armeekorps aus der bisherigen Front der 2. Armee.
- Armeekorps (General Heinrici) mit der 31. und 131. Inf.Div. im Anmarsch über Bolchow auf den Oka-Abschnitt bei Alexin.
- Armeekorps (mot.) (General Geyr von Schweppenburg) mit der 3. und 4. Panzer-Division, der motorisierten 10. Inf.Div. und Infanterie-Regiment Grossdeutschland im Vorgehen auf Tula
- Armeekorps (General Weissenberger) mit der 112. und 167. Infanterie-Division erreicht den Raum Dansko.
- Armeekorps (mot.) (General Lemelsen) mit der 17. und 18. Panzer-Division, der motorisierten 25. und 29. Inf.Div in der Versammlung zwischen Orel und Mzensk
- Infanterie-Division (Generalleutnant Stemmermann), vorerst noch im Raum Trubtschewsk gebunden.
Vorstoss auf Tula
Seit dem 27. Oktober wurde im Raum Tula verstärkte sowjetische Truppentransporte aus dem Osten beobachtet. Das deutsche LIII. Armeekorps wurde zur Sicherung der rechten Flanke der 2. Panzerarmee gegen die Linie Jepifan—Stalinogorsk vorgeschoben. Durch die bereits wochenlang andauernde Schlammperiode (Rasputiza) war der Zustand der Strasse Orel-Tula katastrophal, die im Raum Jasnaja Poljana vor Tula angelangte 3. Panzer-Division und die Gruppe Eberbach mussten zusätzlich aus der Luft Versorgt werden. Weil ein Frontalangriff auf die Stellungen vor Tula zu verlustreich erschien, wurde General Geyr erlaubt, die Stadt ostwärts in Richtung auf Dedilowo zu umgehen.
Am 29. Oktober stand die deutsche 3. Panzer-Division 5 km vor Tula, das XXXXIII. Armeekorps erreichte den Abschnitt zwischen Odojewo bis westlich Titowa. Die 18. Panzer-Division des XXXXVII. Armeekorps (mot.) löst letzte Teile des XXIV. Armeekorps (mot.) im Raum Orel ab, während sich das LIII. Armeekorps zwischen Arona und St. Gremjatschka vorschob. Am südlichen Abschnitt bei der 2. Armee schob sich das XXXXXVIII. Armeekorps mit der 95. Infanterie-Division und der 9. Panzer-Division (General Hubicki) in den Raum 12 und 18 km nordöstlich von Kursk vor.
Am 30. Oktober übernahm General A. N. Jermakow die direkte Führung der Truppen, die die Stadt Tula von Süden verteidigen, als dessen Chef fungierte Generalmajor W. S. Popow. Am Morgen begannen die deutschen Truppen nach starker Artillerievorbereitung mit Angriffen auf die Stadt, Teile des Dorfes Rogoschinski wurden genommen. Am Abend des Tages traf der Stabschef der Brjansker Front, Oberstleutnant L. M. Sandalow in Tula ein. Das XXIV. Armeekorps (mot.) führte erste Angriffe auf die Stadt und erreichte Dedilowo. Am 31. Oktober wurde diese Angriffe durch die 154. (General J. S. Fokanow) und die 217. Schützen-Division (General K. P. Trubnikow) und andere Teile der 50. Armee abgeschlagen. In Tula trafen zusätzlich die 32. Panzerbrigade (Oberst I. I. Juschuk) und die 34. Garde-Division als Verstärkung ein. Die heftigen Angriffe der deutschen Truppen wurden fortgesetzt, bis sich die Lage Mitte November auf sowjetischer Seite etwas stabilisierte.
Ab dem 2. November wurden die südöstlichen Zugänge nach Tula von der 413. Schützen-Division, (Generalmajor Tereschkow) verteidigt. Die Instandsetzung der Bahnlinie Mzensk – Tula bekam erhöhte Bedeutung, trotz bestem Willen gab es auf deutscher Seite nur langsame Fortschritte. Als die Vorhut des LIII. Armeekorps Teploje erreichte, stiessen sie auf starken Feind. Es handelte sich um eine Kräftegruppe mit 2 Kavallerie- und 5 Schützen-Divisionen sowie einer Panzerbrigade, die längs der Strasse Jefremow-Tula mit der Absicht vorgingen, den vor Tula festliegenden Verbänden des XXIV. Panzerkorps in die Flanke und Rücken zu stossen. Die Truppen des XXXXIII. Armeekorps erreichten am 5. November den Raum östlich von Kurakowa— Woskressenskoje – südlich Bogutscherowo. Die deutsche 112. Infanterie-Division (LIII. A.K.) gewann etwa 6 km Raum nach Osten. Zur Verstärkung wurde, die bei Mzensk versammelte, 17. Panzer-Division dem XXIV. Armeekorps (mot.) unterstellt und über Plawskoje nach Tula dirigiert.
Am 8., 9. und 10. November kam es zu stärkeren Gegenangriffen der Verteidiger von Tula, welche ihre Positionen verbessern konnten. Die deutsche 18. Panzer-Division parierte dagegen, indem sie aus dem Raum 5 km südöstlich von Rajewo nach Norden in den Rücken des Angreifers vorging. Der linke Flügel des XXXXIII. Armeekorps stiess in den Raum 7 km südlich von Alexin vor und erreichte den Raum nordöstlich Pewschino bis 10 km nordöstlich Dugna. Die Deutschen vor Tula wurden durch sowjetische Gegenstösse wieder aus dem Dorf Rogoschinski und vom Gelände der dortigen Ziegelei vertrieben. Das bereits geschwächte XXIV. Armeekorps (mot.) musste infolgedessen in Verteidigung übergehen.
Wechselhafte Kämpfe
Am 10. November wurde die Brjansker Front aufgelöst, die 50. Armee wurde als linker Nachbar der 50. Armee Teil der Westfront. Die direkte Verteidigung von Tula wurde Generalmajor J. S. Fokanow übertragen. Am 12. November erreichte das deutsche LIII. Armeekorps an der Linie Rajewo-Tepolje-Marjino-Zarewo-Mostowaja, die unterstellte 112. Infanterie-Division (General Mieth) errichtete einen weiteren Brückenkopf über die Upa. Die 18. Panzer-Division drang in den Raum östlich von Tschern vor, ihre Vorausabteilung nahm den Vorort Nikolskoje.
Am 11. November wurde der erkrankte Oberbefehlshaber der 2. Armee, Generaloberst von Weichs durch General der Panzertruppen Schmidt ersetzt. Am 18. November gelang die Einnahme von Jepifan durch Truppen des XXXXVII. Armeekorps (mot.) und von Dedilowo durch Einheiten des XXIV. Armeekorps (mot.). Am Abend des gleichen Tages brachen die deutschen Truppen mit Luftunterstützung durch die sowjetischen Linien und entwickelten ihre Offensive in Richtung auf Stalinogorsk und Wenew. Trotz schwerer Verluste durch Pak-Stellungen erreichten die Panzer am 22. November den Durchbruch auf Stalinogorsk, die Bedrohung Moskaus aus dem Südosten wurde bedrohlich. Am selben Tag wurde auf Anordnung des Kommandanten der Westfront, der im Raum Tula befehlende General Jermakow entlassen, am 19. Dezember verhaftet und vor das Kriegsgericht gestellt.
Am 23. November nahm die 10. Infanterie-Division (mot.) Michailow, die 29. Infanterie-Division (General Fremerey) überschritt den Don-Abschnitt und gewann über Jepifan nach Norden über 40 km Boden. Die 18. Panzer-Division drang über das Dorf Skopin nach Gorlowo vor, die nachgezogene 296. Infanterie-Division griff erfolglos gegen Tula an.
Am 24. November umfasste die deutsche 17. Panzerdivision (Oberst Rudolf Eduard Licht) Tula aus dem Osten und drängte die dortigen Verteidiger in nördliche Richtung auf Wenew zurück. Allerdings gelang es durch Gegenstösse aus dem Raum Kaschira die deutschen Truppen zwischen Tula und Wenew zu stoppen, die Front der 2. Panzerarmee war jetzt auf über 200 km erweitert. Teilen der deutschen 17. Panzerdivision gelang es am 25. November in den südlichen Rand der Stadt einzubrechen, wo sie vom einem Bataillon Flakartillerie unter Major A. P. Smirnow der 173. Schützen-Division gestoppt werden konnte. Auf Entscheidung des Kriegsrates wurde das 2. Kavalleriekorps und die 112. Panzerdivision (Oberst Getman) sofort aus dem Raum Serpuchow herangeführt und im Raum Kaschira konzentriert.
Am 25. November näherte sich die vorgeschobene Kampfgruppe der 17. Panzer-Division Kaschira. Rechts davon nahm die 134. Infanterie-Division Liwny ein. Am 26. November gelang es der 167. Infanterie-Division (General Schönhärl) und der motorisierten 29. Infanterie-Division, die bei Iwanozero östlich des Don stehende sibirische 239. Schützendivision einzuschliessen, die jedoch schon in der folgenden Nacht durch die dünnen Linien der 29. Infanterie-Division (mot.) wieder ausbrechen und nach Osten entkommen konnte.
Am 26. November erreichte das LIII. Armeekorps den Don, überschritt den Fluss bei Iwanozero mit der 167. Infanterie-Division und griff nordostwärts des genannten Ortes, bei Donskoje (Lipezk) die dort stehenden Sibirier an. Die deutsche Division nahm 42 Geschütze und eine Anzahl Fahrzeuge und brachte 4 000 Gefangene ein. Von Osten her umfasste die 29. Infanterie-Division (mot.) die Masse der sibirischen 239. Schützen-Division, welche aber nach Osten ausbrechen konnte. Ab 27. November folgten Gegenangriffe der 173. Schützen- und 112. Panzerdivision, zusammen mit der 9. Panzerbrigade (Oberst I. F. Kiritchenko) und unterstützt durch Flugzeuge der Luft- und Luftverteidigungszone von Moskau wurde die 17. Panzerdivision bis 30. November zurückgeworfen. Der rechte Flügel der deutschen 4. Armee (XIII. Armeekorps) versuchte in Richtung Serpuchow, Lopasnja und Podolsk einen Entlastungsangriff anzusetzen, welcher die sowjetischen Truppen nördlich und westlich von Serpuchow einkreisen und vernichten sollte. Am 27. November griff auch das XXXXIII. Armeekorps aus dem Raum Alexin an. Der rechte Flügel der 50. Armee (jetzt unter General I. W. Boldin) führte nördlich von Tula einen Gegenangriff, welcher das deutsche XXIV. Armeekorps (mot.) im Raum Kostrow, 25 km nördlich von Tula aufhalten konnte.
Letzter deutscher Angriff auf Tula
Anfang Dezember fanden die Kämpfe bei bereits −30 Grad Kälte statt, die östliche Flanke der 2. Panzerarmee, das XXXXVII. Armeekorps (mot.) (10. Infanterie-Division (mot.) und 18. Panzerdivision) hatte eine etwa 180 km breite Front zu decken. Auch die südlich folgende 2. Armee musste mit 6 Infanteriedivisionen einen überdehnten Frontabschnitt halten und konnte keine Kräfte für die Offensive im Frontbogen von Tula freimachen. Am 1. Dezember begann auch die deutsche 4. Armee neue Angriffe, weiter südlich erneuerte die 2. Panzerarmee am 2. Dezember ihre Offensive nördlich von Tula, Ziel war noch immer, die Stadt zu umgeben und abzuschneiden. Das XXIV. Armeekorps (mot.) brach in die gegnerische Verteidigung ein: Die 299. Schützen-Division wurde durch die 4. Panzer-Division bei Rudnewo zurückgedrängt, die 3. Panzer-Division gewann im Kampf gegen die 413. Schützen-Division den Ort Torschowo. Südlich Tula gewann das Infanterie-Regiment „Gr.D.“ im Kampf mit der 159. Schützen-Division den Ort Dubki. Im Süden bei der 2. Armee, führte das XXXIV. Armeekorps (General Metz) einen Angriff gegen die sowjetische 13. Armee, indem die 134. Infanterie-Division (Generalleutnant Cochenhausen) beiderseits Liwny und die 45. Infanterie-Division (General Schlieper) über den Sosna-Abschnitt auf Jelez angreifen liess. Das XXXXVIII. Armeekorps (mot.) versuchte auf Tim vorzugehen. Am 3. Dezember erreichte die 4. Panzer-Division das Dorf Kostrowo und wurde durch die sowjetische 108. Panzerbrigade gestoppt. Während die bei Wenew eingesetzte 25. Infanterie-Division (mot.) den Widerstand der 239. Schützen-Division nicht brechen konnte. Die Truppen der sowjetischen 50. Armee im Nordosten von Tula mussten den Bahnhof von Rewjakino aufgeben, welche die Eisenbahnlinie von Tula nach Moskau verband. Der nördliche Korridor von Tula war auf etwa 15 Kilometer eingeengt. Der bedrohte Abschnitt wurde vom Schützenregiment 999 der 258. Schützen-Division und einer Panzerkompanie eisern gehalten. Die sowjetische 290. und 217. Schützen-Division verhinderten das Zustandekommen der Verbindung der Kampfgruppe Eberbach (4. Panzerdivision) mit der von Nordwesten angreifenden 131. Infanterie-Division (Generalleutnant Meyer-Bürdorf) des XXXXIII. Armeekorps.
Am 5. Dezember wurde die auf 350 km Front ausgedehnte Front der 2. Panzerarmee in die Verteidigung gedrängt. Nachdem sie ihre offensiven Fähigkeiten erschöpft hatten, begannen Einheiten der 2. Panzerarmee sich von dem gefährlichen Kamm nordöstlich von Tula zur Eisenbahnlinie Tula-Uslowaja zurückzuziehen. Sowjetische Luftangriffe gaben einen Hinweis darauf, dass ein Gegenschlag drohte und von sowjetischen Verstärkungen abgelenkt wurde. In der Gegend von Rjasan und im Nordwesten wurden durch die deutsche Luftaufklärung 30 Lokomotiven mit Truppentransporten festgestellt, gleichzeitig wurden bei Dankow weitere 400 LKW und 5 Lokomotiven erkundet. Schon am 4. und 5. Dezember folgten Gegenangriffe durch die sowjetische 112. Panzerdivision (Oberst Andrei L. Getman), welcher die deutschen Truppen aus dem Dorf Kostrowo wieder hinausdrängte und die Bahnstadion Rewjakino-Station freikämpfte. General Guderian erkannte die grosse Bedrohungen seiner Flanken, die Schwäche seiner Kräfte und gab den Befehl zum Rückzug.
Sowjetische Gegenoffensive und Folgen
Ein letzter Angriff gegen Tula wurde in der Nacht des 7. Dezember von Kräften der 296. Infanterie-Division aus dem westlichen Upa-Bogen geführt. Der Angriff gegen den westlichen Stadtrand auf Maslowo gegen den Hofweiler „Mjasnovo“ wurde mit schweren Verlusten für das Infanterie-Regiment 521 abgewiesen. Der Kommandierende General des erfolglosen LIII. Armeekorps, General der Infanterie Weisenberger war bereits am 28. November durch General Fischer von Weikersthal ersetzt worden. Schon Ende November verstärkte sich der sowjetische Druck an der Nordflanke der 2. Panzer-Armee bei Kaschira und Michailow, wo die Stawka begann, eine neue 10. Armee zu etablieren, welche dann bei der folgenden Gegenoffensive die Führung innehatte.
Am 8. Dezember gingen die Truppen der sowjetischen 10. und 50. Armee zur Gegenoffensive über. Das 1. Garde-Kavalleriekorps (vorher bis 26. November als 2. Kavalleriekorps bezeichnet) unter General Pawel A. Below durchbrach die dünnen deutschen Linien. Die erst am 5. Dezember von der 134. Infanterie-Division besetzte Stadt Jelez, wurde am 9. Dezember von der 148. Schützendivision (Oberst Filip M. Tscherokmanow) der 13. Armee zurückerobert. Der deutsche Versuch, Tula als Sprungbrett für den Angriff auf das südliche Vorfeld von Moskau zu benützen war gescheitert. Hitler lehnte am 16. Dezember Absetzbewegungen ab und formulierte in einer Führerweisung vom 18. Dezember neue Richtlinien der Kampfführung und zwang dadurch die Truppen, „fanatisch“ in ihren Stellungen auszuhalten. Generaloberst Guderian musste eine Woche später den Oberbefehl über die 2. Panzerarmee abgeben. Ab Weihnachten 1941 führte Generaloberst Rudolf Schmidt die 2. Panzerarmee und die 2. Armee in Personalunion bis zum 15. Januar 1942, als die Rückmeldung des Generalobersten von Weichs das Kommando wieder teilte.
Schlacht um Sewastopol (30.10.1941 – 04.07.1942)
Die Schlacht um Sewastopol (russisch Севастопольская оборона) war eine Schlacht, die vom 30. Oktober 1941 bis zum 4. Juli 1942 an der deutsch-sowjetischen Front im Zweiten Weltkrieg um den befestigten Seehafen Sewastopol geschlagen wurde.
Vorgeschichte
Die deutsche 11. Armee unter General der Infanterie Erich von Manstein erreichte im Herbst 1941 die Halbinsel Krim und versuchte zwischen dem 30. Oktober und Anfang November erfolglos, Sewastopol einzunehmen. Am 4. November wurde der Sewastopoler Verteidigungsbezirk unter Filipp Sergejewitsch Oktjabrski (1899–1969), Befehlshaber der Schwarzmeerflotte, gegründet. Die sowjetische Küstenarmee wurde von Generalmajor Iwan Petrow befehligt. Dieser Bezirk umfasste rund 50.000 Mann, 170 Geschütze, und 90–100 Flugzeuge. Die Hauptkräfte der Schwarzmeerflotte begaben sich Anfang November zu Häfen an der kaukasischen Küste. Etwa 15.000 Einwohner der Stadt meldeten sich zur Landwehr.
Erste Angriffe (November 1941 bis Mai 1942)
Am 11. November begannen vier Infanteriedivisionen, eine motorisierte Abteilung und eine rumänische motorisierte Brigade mit etwa 60.000 Mann eine erste Offensive auf Sewastopol. Der Hauptangriff wurde in Richtung Balaklawa und der Hilfsangriff entlang des Kara-Kobja-Tals geführt. Sie stiessen jedoch nur ein bis vier Kilometer vor und gingen dann ab 21. November zur planmässigen Belagerung über. Am 17. Dezember wurde die zweite Offensive eröffnet. Sieben deutsche Infanteriedivisionen und zwei rumänische Gebirgsjäger-brigaden (1275 Geschütze, 150 Panzer und bis zu 300 Flugzeuge) griffen Richtung Nordbucht und der Hilfsangriff Richtung Inkerman entlang des Flusses Tschernaja an.
Der Bezirk wurde durch zwei Schützendivisionen und eine Brigade verstärkt, die über das Meer transportiert worden waren. Unterstützt von angekommenen Schiffen und Flugzeugen führten sowjetische Truppen einen Gegenschlag durch und warfen die Achsenmächte in der Hauptrichtung zurück.
Wegen der am 25. Dezember begonnenen Kertsch-Feodossijaer Operation, einer sowjetischen Gegenoffensive im Osten der Krim, zog die Wehrmacht ihre Kräfte von Sewastopol ab. Bei Gegenschlägen der Roten Armee in Sewastopol von Januar bis März 1942 wurden die Achsenmächte an einigen Abschnitten zurückgeworfen. Ende Mai 1942 wurde die Halbinsel Kertsch mit dem Unternehmen Trappenjagd von der Wehrmacht eingenommen, was Sewastopols Lage verschlechterte.
Unternehmen Störfang (Juni bis Juli 1942)
Unter dem Decknamen Unternehmen Störfang wurde Anfang Juni 1942 der zweite grossangelegte Versuch zur Eroberung der Festung Sewastopol gestartet. Um Sewastopol wurden dann fast die gesamten Kräfte der 11. deutschen Armee mit 7½ Divisionen und die rumänische 3. Armee mit 1½ Divisionen konzentriert, zusammen etwa 200.000 Mann. Artillerieunterstützung erfolgte durch 24 Werferbatterien, 81 schwere und 66 leichte Batterien mit insgesamt etwa 600 Geschützen. Es wurde schwerste Artillerie mit Kaliber bis zu 800 mm eingesetzt, darunter das Eisenbahngeschütz Dora und zwei Mörser der Baureihe Karl. Die Luftwaffe trat mit dem VIII. Fliegerkorps unter Generaloberst Wolfram von Richthofen mit sieben Kampf-, drei Stuka- und vier Jagdgruppen an (etwa 600 Flugzeuge).
Anfang Juli hatten sowjetische Truppen hier nach einigen Verstärkungen eine Stärke von 106.000 Mann und verfügten über 600 Geschütze und Mörser (darunter die stark gepanzerte Küstenbatterie Maxim Gorki I und Küstenbatterie Maxim Gorki II mit je vier 30,5-cm-Geschützen), sowie 38 Panzer und 53 Flugzeuge.
Ab dem 27. Mai wurde Sewastopol pausenlos durch Luftwaffe und die Artillerie bombardiert. Vom 2. bis zum 7. Juni wurde starke Artillerie- und Luftvorbereitung durchgeführt. Am 7. Juni morgens begann der Angriff am Boden auf einer Frontbreite von 35 Kilometern. Der Hauptangriff wurde in Richtung Ostufer der Nordbucht gerichtet und der Hilfsangriff über die Sapun-Höhen in Richtung der südöstlichen Randgebiete Sewastopols. Angesetzt waren am südlichen Abschnitt das XXX. Armeekorps unter General der Artillerie Maximilian Fretter-Pico mit der 72. und 170. Infanterie-Division sowie der 28. leichte Infanterie-Division zwischen Balaklawa und Komary gegen die Sapun-Höhen. Am mittleren Abschnitt bei Tschorgun das rumänische Gebirgs-Korps mit der rumänischen 1. und 18. Division mit Stossrichtung auf Inkerman. Im nördlichen Abschnitt das LIV. Armeekorps unter General Erik Hansen mit der 22., 24., 50. und 132. Infanterie-Division in Richtung zur Sewernaja-Bucht. Durch die Abwehr der deutsch-rumänischen Angriffe in den ersten fünf Tagen reduzierten sich die Munitionsvorräte der Verteidiger. Im Laufe des Angriffes erlitt die 132. Infanterie-Division derart hohe Verluste, so dass sie vollständig aus dem Gefecht genommen werden musste. Männern des Pionier-Bataillons 24 gelang es, das Fort „Maxim Gorki I“ mitsamt seinen weitläufigen unterirdischen Bunkeranlagen zu sprengen. Am 17. Juni eroberten das Infanterieregiment 31 die Forts „GPU“, „Molotow“ und „Tscheka“. Drei Tage später fielen das Nordfort und die Konstantinowski-Batterie, mit der die Hafenanlagen kontrolliert wurden. Am 18. Juni erreichten die Achsenmächte die Nordbucht, Inkerman und den Sapun-Berg. Munition und die Nahrungsmittel wurden den Verteidigern nur in geringem Umfang durch sowjetische U-Boote geliefert. Am 29. Juni drangen deutsche Truppen in die Stadt und am 30. Juni auch an anderen Abschnitten ein und griffen Malachow-Kurgan an. Am Abend des 30. Juni zogen sich die sowjetischen Truppen von dort zurück. Zum 1. Juli blockierten die Achsenmächte die Küste vom Meer, die auch in Reichweite deutscher Artillerie lag, und begannen die Stadt zu besetzen. Nur wenige Rotarmisten konnten evakuiert werden. Mit der Einnahme der Halbinsel Chersones wurde die Eroberung der Krim am 4. Juli 1942 beendet. Generaloberst Erich von Manstein wurde am 1. Juli zum Generalfeldmarschall ernannt. Für Angehörige der Wehrmacht, die an den Kämpfen auf der Krim 1941/1942 teilnahmen, wurde der Krimschild gestiftet.
Viele deutsche Frontkämpfer waren vom Heroismus der sowjetischer Verteidiger beeindruckt. Ein zeitgenössischer Bericht hielt fest:

„Man kann über eine solche Haltung nur immer wieder staunen, es ist im wahrsten Sinne des Wortes unglaublich. So haben sie auf der ganzen Linie die ganze Zeit Sewastopol vereidigt und deshalb war das eine arg harte Nuss. Das ganze Land musse mit Bomben buchstäblich erst umgepflügt werden, ehe sie ein Stück zurückwichen“.
Der Vertreters des Auswärtigen Amtes bei der 11. Armee Otto von Hentig schrieb in einem Bericht am 6. Juli 1942:

„Welche Kräfte waren es, die den Russen zu solchen Leistungen befähigten? Dass die Leistungen ungeheuerlich waren, wird gerade von den Frontsoldaten anerkannt. Wie oft habe ich nicht voll Staunen gehört: ‚Das hätte kein Franzose und kein Engländer, das hätten wir nicht mal ausgehalten!“ Die Pistole des Politruks oder des Kommandanten kann es nicht allein gewesen sein, was die Leute vorwärtstrieb oder zum Aushalten veranlasste“.
Als Berichte von Frontsoldaten über den Widerstand der Sowjetsoldaten auch in Rundfunk und Presse erschienen, verbot Propagandaminister Joseph Goebbels kurzerhand jede positive Hervorhebung des sowjetischen Gegners, unter dem Hinweis, dass es sich „beim Widerstand der Bolschewisten überhaupt nicht um Heldentum und Tapferkeit“ sondern allein um die „durch einen wildwütigen Terror zur Widerstandskraft organisierte primitive Animalität des Slawentums“ handele. Und er fand es „ausserordentlich gefährlich“ das zum Ausdruck gekommen sei, „dass auch die Sowjets eine Idee hätten, die sie zum Fanatismus und heroischem Widerstand begeisterten und sie vor keinen Entbehrungen und Anstrengungen im Interesse der Kriegführung zurückschrecken liessen“.
Folgen
Nach der schweren Schlacht waren in der Stadt nur noch neun Gebäude unbeschädigt. Der Berliner Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung berichtete wenige Tage später:

„Die Stadt Sewastopol selbst, die an der Reede prachtvoll gelegen ist, bietet das Bild trostloser Verwüstung. Sie muss von Grund auf neu gebaut werden. Es steht […] kein Haus mehr, das bewohnbar wäre. Die Häuser sind entweder ausgebrannt oder […] nur noch Trümmerhaufen […]“.