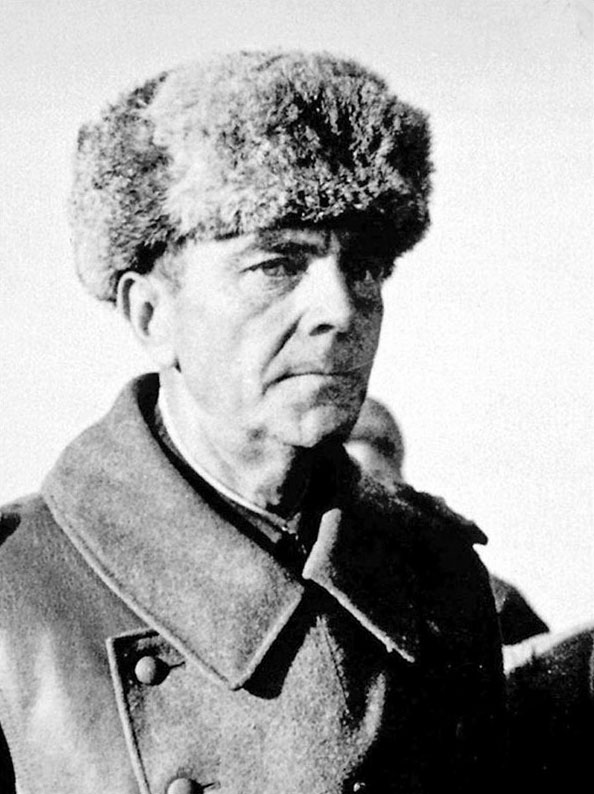Hitlers Feldmarschälle, Heer Teil 2
Datenherkunft: (Wikipedia)
aus-der-zeit.site > Hitler, Albtraum und Verbrecher
HEER
Generalfeldmarschall Walter von Reichenau
Walter von Reichenau (* 8. Oktober 1884 in Karlsruhe; † 17. Januar 1942 auf dem Lufttransport von Poltawa nach Lemberg) war ein deutscher Heeresoffizier (seit 1940 Generalfeldmarschall). Er war seit 1933 federführend bei der Eingliederung der Reichswehr in den NS-Staat tätig. Während des Zweiten Weltkrieges war Reichenau als Armee- und Heeresgruppenoberbefehlshaber an führender Stelle an Kriegsverbrechen in der Sowjetunion beteiligt.
Kaiserreich und Erster Weltkrieg
Walter von Reichenau war der Sohn des späteren preussischen Generalleutnants Ernst August von Reichenau (1841–1919). Einer seiner Brüder war Ernst von Reichenau. Nach dem Abitur 1903 trat er in die Preussische Armee ein. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges war Reichenau Adjutant des 1. Garde-Feldartillerie-Regiments und in dieser Stellung wurde er noch im Verlauf des Jahres 1914 zum Hauptmann befördert und mit dem Eisernen Kreuz II. und I. Klasse ausgezeichnet. Im folgenden Jahr wurde er zum Generalstab versetzt und im Lauf des Jahres 1915 diente er als Zweiter Generalstabsoffizier (Ib) der 47. Reserve-Division sowie anschliessend als Erster Generalstabsoffizier (Ia) der 7. Kavallerie-Division.
Weimarer Republik
In der Zeit vom Waffenstillstand bis zu seiner Übernahme in die Reichswehr war Reichenau Generalstabsoffizier beim Grenzschutz Ost in Schlesien und Pommern.
Bis Anfang der 1930er Jahre wurde Reichenau in verschiedenen Stellungen verwendet. 1924 wurde er zum Major und 1929 zum Oberstleutnant befördert. Seit 1930 war er Chef des Stabs im ostpreussischen Wehrkreis I / 1. Division, dessen Befehlshaber Werner von Blomberg, der spätere Reichswehrminister war. Am 1. Februar 1932 erfolgte die Beförderung zum Oberst.
Er heiratete im April 1919 Alexandrine Gräfin Maltzan Freiin zu Wartenberg und Penzlin (1895–1984).
Rolle im Sport
Bis zum Ersten Weltkrieg war von Reichenau als Leichtathlet aktiv, später spielte er Tennis und fuhr Ski. Als Leichtathletiktrainer in Münster entdeckte er Hans Hoffmeister, den deutschen Meister im Diskuswurf von 1926, 1930 und 1931 und Olympiateilnehmer von 1928. Zudem war er ein begeisterter Fussballspieler. Als Mitglied des Berliner SC lernte er Carl Diem kennen, dem er freundschaftlich verbunden blieb. Gemeinsam entwickelten die beiden Männer das Konzept des Sportabzeichens und waren dann auch die ersten beiden Absolventen. Er gehörte dem Organisationskomitee der Spiele 1936 in Berlin an und wurde anschliessend auf Betreiben von Diem Mitglied des IOC.
Für Reichenau war der Sport „nur Mittel zum Zweck, nicht eigentliches Ziel“. Dieses Ziel war die Vorbereitung der militärischen Ausbildung mit Breitensport, denn „ein guter Sportsmann ist ein guter Soldat“. Besondere Bedeutung mass er den Mannschaftssportarten zu, da sie die „Unterordnung des Einzelwillens unter den Gesamtwillen“ fördern würden. Sein Ideal war eine Nivellierung von Standesunterschieden durch den Sport. Aber auch als „Sportgeneral“, wie er genannt wurde, konnte er seine Vorstellungen in der Wehrmacht nicht durchsetzen.
Zeit des Nationalsozialismus
Vorkriegszeit
Bereits vor der Machtergreifung knüpfte Reichenau Kontakte zur NSDAP wie zu Adolf Hitler selbst, mit dem er im April 1932 – wahrscheinlich erstmals – eine persönliche Unterredung geführt hatte. Ab 1933 ging auch Reichenaus Karriere voran: Mit der Ernennung Blombergs zum Reichswehrminister wurde er am 1. Februar 1933 unter Ernennung zum Generalmajor Chef des Ministeramtes im Reichswehrministerium. In dieser Position kündigte er die politische Neutralität, die die Reichswehr gegenüber allen Regierungen der Weimarer Republik gezeigt hatte, auf und formulierte die Parole: „Hinein in den neuen Staat, nur so können wir die uns gebührende Position behaupten“. Am 1. Februar 1934 wurde er im Zuge der Umstrukturierung der Reichswehr Chef des neugeschaffenen Wehrmachtamtes und blieb damit engster Berater Blombergs.
Zunächst hatte Reichenau keinerlei Berührungsängste gegenüber der SA, mit der er schon 1933 im ostpreussischen Grenzschutz gut zusammengearbeitet hatte. Im Juni 1933 legte er Pläne für einen „Wehrstaat“ vor, in dem die gesamte Jugend in Wehrsport, vormilitärischer Ausbildung und Wehrpflicht militärisch gedrillt werden sollte. In diesem Konzept sollte die SA die gesamte Rekrutenausbildung übernehmen. Er handelte mit dem SA-Chef Ernst Röhm aus, dass seine Organisation das Reichskuratorium für Jugendertüchtigung übernehmen sollte, eine bereits 1932 gegründete Tarnorganisation zur Aufrüstung. Sie sollte künftig dem SA-Obergruppenführer Friedrich-Wilhelm Krüger unterstehen. Mit diesem Konzept brach Reichenau mit der traditionellen Vorstellung vom Militär als „Schule der Nation“. Die künftige Reichswehr stellte sich der modern und pragmatisch denkende General vielmehr als Organisation der bewaffneten Spezialisten der Kriegführung vor. Die SA-freundliche Haltung Reichenaus zeigte sich auch in seiner Weisung vom Oktober 1933 an die Wehrkreiskommandos, die Interessen der SA möglichst zu berücksichtigen.
Erst im Februar 1934 geriet Reichenau mit Röhm in Konflikt, dem er unterstellte, die Kompetenz für Mobilmachung und Kriegsführung für seine Truppe zu verlangen und der Reichswehr nur die militärische Ausbildung überlassen zu wollen. Damit schien die Monopolstellung der Reichswehr als einzigem „Waffenträger der Nation“ bedroht. Daher drängte Reichenau gemeinsam mit Blomberg am 27. Juni 1934 Hitler zum Handeln: Die SA musste entmachtet werden, ebenso die konservativen Eliten um Vizekanzler Franz von Papen, die einer völligen Machteroberung der Nationalsozialisten noch im Wege standen. Als Papen um eine Audienz bei Reichspräsident Paul von Hindenburg für den 28. Juni 1934 nachsuchte, versetzten Blomberg, Reichenau und Reinhard Heydrich, der Chef des Sicherheitsdiensts der SS ihre Truppen in Alarmbereitschaft. Am 29. Juni 1934 wurden in den Röhm-Morden der Führungskader der SA ermordet, ebenso mehrere konservative Gegner des Regimes und die Reichswehrgeneräle Kurt von Schleicher und Ferdinand von Bredow, beide Amtsvorgänger Reichenaus als Chef des Ministeramts. Reichenau gehörte mit Hermann Göring und dem Reichsführer SS Heinrich Himmler zu dem „furchtbaren Triumvirat […], das an diesem 30. Juni 1934 über Leben und Tod entschied“: Die drei Männer gingen gemeinsam Namenslisten durch und entschieden durch Kopfschütteln oder Nicken, wer sterben musste.
Nach Hindenburgs Tod am 2. August 1934 befahlen Blomberg und Reichenau allen Reichswehrangehörigen, einen persönlichen Treueeid auf Hitler abzulegen, ohne dass es dafür eine gesetzliche Grundlage gab. Ihnen kam es darauf an, das Bündnis zwischen Reichswehr und Führer noch enger zu schmieden und konkurrierende Machtansprüche von Partei und SS abzuwehren.
Reichenau war massgeblich am Aufbau der Wehrmacht und ihrem Einbau in den nationalsozialistischen Staat beteiligt. Am 1. Oktober 1935 wurde er zum Kommandierenden General des VII. Armeekorps und des Wehrkreises VII in München ernannt, verbunden mit der Beförderung zum Generalleutnant. Ein Jahr darauf erfolgte die Beförderung zum General der Artillerie. Im Jahr 1938 wurde Reichenau im Zusammenhang mit der Blomberg-Fritsch-Krise mit der Führung des Heeresgruppenkommandos IV in Leipzig betraut. Er war als Befehlshaber der 10. Armee am Einmarsch in das Sudetenland und später an der „Zerschlagung der Rest-Tschechei“ beteiligt.
Reichenau, der seit seiner ersten Begegnung mit Hitler 1931 zu dessen Bewunderern zählte, „propagierte und förderte“ die Eingliederung der Reichswehr in das nationalsozialistische System wie „kein Zweiter“. Deshalb wird er von Historikern auch als (erster) „politischer General“ bezeichnet. Er bekannte sich öffentlich zur „nationalsozialistischen Wehrmacht“, verlangte von Soldaten nationalsozialistische Weltanschauung und die Wahrung der „ewigen Werte unsres Volkstums von Blut und Rasse“. Trotz dieser Bekenntnisse soll er nach Angaben seiner Mitarbeiter selbst kein überzeugter Nationalsozialist gewesen sein. Vielmehr zielte seine Militärpolitik darauf ab, den Berufsoffizieren eine starke Stellung im „wehrfreudigen“ NS-System zu sichern.
Zweiter Weltkrieg
Am Überfall auf Polen nahm Reichenau als Oberbefehlshaber der 10. Armee, der Schwerpunkt-Stossarmee auf Warschau, teil. Am 30. September 1939 erhielt er das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes, mit dem 1. Oktober 1939 wurde er zum Generaloberst befördert.
Im Westfeldzug 1940 kommandierte Reichenau die 6. Armee und nahm in dieser Stellung die Kapitulation Belgiens entgegen. Am 19. Juli 1940 wurde er nach dem Sieg über Frankreich zum Generalfeldmarschall ernannt.
Ab Beginn des Unternehmens Barbarossa unterstand Reichenau die 6. Armee der Heeresgruppe Süd. Dabei kämpfte sie unter anderem im September 1941 in der Schlacht um Kiew. Aufgrund Hitlers Unzufriedenheit mit Gerd von Rundstedt wurde Reichenau am 1. Dezember 1941 an Rundstedts Stelle zum Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Süd an der Ostfront ernannt. Sein Nachfolger bei der 6. Armee wurde auf Reichenaus Empfehlung, für viele überraschend, sein früherer Stabschef Friedrich Paulus.
Kriegsverbrechen in der Sowjetunion
Im Krieg gegen die Sowjetunion propagierte Reichenau als überzeugter Anhänger Hitlers den „Weltanschauungskrieg“ gegen „Bolschewisten“ und Juden. Er befehligte anfänglich die 6. Armee. In dieser Funktion trug er (Mit-)Verantwortung für Massaker in seinem Verantwortungsbereich: Am 22. August 1941 befahl Reichenau die Ermordung von 90 jüdischen Kindern in Belaja Zerkow, deren Eltern man erschossen hatte. Als der Offizier der Wehrmacht Helmuth Groscurth unter Umgehung des Dienstweges über das Schicksal der zunächst verschont gebliebenen Kinder eine eigene Entscheidung des Armeeoberkommandos verlangte, bestätigte Reichenau, dass auch die Kinder zu erschiessen seien.
Aufgrund enger Kontakte zum Führer des Sonderkommandos 4a, SS-Standartenführer Paul Blobel, kam es ausserdem zur engen Zusammenarbeit zwischen Wehrmacht und Sonderkommando beim grössten Massaker in der besetzten Sowjetunion während des Zweiten Weltkriegs, dem Massaker von Babyn Jar, bei dem über 33’000 Juden innerhalb von zwei Tagen erschossen wurden (29./30. September 1941). Angehörige der Wehrmacht bewachten den Ort während des Mordens und bedeckten nach dem Massaker durch Sprengungen die Leichen mit Erde.
Am 10. Oktober 1941 erliess er den so genannten „Reichenau-Befehl“, der bis hinunter auf die Ebene der Kompanien verteilt und vorgelesen wurde:

„[…] Das wesentlichste Ziel des Feldzuges gegen das jüdisch-bolschewistische System ist die völlige Zerschlagung der Machtmittel und die Ausrottung des asiatischen Einflusses im europäischen Kulturkreis. Hierdurch entstehen auch für die Truppe Aufgaben, die über das hergebrachte einseitige Soldatentum hinausgehen. Der Soldat ist im Ostraum nicht nur ein Kämpfer nach den Regeln der Kriegskunst, sondern auch Träger einer unerbittlichen völkischen Idee und der Rächer für alle Bestialitäten, die deutschem und artverwandtem Volkstum zugefügt wurden. […] Deshalb muss der Soldat für die Notwendigkeit der harten, aber gerechten Sühne am jüdischen Untermenschentum volles Verständnis haben. Sie hat den weiteren Zweck, Erhebungen im Rücken der Wehrmacht, die erfahrungsgemäss stets von Juden angezettelt wurden, im Keime zu ersticken. […]“
Adolf Hitler bezeichnete den Reichenau-Befehl als „ausgezeichnet“ und befahl allen Armeeoberbefehlshabern an der Ostfront, Reichenaus Beispiel zu folgen.
Tod
Am 14. Januar 1942 erlitt Reichenau nach einem Waldlauf bei minus 40 Grad Celsius einen schweren Schlaganfall. Auf dem Lufttransport zur Behandlung nach Deutschland am 17. Januar 1942 starb Reichenau im Flugzeug zwischen Poltawa und Lemberg. Er wurde auf dem Berliner Invalidenfriedhof beigesetzt.
1944 erhielten seine Nachkommen eine Dotation an Grundbesitz im Wert von 1,01 Millionen Reichsmark.
Generalfeldmarschall Erwin Rommel
Johannes Erwin Eugen Rommel (* 15. November 1891 in Heidenheim an der Brenz; † 14. Oktober 1944 in Herrlingen) war ein deutscher Generalfeldmarschall in der Zeit des Nationalsozialismus. Sein Einsatz während des Afrikafeldzugs in Nordafrika brachte ihm den Beinamen „Wüstenfuchs“ ein.
Die NS-Propaganda förderte gezielt die Entstehung des „Mythos Rommel“, der auch noch das heutige Bild Rommels prägt. Rommels Einstellung zum Nationalsozialismus sowie sein Verhältnis zur Widerstandsgruppe vom 20. Juli 1944 sind umstritten.
Rommel wurde 1891 als zweites von vier Kindern des Oberrealschullehrers und späteren Rektors Erwin Rommel und dessen Frau Helene, geborene Luz (seit 1880 von Luz), in Heidenheim an
der Brenz geboren und wuchs in Aalen auf. Von 1900 bis 1908 besuchte er dort die Lateinschule, anschliessend von 1908 bis 1910 das Realgymnasium Schwäbisch Gmünd (heutiges Parler-Gymnasium). 1910 trat er in die Württembergische Armee ein.
Ab 1912 hatte Rommel eine Liebesbeziehung mit Walburga Stemmer aus Weingarten, die im Dezember 1913 die gemeinsame Tochter Gertrud zur Welt brachte. Im November 1916 heiratete Rommel Lucie Maria Mollin (1894–1971), die er 1911 während eines Kriegsschullehrgangs in Danzig kennengelernt hatte. Die uneheliche Tochter Gertrud wuchs bei ihrer Grossmutter auf. Rommel und seine Frau kümmerten sich um das Mädchen, das als Rommels Nichte ausgegeben wurde. Im Dezember 1928 kam ihr Sohn Manfred Rommel zur Welt. Walburga Stemmer starb im Oktober 1928. Die Kinder von Gertrud, Rommels Enkel, liessen sich im Allgäu nieder.
Rommels Frau war eine Nichte des polnischen Priesters Edmund Roszczynialski in Neustadt in Westpreussen bei Danzig. Dieser galt nach der deutschen Eroberung Polens als verschollen. Auf Bitten seiner Frau erkundigte sich Rommel nach dem verfolgten Onkel. Er wurde von der Bürokratie hingehalten und musste ihr ein Jahr später mitteilen, dass nichts herausgefunden wurde. Roszczynialski war am 30. Oktober 1939 durch die Gestapo verhaftet worden und wurde knapp zwei Wochen später, am 11. oder 12. November, in der Nähe von Cewice, wahrscheinlich im Wald von Piaśnic, erschossen.
Im Oktober 1943 zog die Familie Rommel aus Wiener Neustadt kommend nach Herrlingen. Sie bezog dort ein Gebäude, das als „Haus Breitenfels“ bzw. „Martin-Buber-Haus“ Teil des im Frühjahr 1939 aufgelösten jüdischen Landschulheims war. Diese unter der Leitung des Berliner Pädagogen Hugo Rosenthal stehende reformpädagogische Einrichtung war 1926 von Anna Essinger gegründet worden, die im Herbst 1933 mit ihren Zöglingen nach England geflohen war. Die Bewohner des in diesen Gebäuden Mitte 1939 eingerichteten jüdischen Zwangs-Altersheims waren 1941/42 deportiert worden.
Das Propagandaministerium dichtete Rommel eine andere Lebensgeschichte an, die im April 1941 in der Wochenzeitung Das Reich abgedruckt wurde. Darin wurde er als Arbeitersohn dargestellt, der als einer der ersten SA-Führer nationalsozialistische Überzeugungen aus einem persönlichen Verhältnis zu Hitler gewonnen habe. Rommel selbst beschwerte sich über diese falsche Vita.
Militärische Laufbahn
Deutsches Kaiserreich und Erster Weltkrieg
Rommel, der eigentlich Flugzeugingenieur werden wollte, wurde von seinem Vater vor die Wahl gestellt, entweder Lehrer oder Offizier zu werden. Rommel entschied sich für eine Militärlaufbahn. Nachdem er von der Artillerie und den Pionieren abgelehnt worden war, trat er am 19. Juli 1910 als Fahnenjunker in das Infanterie-Regiment „König Wilhelm I“. (6. Württembergisches) Nr. 124 im oberschwäbischen Weingarten ein. Zwischen März und November 1911 absolvierte er den obligaten Lehrgang an der Kriegsschule in Danzig.
Am 27. Januar 1912 wurde Erwin Rommel zum Leutnant befördert und war nun im Rahmen der Rekrutenausbildung in Weingarten tätig. Zum 1. März 1914 wurde er für fünf Monate zur 4. Batterie des Feldartillerieregiments Nr. 49 nach Ulm kommandiert. Mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges am 1. August 1914 kämpfte er mit seinem alten Regiment im Raum Longuyon, an der Maas und westlich von Verdun. Im September 1914 erhielt er das Eiserne Kreuz zweiter Klasse, im Januar 1915 folgte das Eiserne Kreuz erster Klasse. Am 18. September 1915 wurde er zum Oberleutnant befördert.
Ab Oktober 1915 war Rommel unter Theodor Sproesser Kompanieführer beim württembergischen Gebirgsbataillon, das zunächst im Stellungskrieg in den Hochvogesen und 1916 dann an der rumänischen Front kämpfte. Ende September 1917 wurde Rommels Bataillon an die Isonzo-Front verlegt und nahm am Gebirgskrieg teil. Unter Rommels Beteiligung gelang zunächst der Einbruch in die Kolovrat-Stellung und in der Schlacht von Karfreit Ende Oktober 1917 die Erstürmung des Monte Matajur. Mitte November nahm Rommel an der Einnahme von Longarone teil. Für seinen Einsatz erhielt Rommel im Dezember den Orden Pour le Mérite ohne die sonst übliche vorherige Verleihung des Hausordens von Hohenzollern. Vor der Verleihung hatte sich Rommel beschwert, da der Erfolg am Matajur zunächst einem Offizier einer anderen Einheit angerechnet worden war. In seinem 1937 veröffentlichten Buch Infanterie greift an berichtete Rommel ausführlich über seinen Einsatz im Ersten Weltkrieg.
Im Januar 1918 wurde Rommel Ordonnanzoffizier im württembergischen Generalkommando z. b. V. 64 in Friedrichshafen, wo er am 18. Oktober zum Hauptmann befördert wurde. Nach dem Kriegsende kehrte er gegen Weihnachten 1918 zur 7. Kompanie des Infanterieregiments Nr. 124 nach Weingarten zurück
Weimarer Republik
Der Versailler Vertrag legte fest, dass die Heeresstärke der Reichswehr hunderttausend Mann nicht übersteigen durfte. Von den Massenentlassungen blieb Rommel verschont: Er konnte beim Militär bleiben.
Im März 1919 führte Rommel die württembergische Sicherheitskompanie 32 in Friedrichshafen. Am 25. Juni 1919 wurde er Kompaniechef im Schützen-Regiment „Alt-Württemberg“ (1. Württ.) Nr. 25. Am 18. Oktober wurde er auf die neue Weimarer Verfassung vereidigt. 1919 und 1920 befand Rommel sich im Einsatz gegen Aufständische in Lindau, im Münsterland und in Westfalen. 1924 war er im Stab des II. Bataillons des 13. Infanterie-Regiments eingesetzt, von 1925 bis 1929 war er Chef der 4. (MG) Kompanie dieses Regiments.
Von Oktober 1929 bis September 1933 war Rommel Inspektionschef und Lehrer an der Infanterieschule in der Dresdener Albertstadt, der heutigen Offiziersschule des Heeres. Am 1. April 1932 wurde er zum Major ernannt.
Zeit des Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg
Wie viele andere Mitglieder der Reichswehr nahm auch Rommel die Machtergreifung der Nationalsozialisten positiv auf. Er war der Ansicht, dass es nach den Jahren der politischen Unruhe wieder eine klare Führungspersönlichkeit gebe. Dies galt umso mehr, als Adolf Hitler die Revision des Versailler Vertrags forderte und auch durchsetzte. Die Aufwertung, Vergrösserung und Modernisierung des Militärs durch Hitler stiessen auf die Zustimmung der Soldaten, deren soziales Ansehen nach dem Ersten Weltkrieg ebenso gelitten hatte wie die zentrale Position des Militärs im Staat. Mit Unbehagen reagierten Rommel und andere Offiziere jedoch auf die Rolle, welche die als Konkurrenz empfundene SA unter dem neuen Regime spielte. Die Ausschaltung der SA im Juni 1934 wurde daher auch von Rommel positiv bewertet. Die vom NS-Staat vorangetriebene Aufrüstung der Wehrmacht implizierte bessere Karriereperspektiven für Offiziere.
Rommel begegnete Hitler erstmals Ende September 1934, als dieser das Herbstmanöver der 5. Division auf der Schwäbischen Alb besuchte. Am 1. Oktober 1933 wurde Rommel als Kommandeur des III. Bataillons („Goslarer Jäger“) des 17. Infanterieregiments nach Goslar versetzt, wo er bis Mitte Januar 1935 blieb. Im Jahr 1934 erschien Rommels Buch für die Ausbildung Gefechts-Aufgaben für Zug und Kompanie: Ein Handb. f. d. Offizierunterricht. Dieses Buch wurde bis 1945 in fünf Auflagen mit Überarbeitungen und Titeländerungen gedruckt.
Mitte Oktober 1935 wurde Rommel, der am 1. Januar 1935 zum Oberstleutnant befördert worden war, Lehrgangsleiter an der neuen Kriegsschule in Potsdam, die er im November 1938 wieder verliess. Während dieser Zeit verfasste er sein Buch Infanterie greift an, das bis 1945 in einer Auflage von ungefähr 400’000 Exemplaren erschien. Vom 21. Februar 1937 bis zum 31. August 1938 war Rommel ausserdem im Nebenamt Verbindungsoffizier der Wehrmacht zum Reichsjugendführer. Anfang Oktober 1937 wurde Rommel zum Oberst befördert.
Als (friedensmässiger) Lehrgangsleiter hatte Rommel eine Mobilisierungsverwendung als Kommandeur des Führerbegleitbataillons. Als solcher wurde er erstmals beim Reichsparteitag der NSDAP in Nürnberg im September 1936 eingesetzt, ebenso beim Anschluss Österreichs im März 1938 und kurz danach während des Einmarsches in das Sudetenland im Oktober 1938. In der Folge war Rommel vom 10. November 1938 bis 22. August 1939 kurzzeitig Kommandeur der Kriegsschule in Wiener Neustadt.
Während der Zerschlagung der Rest-Tschechei und beim Einmarsch ins Memelland im März 1939 war Rommel als Kommandeur des Begleitbataillons zugleich auch Kommandant des Führerhauptquartiers.
Polen- und Frankreichfeldzug
Während des Überfalls auf Polen, der den Beginn des Zweiten Weltkriegs darstellte, war Rommel vom 23. August 1939 bis zum 14. Februar 1940 abermals Kommandant des Führerhauptquartiers. Hitler ernannte ihn rückwirkend zum 1. August 1939 zum Generalmajor.
Nach dem Polenfeldzug kam Hitler Rommels Wunsch nach, eine Panzerdivision zu führen, indem er ihn im Februar 1940 in Bad Godesberg zum Kommandeur der 7. Panzer-Division ernannte. Rommel hatte bis dahin zwar keinerlei praktische Erfahrung in der Führung von Panzerverbänden, erwies sich im „Fall Gelb“ in Frankreich mit seiner eigenwilligen Vorne-Führung aber als erfolgreich. Die Unvorhersehbarkeit und Geschwindigkeit seiner Operationen irritierten nicht nur seine Gegner, sondern auch das deutsche Oberkommando. Sie brachte seiner Division den Beinamen „Gespensterdivision“ ein. Rommels Verband stiess bei Dinant über die Maas vor, durchbrach die verlängerte Maginotlinie und rückte an den La-Bassée-Kanal vor. Am 27. Mai 1940 wurde ihm dafür das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen.
Einsatz in Libyen und Ägypten
Im September 1940 hatte Italien von Italienisch-Libyen aus eine Invasion in das mit Grossbritannien verbündete Königreich Ägypten begonnen. Die britische Gegenoffensive ab Anfang Dezember 1940 liess die italienische 10. Armee zusammenbrechen und führte bis zum 8. Februar 1941 zum vollständigen Verlust der Cyrenaika. Unter diesem Eindruck einigten sich Benito Mussolini und Hitler im Verlauf des Januars auf eine direkte deutsche Unterstützung in Libyen. Diese sollte neben zusätzlichen Luftwaffenverbänden aus einem Panzerkorps mit zwei Divisionen bestehen.
Rommel, der im Januar 1941 zum Generalleutnant befördert worden war, wurde für das Kommando von Hitler persönlich gegen den Widerstand des Oberbefehlshabers des Heeres Walther von Brauchitsch ausgesucht. Am 12. Februar 1941 erreichte Rommel im Rahmen des Unternehmens Sonnenblume Tripolis und wurde mit Wirkung zum 15. Februar zum Befehlshaber der deutschen Truppen in Nordafrika ernannt. Sein Auftrag war, Italien bei der Verteidigung zu unterstützen, einen britischen Vorstoss auf Tripolis zu verhindern und bis zum 20. April einen Plan für die Rückeroberung der Cyrenaika vorzulegen. An sich war das deutsche Afrikakorps dem italienischen Oberbefehlshaber vor Ort unterstellt, doch die deutsche Führung hatte sichergestellt, dass das Korps nur als kompletter Verband eingesetzt werden durfte, was Rommel taktische und operative Freiheiten gab, die er extensiv nutzte. Schon am 3. April 1941 sollte er mit General Italo Gariboldi in Konflikt geraten, als er gegen dessen Willen einen Aufklärungsvorstoss nach Adschdabiya zu einer Gegenoffensive ausbaute. Der italienische Operationsstab drohte mit seinen strategischen Planungen „in das Schlepptau der Initiativen Rommels zu geraten“.
Rommel wartete nur die Ankunft der ersten seiner beiden Divisionen ab: Mit den ersten in Afrika eingetroffenen Abteilungen der 5. Leichten Division (mot.), später in die 21. Panzer-Division umgegliedert, rückte Rommel rasch an der Mittelmeerküste entlang nach Osten vor und erreichte am 16. Februar Sirte, während der britische Generalstab davon ausging, es werde „beträchtliche Zeit verstreichen, bevor von Tripolis aus eine ernst zu nehmende Gegenoffensive gestartet werden kann“. Das Gebiet von El Agheila, wo die Briten am 8. Februar den Vormarsch ihrer Operation Compass abgebrochen hatten, erreichte Rommel am 22. Februar. Zwei Tage darauf kam es dort zum ersten Gefecht mit einer britischen Einheit, den King’s Dragoon Guards.
Am 20. März 1941 empfing Rommel bei einem Besuch in Deutschland für seinen Einsatz in Frankreich und Libyen aus der Hand Hitlers als zweiter Soldat des Heeres das Eichenlaub zum Ritterkreuz. Am 24. März gelang ihm bei einem Aufklärungsvorstoss überraschend die Besetzung von El Agheila, obwohl das Oberkommando des Heeres ihn vorher mehrfach angewiesen hatte, auf das Eintreffen der 15. Panzer-Division zu warten. Da die Briten die Enigma-Verschlüsselung entschlüsselt hatten, hörten sie die wiederholten Wartebefehle an Rommel ab und erwarteten keine weiteren Schritte von seiner 5. Leichten Division. Daher gelangen ihm weitere Vorstösse und mit der Unterstützung zweier nach Afrika verlegter italienischer Divisionen bis zum 10. April die Rückeroberung der Cyrenaika bis zur Festung Tobruk sowie die Einschliessung der Stadt. Seine folgenden Angriffe auf Tobruk scheiterten (vgl. Belagerung von Tobruk). Nicht zuletzt die Verlegung britischer Kräfte des Nahost-Kommandos nach Griechenland wegen des Balkanfeldzugs hatte Rommels Erfolg ermöglicht.
Ein weiterer Vormarsch war ohne die Eroberung Tobruks nicht möglich. Ein Versuch dazu wurde von Rommel Anfang Mai nach dem Eintreffen der noch fehlenden 15. Panzerdivision unternommen. Rommel und seinen Truppen gelang es, eine britische Gegenoffensive Mitte Mai und eine weitere grössere Gegenoffensive der Alliierten Mitte Juni (Operation Battleaxe) zurückzuschlagen.
Insgesamt war der deutsche Einsatz in Nordafrika von Nachschubproblemen geprägt. Die Hauptursache dafür war die bevorzugte Versorgung der deutschen Truppen im Krieg gegen die Sowjetunion, der im Juni 1941 mit dem Unternehmen Barbarossa begonnen hatte. Die Nachschublieferungen für die Häfen Tripolis und Benghazi litten stark unter britischen Marine- und Luftangriffen, da die Versorgungsrouten und -termine den Briten durch die Entschlüsselung der Enigma bekannt waren. Zudem wurde die deutsche Eroberung Maltas, des Stützpunktes der Nachschubbehinderung, immer wieder verschoben. Die operativen Einschränkungen, die sich daraus ergaben, nahm Rommel nicht hinreichend zur Kenntnis beziehungsweise bezog sie nicht in die weitere offensive Operationsführung ein.
Im Juli 1941 wurde Rommel zum General der Panzertruppe befördert. Im September wurde er zum Befehlshaber der Panzergruppe Afrika ernannt, welche die gesamten – grösstenteils italienischen – Achsenstreitkräfte in der Cyrenaika umfasste. Einem für den 23. November 1941 geplanten weiteren Angriff Rommels auf Tobruk kam am 18. November die britische Grossoffensive Crusader zuvor. Bis zum 31. Dezember mussten sich Rommels Truppen bis hinter die El-Agheila-Linie zurückziehen.
Am 20. Januar 1942 wurde Rommel als erster Soldat des Heeres mit den Schwertern zum Ritterkreuz mit Eichenlaub ausgezeichnet. Indem die Panzergruppe Afrika zur Panzerarmee Afrika aufgewertet wurde, war Rommel ab 22. Januar 1942 nun Armee-Oberbefehlshaber. Ende Januar unternahm Rommel die zweite Cyrenaika-Offensive, bei der die britische 1. Panzerdivision überrollt und die 8. Armee bis zum 7. Februar wieder bis Gazala/Bir Hacheim zurückgedrängt wurde. Rommel wurde daraufhin am 1. Februar 1942 zum Generaloberst befördert.
Am 26. Mai begann Rommel die Gazala-Offensive. Während er zeitweise am Rand einer völligen Niederlage stand, gelang es ihm Mitte Juni, die gesamten britischen Panzerkräfte vor Tobruk zu besiegen. Am 21. Juni 1942 eroberte Rommels Armee schliesslich die Stadt. Dafür wurde er am folgenden Tag zum Generalfeldmarschall befördert. Mit 50 Jahren war er zu diesem Zeitpunkt der jüngste Inhaber dieses Ranges in der Wehrmacht.
Im Juli 1942 fand die erste Schlacht von El Alamein statt, die in einer Pattsituation endete. Auf britischer Seite wurde Claude Auchinleck Mitte August durch General Alexander als Oberbefehlshaber Nahost und durch General Bernard Montgomery als Befehlshaber der 8. Armee ersetzt. Ein zweiter Versuch Rommels, die alliierten Stellungen zu durchbrechen, wurde in der Schlacht von Alam Halfa Ende August/Anfang September verhindert. Rommel litt zu diesem Zeitpunkt bereits an Magenbeschwerden, meldete dem OKH am 22. August, dass er krank sei und schlug Generaloberst Heinz Guderian als seinen Nachfolger vor. Zwei Tage später wurde er jedoch in Kenntnis gesetzt, dass zurzeit kein geeigneter Panzergeneral verfügbar sei. Ein Notfallplan sah vor, dass Albert Kesselring das Oberkommando über den afrikanischen Kriegsschauplatz übernehmen sollte, während Walther Nehring die Rolle als Oberbefehlshaber der Panzerarmee und Gustav von Vaerst das Kommando über das Afrikakorps innehaben sollte. Daraufhin antwortete Rommel, dass er sich nun zwar gesund genug fühle, die Operation zu leiten, dass er jedoch anschliessend eine grössere Pause in der Heimat benötige. Der Angriff der Achsenmächte auf Alexandria und dann Kairo war damit gestoppt. Von Ende September bis Ende Oktober hielt Rommel sich aus gesundheitlichen Gründen in Deutschland auf. Seine Vertretung übernahm der General der Panzertruppe Georg Stumme.
Am 23. Oktober begannen die Alliierten unter General Montgomery ihre Gegenoffensive und zwangen Rommel in der zweiten Schlacht von El Alamein zum Rückzug. Trotz erheblicher Verluste wies Hitler Rommel in einem Durchhaltebefehl vom 3. November an, mit allen Mitteln eine Niederlage abzuwenden. Rommel, der nicht mehr an einen Sieg in Nordafrika glaubte, widersetzte sich dem Befehl und zog seine Armee zurück, nachdem die britischen Truppen unter Montgomery die Linien bei El Alamein durchbrochen hatten. Am 8. November 1942 landeten schliesslich britische und amerikanische Streitkräfte im Rahmen der Operation Torch in Französisch-Nordafrika.
Einsatz in Tunesien
Nach dem Rückzug nach Tunesien kam die Front im Westen Tunesiens und im Osten zur libysch-tunesischen Grenze zum Erliegen. Die britische 8. Armee stoppte ihren Vormarsch vor der Mareth-Linie, um ihren Nachschub nachrücken zu lassen. Dieses Zeitfenster nutzte Rommel. Nach seinem Plan sollte die britische 1. Armee durch eine Umfassungsbewegung zwischen der tunesischen Grenze, Constantine und Bône eingekesselt werden. Dies führte zur Schlacht am Kasserinpass. Obwohl diese Schlacht einen taktischen Erfolg bedeutete, wurde das strategische Ziel verfehlt, die in Algerien stehenden alliierten Kräfte zu vernichten und damit den Zweifronten-Krieg zu vermeiden. Diese Schlacht war der letzte Erfolg Rommels in Afrika. Zu Rommels Ungunsten unterblieb ein gemeinsames Achse Oberkommando in Tunesien, was die strategischen Ziele erschwerte, da beide Armeen völlig autonom agierten. Während im Norden die 5. Panzerarmee unter Hans-Jürgen von Arnim vorsichtig und zögerlich agierte, hatte Rommels südliche Armee die Hauptlast des Angriffes zu leisten. Dauerhafte Erinnerung schuf er sich dabei bei der United States Army, da (unter anderem) die amerikanische 1. Panzerdivision bei ihrer ersten Konfrontation in moderner mobiler Kriegsführung trotz quantitativer und qualitativer Überlegenheit eine herbe Niederlage erlitt. Der britische Historiker Paul Kennedy bezeichnet die Niederlage der amerikanischen Landstreitkräfte bei Kasserine als „demütigendste Niederlage“ (neben der Schlacht um die Philippinen) im gesamten Krieg. Am 23. Februar 1943 wurde Rommel Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Afrika. Als die Niederlage der deutschen Truppen abzusehen war, verliess Rommel am 6. März Afrika: Der von der deutschen Bevölkerung verehrte Rommel, der vom NS-Regime gezielt als Propagandafigur eingesetzt wurde, sollte nicht mit der Niederlage in Verbindung gebracht werden. Am 11. März verlieh Hitler Rommel für seinen Einsatz in Afrika die Brillanten zum Ritterkreuz mit Eichenlaub und Schwertern. Rommel war der erste Soldat des Heeres, der diese exklusive Auszeichnung erhielt. Erst nachdem Mitte Mai 1943 Rommels Nachfolger Generaloberst Hans-Jürgen von Arnim bei Tunis kapituliert hatte, erfuhr die Öffentlichkeit, dass Rommel Afrika bereits im März verlassen und eine weitere Auszeichnung erhalten hatte. Zuvor war es wegen der Befehlsmissachtung Rommels erstmals zu Spannungen zwischen Hitler und Rommel gekommen, die sich erst auflösten, als sich Rommels Einschätzung der nicht mehr abzuwendenden Niederlage in Nordafrika schliesslich bestätigte.
Einsatz in Italien
Rommel war vom 20. Mai bis zum 12. Juli 1943 als Leiter eines nach ihm benannten Arbeitsstabes mit den Vorbereitungen für die deutschen Gegenmassnahmen beim erwarteten Kriegsaustritt Italiens befasst. Als im Juli die Alliierten in der Operation Husky auf Sizilien landeten, wurde ihm am 15. Juli der Oberbefehl über die Heeresgruppe B übertragen. Nach der Absetzung Mussolinis im Juli begann unter Rommels Kommando die Besetzung Italiens. Während er die Truppen in Norditalien anführte, war in Süditalien Albert Kesselring zuständig. Im September landeten alliierte Truppen auf dem italienischen Festland. Daraufhin wurde am 8. September der Waffenstillstand von Cassibile bekanntgegeben.
Am 23. September 1943 gab Rommel die Weisung:

„Irgendwelche sentimentalen Hemmungen des deutschen Soldaten gegenüber badogliohörigen Banden in der Uniform des ehemaligen Waffenkameraden sind völlig unangebracht. Wer von diesen gegen den deutschen Soldaten kämpft, hat jedes Anrecht auf Schonung verloren und ist mit der Härte zu behandeln, die dem Gesindel gebührt, das plötzlich seine Waffen gegen seinen Freund wendet. Diese Auffassung muss beschleunigt Allgemeingut aller deutschen Truppen werden“.
Entgegen den Bestimmungen des Genfer Abkommens von 1929 wurden rund 1’070’000 entwaffnete italienische Soldaten als „Militärinternierte“ deklariert und zur (für Kriegsgefangene zulässigen) Zwangsarbeit in der deutschen Kriegswirtschaft verpflichtet (die Regierung Badoglio erklärte Deutschland erst am 13. Oktober auf Druck der Alliierten den Krieg). Rommels Befehl vom 1. Oktober 1943 hierzu lautete:

„Dieser Krieg ist ein totaler Krieg. Soweit die Männer Italiens nicht mehr die Gelegenheit haben, mit der Waffe für die Freiheit und Ehre ihres Vaterlandes zu kämpfen, haben sie die Pflicht, ihre volle Arbeitskraft in diesem Kampf einzusetzen“.
Einsatz am Atlantikwall
Im November 1943 wurde die Heeresgruppe B unter ihrem Oberbefehlshaber Rommel nach Frankreich verlegt. Rommel wurde ausserdem mit der Überwachung der Verteidigungsmassnahmen am Atlantikwall beauftragt. In dieser Funktion war er Hitler direkt unterstellt und baute mit Durchsetzungswillen und Organisationsgeschick die Befestigungen an der Küste aus. Seine taktische Kreativität zeigte sich dabei unter anderem am Einsatz einfacher Hindernisse aus Baumstämmen gegen Landungsboote und Lastensegler. Die Soldaten benannten einzeln eingegrabene Baumstämme als „Rommelspargel“.
Anfang Januar 1944 übernahm Rommel das Kommando über alle deutschen Truppen nördlich der Loire. Unterstellt war er dabei dem Oberbefehlshaber West, Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt. Zwischen ihm und Rommel kam es zu Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Frage, wo die alliierte Invasion stattfinden und wie man sie am effektivsten bekämpfen könnte.
Im März 1944 unterzeichnete Rommel wie alle anderen Generalfeldmarschälle eine Loyalitätserklärung gegenüber Hitler, obwohl er diese als unnötig empfand, da seiner Ansicht nach ein einmal gegebenes soldatisches Treuegelöbnis ohnehin dauerhaften Bestand habe. Vom 4. bis zum 6. Juni hielt Rommel sich anlässlich des Geburtstags seiner Frau zu einem Kurzurlaub in Süddeutschland auf. Als die alliierte Invasion am D-Day, dem 6. Juni, doch stattfand, kehrte Rommel an die Front zurück. Sowohl in persönlichen Besprechungen mit Hitler im Juni 1944 als auch in seinem Schreiben „Betrachtungen zur Lage“ vom 15. Juli machte Rommel deutlich, dass er einen Sieg der deutschen Truppen für unwahrscheinlich hielt: „Die Truppe kämpft allerorts heldenmütig, jedoch der ungleiche Kampf neigt dem Ende entgegen. Es ist m.E. nötig, die [politischen] Folgerungen aus dieser Lage zu ziehen“. Sein Generalstabschef Hans Speidel, der dem Widerstand nahestand, konnte Rommel überzeugen, das Wort „politischen“ zu streichen. Am 17. Juli wurde Rommel bei Sainte-Foy-de-Montgommery bei einem Tieffliegerangriff schwer verwundet und in das Luftwaffenlazarett Bernay überführt. Am 1. August trat Rommel in Paris zum letzten Mal bei einer Pressekonferenz auf, um Gerüchte der ausländischen Presse über seinen Tod zu zerstreuen. Rommel musste seinen Oberbefehl über die Heeresgruppe niederlegen und hielt sich anschliessend zur Erholung in seinem Haus in Herrlingen auf.
Rommel und die nationalsozialistische Ideologie
Die Frage nach der Einstellung Rommels zur nationalsozialistischen Ideologie ist schwer zu beantworten und droht von der Darstellung seiner militärischen Karriere und des mit ihm verbundenen Mythos verdeckt zu werden. Zwar war Rommel nie Mitglied der NSDAP, er akzeptierte aber widerspruchslos die Etablierung des nationalsozialistischen Systems und machte in der Wehrmacht Karriere.
In der Literatur wird immer wieder von dem engen Verhältnis zwischen Hitler und Rommel gesprochen. Hitler förderte Rommels Karriere persönlich. Als Kommandant des Führerhauptquartiers befand er sich schon früh in direkter Nähe des Diktators. Beide Männer sollen einander respektiert und sich äusserst gut verstanden haben. Rommel galt allgemein als Hitlers „Lieblingsgeneral“. Laut Albert Kesselring übte er auf Hitler einen „fast hypnotischen Einfluss“ aus. Goebbels notierte im Oktober 1942 nach einem Gespräch mit Hitler:

„Rommel hat auf ihn [Hitler] einen sehr tiefen Eindruck gemacht. […] Er ist weltanschaulich gefestigt, steht uns Nationalsozialisten nicht nur nahe, sondern ist ein Nationalsozialist […]“.
Maurice Philip Remy weist darauf hin, dass Rommel Hitler und das von diesem etablierte Regime bewunderte und ihm widerspruchslos diente. Diese Haltung solle man aber nicht mit einer nationalsozialistischen Überzeugung gleichsetzen, zumal Rommel sich mit der NS-Ideologie wenig beschäftigt zu haben scheine. Die Loyalität Rommels gegenüber Adolf Hitler wird in der Literatur wiederholt betont und Rommel als „überzeugter Anhänger“ und „bedingungsloser Gefolgsmann Hitlers“ beschrieben. In einem Brief an seine Frau vom 2. September 1939 schwärmte Rommel: „Es ist doch wunderbar, dass wir diesen Mann haben“.
Hitler bemühte sich, Rommel durch Gunstbeweise, beispielsweise persönliche Gespräche oder die Teilnahme an wichtigen Besprechungen, an sich zu binden. Rommel dankte es ihm mit Bewunderung und Gehorsam: „Seine [Hitlers] Anerkennung zu finden für mein Tun und Handeln ist das Höchste, was ich mir wünschen kann“. An anderer Stelle schrieb er: „Bin viel mit dem F[ührer] zusammen oft bei intimen Besprechungen. Dies Vertrauen ist für mich die grösste Freude, mehr als mein Generalsrang“. Teilweise scheint Rommel dabei die Bedeutung seiner Person für Hitler überschätzt zu haben.
Im Rahmen seines Einsatzes in Nordafrika kam es erstmals zu Spannungen zwischen Rommel und Hitler. Rommel, der bisher immer Hitlers militärisches Verständnis bewundert hatte, musste erkennen, dass Hitler seine Lagebeurteilungen nach anderen Kriterien vornahm als er selbst. Während Rommel seine eigenen Einschätzungen nach militärstrategischen Gesichtspunkten vornahm, sah er bei Hitler ideologische Gründe vorherrschen. Ungewöhnlich scharf verurteilte er Hitlers Agieren in Bezug auf Nordafrika: „Mir wurde es klar, dass Adolf Hitler die wahren Verhältnisse nicht sehen wollte und sich gefühlsmässig gegen das wehrte, was sein Verstand ihm sagen musste“. Weitere Spannungen gab es, als Rommel nach dem D-Day Mitte 1944 zu der Auffassung gelangte, der Krieg sei nicht mehr zu gewinnen, und Hitler bat, aus dieser Lageeinschätzung Konsequenzen zu ziehen. Er verkannte dabei jedoch den Charakter des von den Nationalsozialisten begonnenen Kriegs (Totaler Krieg).
In der Literatur wird daher immer wieder betont, wie wenig Rommel sich mit der nationalsozialistischen Ideologie auseinandergesetzt und wie unkritisch er sich den politischen Verhältnissen angepasst habe. Rommel wird als „politisch naiv“ eingeschätzt, als jemand, der nicht in der Lage oder willens war, „politische Tatbestände differenziert wahrzunehmen“. Rommels Selbstverständnis als Soldat beinhaltete auch, sich nicht politisch zu äussern. Weil er Hitler bewunderte und sich als loyalen Soldaten verstand, ignorierte oder übersah er den verbrecherischen Charakter des Regimes. Rommel habe „niemals Hitlers Strategie und Kriegführung begriffen“, so Reuth. Diese Einschätzung teilt auch Fraser: „Gleichwohl war er politisch naiv. Hitler beeindruckte ihn besonders, ohne dass er – entweder aus Unwissenheit oder vorsätzlich – dessen verbrecherische Seite zur Kenntnis nahm“. Wie zutreffend diese Forschungspositionen sind, verdeutlicht folgende Episode: Rommel soll 1943 Hitler zu bedenken gegeben haben, dass es dem Ansehen Deutschlands im Ausland gut täte, wenn auch ein Jude zum Gauleiter ernannt würde. Hitler reagierte mit den Worten: „Mein lieber Rommel, Sie haben nichts von dem verstanden, was ich will“.
Laut dem Militärhistoriker Peter Lieb sei Rommel zwar „Goebbels’ Lieblingsgeneral“, aber „kein Nazi“ gewesen. Auch die britischen und amerikanischen Gegner hätten ihm Fairness bescheinigt. Zudem seien Rommel weder Kriegsverbrechen noch antisemitische Äusserungen nachzuweisen. Er habe verbrecherische und unsinnige Befehle Hitlers mehrfach „nicht befolgt“ und scheine auch Dotationen des Diktators „nicht angenommen“ zu haben. Nach der Landung der Alliierten in der Normandie hielt Rommel den Krieg für verloren und forderte „im Gegensatz zu vielen anderen Generalen“ Hitler zu „politischen Konsequenzen“ auf, was aus Sicht des Diktators ein „ungeheuerlicher Vorgang“ war. Briefe, in denen er sich als treuer Gefolgsmann Hitlers ausgab, müssten „quellenkritisch“ gelesen werden, da Rommel eine Überwachung durch die Gestapo oder den SD befürchten musste.
Rommel und der Widerstand
Rommels Name wurde und wird immer wieder mit dem Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 in Verbindung gebracht. Insgesamt wird heute aber betont, dass Rommel nicht an den Planungen und der Ausführung des Attentats beteiligt war. Keine Einigkeit herrscht jedoch hinsichtlich der Frage, ob er vom geplanten Attentat wenigstens Kenntnis hatte oder zumindest ahnte, dass die Ermordung Hitlers geplant war.
In einem Brief an seine Frau vom 24. Juli 1944 äusserte sich Rommel ablehnend gegenüber dem gescheiterten Attentat: „Zu meinem Unfall hat mich das Attentat auf den Führer besonders stark erschüttert. Man kann Gott danken, dass es so gut abgegangen ist“. Ob er damit seine wahre Meinung darlegte oder ob er sich mit diesem Schriftstück lediglich entlasten wollte, bleibt unklar.
Generalleutnant Hans Speidel war im April 1944 als Stabschef zu der von Rommel geleiteten Heeresgruppe B gekommen. Sein inoffizieller Auftrag war es, Rommel für den Widerstand zu gewinnen. Anfang Juli 1944 wurde ausserdem Caesar von Hofacker zu Rommel geschickt, um zu klären, ob dieser sich dem Widerstand anschliessen wollte. Hofacker, der den Umsturzversuch in Paris leitete, wurde nach dessen Misslingen verhaftet und gefoltert. Noch Anfang September besuchte Speidel Rommel in Herrlingen und berichtete ihm, dass er von seinem Posten als Stabschef der Heeresgruppe B abgesetzt worden war. Rommels Name wurde in den Unterlagen des ehemaligen Leipziger Oberbürgermeisters Carl Friedrich Goerdeler gefunden, der ebenfalls dem Widerstand angehörte. Insgesamt gibt es aber weiterhin Unklarheiten darüber, wie genau die belastenden Aussagen zustande kamen. Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass es in der Wehrmachtführung durchaus ein Interesse daran gab, Rommel auszuschalten. „Wegen seiner steilen Karriere, seiner Popularität und vor allem aufgrund der Gunst, die er bei Hitler genoss, hatte er viele Feinde in der Wehrmacht“.
Nach dem Krieg veröffentlichte Speidel, der im Gegensatz zu von Hofacker zwar ebenfalls verhaftet, doch nicht zum Tode verurteilt worden war, das Buch 1944. Ein Beitrag zu Rommels und des Reiches Schicksal, in dem er Rommel als Mitglied des Widerstandes darstellte. Rommels Witwe veröffentlichte 1950 Aufzeichnungen ihres Mannes und erklärte ausserdem, dass das soldatische Selbstverständnis ihres Mannes ihm jegliche politischen Aktivitäten versagt hätte: „Er war während seiner ganzen Laufbahn immer Soldat und nie Politiker“. Er sei daher nicht am Widerstand beteiligt gewesen.
Helmut Krausnick rechnete Rommel bereits 1953, als das Attentat vom 20. Juli 1944 in Deutschland noch umstritten war, zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Über das Militärische hinaus habe Rommel „auch die Untergrabung des Rechtsstaates durch die Methoden der Gestapo, die Masslosigkeit Hitlers im menschlichen, militärischen und staatlichen Bereich, seine Unterdrückung der Kirchen und seine Ausrottungspolitik gegen die Juden, seine Verachtung jeder echten Humanität überhaupt“ beunruhigt. Er habe Hitlers Verhaftung und Verurteilung geplant, um den Diktator durch eine Ermordung nicht zum Märtyrer zu machen, was auch andere Widerstandskämpfer unterstützten. Von den anderen Personen des 20. Juli 1944 unterscheide den Generalfeldmarschall „keine abweichende innere Haltung, sondern allenfalls der Zeitpunkt seiner Erkenntnis und die Frage der Form einer Ausschaltung Hitlers als Person“. Rommels Wandlung zum Gegner Hitlers besitze „umso grösseren Wert in sich selbst und für eine noch vielfach irrende Nachwelt“.
Wistrich schrieb 1983, dass Rommel mit den Verschwörern „sympathisierte […] ohne sich selbst aktiv an der Verschwörung zu beteiligen“, insgesamt aber „unentschieden“ geblieben sei. Er ging aber davon aus, dass Rommel sehr wohl über die Pläne informiert gewesen war. Reuth urteilte 1987 hingegen, dass Rommel weder von den Attentatsplänen wusste noch für den Widerstand gewonnen wurde. Er meinte, Rommel habe zwar im Hinblick auf die Einschätzung der militärischen Situation mit den Vertretern des Widerstandes, Speidel und von Hofacker, übereingestimmt, und ebenso wie diese Konsequenzen aus dem für die Wehrmacht ungünstigen Kriegsverlauf gefordert. „Was sie mit ‚Konsequenzen‘ meinten, unterschied sich jedoch grundlegend“. An eine Ermordung Hitlers habe Rommel dabei nie gedacht.
Auch in seinem Aufsatz von 1997 stellt Reuth fest, dass „weder Hofacker noch Speidel […] Rommel also definitiv für den Widerstand gewonnen“ hatten. David Fraser unterstützt die Einschätzung Reuths: „Rommel hatte stets die Vorstellung einer Tötung Hitlers abgelehnt, obwohl er inzwischen von der Notwendigkeit, den Krieg zu beenden, überzeugt war und erkannte, dass dies die Ausschaltung Hitlers einschloss“. Sowohl Fraser wie auch Reuth sehen Rommel deshalb nicht als Mitwisser der Verschwörung gegen Hitler, erkennen aber an, dass es ganz offensichtlich das Bestreben der Verschwörer war, den populären Rommel für sich zu gewinnen. Ab Mitte der 1990er Jahre verschwanden dann die Einträge zu Rommel aus den Werken 20. Juli. Porträts des Widerstandes (herausgegeben von Rudolf Lill) sowie aus dem Lexikon des Widerstandes 1933–1945 (herausgegeben von Peter Steinbach).
Im September 1944 gab General Heinrich Eberbach gegenüber anderen deutschen Offizieren an, Rommel habe sich ihm gegenüber in einem Vieraugengespräch dafür ausgesprochen, Hitler und seine nächste Umgebung umzubringen. Eberbach befand sich im September 1944 in britischer Kriegsgefangenschaft in Trent Park; die dort abgehörten Gespräche wurden 2005 erstmals veröffentlicht. Nach Kriegsende wiederholte Eberbach seine Angaben von 1944. Der Historiker Sönke Neitzel sieht in den Äusserungen Eberbachs keinen Beweis, aber ein Indiz für die von Maurice Philip Remy vertretene These, Rommel sei durch Cäsar von Hofacker über das geplante Attentat auf Hitler informiert worden. Daneben verwies Peter Lieb 2013 auf Generalleutnant Alfred Gause, der handschriftlich in seinem Exemplar von Desmond Youngs Biographie „Rommel: Der Wüstenfuchs“ (1950) festgehalten hatte, dass es nicht stimme, dass Rommel nicht von Walküre gewusst habe. Im Jahr 2010 wiederholte der Militärgeschichtsforscher Jörg Echternkamp in einem populärwissenschaftlichen Werk die bekannte These, dass sich Rommels Rolle als Widerstandskämpfer 1944 darin erschöpfte, dass er zwar „mit den westlichen Alliierten einen Separatfrieden schliessen wollte, aber doch nur, um den Krieg im Osten gegen die Rote Armee zu gewinnen“.
Laut dem Militärhistoriker Gerd R. Ueberschär wird „ein steter, schon ab 1941, spätestens jedoch ab Ende November 1942 in Verbindung mit der verlangten Räumung Nordafrikas zu beobachtender Wandel“ Rommels vom Anhänger zum Gegner Hitlers „in der Forschung weitgehend akzeptiert“, wie auch die jüngsten Biographien von Sir David Fraser und Maurice P. Remy zeigten. Seit 1943 habe Rommel eine „distanzierte und kritische Einstellung zu Hitler und dessen Kriegführung“ gehabt und „durch v. Hofacker von den Überlegungen zum Staatsstreich“ gewusst.
Nach Auswertung neuer Quellen kam der Militärhistoriker Peter Lieb 2018 zu dem Ergebnis, dass Rommel „nicht nur von dem Attentat wusste, sondern sich sogar auf die Seite des Widerstands gestellt hatte. Sicher ist aber auch, dass er an den operativen Planungen des Anschlags nicht beteiligt war. Und unklar bleibt nach wie vor, welche Rolle Rommel konkret während und nach dem Attentat zugedacht war“. Lieb beruft sich dabei auf Aussagen von General Heinrich Eberbach, Rommel habe ihn während der Schlacht um die Normandie konkret auf den Sturz der NS-Diktatur angesprochen; auf Unterlagen des Pariser Verschwörers Rudolf Hartmann, der Rommel als „Träger des Widerstands“ in Frankreich bezeichnete; und auf Aktennotizen von Hitlers Privatsekretär Martin Bormann, dass Rommel über den Staatsstreich „durchaus im Bilde gewesen“ sei und „der neuen Regierung nach gelungenem Attentat zur Verfügung stehen“ würde. „Dass Hitler dem populären Rommel die Option auf eine Gerichtsverhandlung eröffnete, ohne dass belastendes Material vorhanden gewesen wäre, erscheint wenig plausibel“, so Lieb. Allein dies spreche für eine Unterstützung des Widerstands durch Rommel, der mehr als nur ein Sympathisant der Verschwörer gewesen sei. Er habe das Attentat unterstützt.
Suizid und Staatsbegräbnis
Nach einem Anruf vom Vortag trafen am 14. Oktober 1944 General Wilhelm Burgdorf, Hitlers Chefadjutant, sowie General Ernst Maisel, Chef für Ehrenangelegenheiten im Heerespersonalamt, in Herrlingen ein. Sie legten Rommel das vermeintlich belastende Material vor und stellten ihn vor die Alternative, sich selbst zu töten oder sich vor dem Volksgerichtshof zu verantworten. Zwar war Rommel überzeugt, dass es sich dabei um eine Intrige handeln müsse, dennoch widersetzte er sich nicht. Im Auto fuhr er mit den beiden Generälen bis hinter die Ortsgrenze von Herrlingen, wo er sich mit Hilfe der von den Generälen mitgebrachten Zyankaliampulle das Leben nahm. Rommels Ehefrau wurde anschliessend mitgeteilt, ihrem Ehemann sei während der Fahrt unwohl geworden, und er sei schliesslich an den Folgen einer Embolie verstorben.
Diese Umstände hinderten das Regime jedoch nicht daran, die tatsächlichen Umstände seines Todes zu verschleiern, um auch noch den toten Rommel propagandistisch wirkungsvoll für sich zu nutzen. In der Öffentlichkeit wurde der Tod als Folge der Verletzungen dargestellt, die Rommel sich am 17. Juli bei einem Tieffliegerangriff der Alliierten in der Normandie zugezogen hätte. Offiziell sprach man jedoch von einem Autounfall, da der Nimbus des unbesiegbaren Soldaten nicht getrübt werden sollte. Die Trauerfeier für Rommel fand am 18. Oktober im Rahmen eines Staatsaktes im Rathaus in Ulm statt. Dass der Staatsakt dort stattfand, hatte Rommel den Angaben seines Sohnes zufolge noch ausgehandelt. Die Trauerrede hielt Gerd von Rundstedt. Anschliessend wurde sein Leichnam eingeäschert, die Urne später auf dem Friedhof der St. Andreaskirche in Herrlingen, Gemeinde Blaustein, beigesetzt.
Der Tagesbefehl Hitlers ehrte Rommel mit den Worten: „Sein Name ist im gegenwärtigen Schicksalskampf des deutschen Volkes der Begriff für hervorragende Tapferkeit und unerschrockenes Draufgängertum“.
Auch Gerd von Rundstedt (s. o.) war in seiner Trauerrede bemüht, den „Mythos Rommel“ aufrechtzuerhalten: „im Namen des Führers, der uns als oberster Befehlshaber an diese Stätte gerufen hat, um Abschied zu nehmen von seinem im Felde der Ehre gebliebenen Generalfeldmarschall […] Das deutsche Volk hat in einer geradezu einmaligen Art den Generalfeldmarschall Rommel geliebt und gefeiert. Mit Rommel ist jener grosse soldatische Führer von uns gegangen, wie sie einem Volke nur selten gegeben werden. Tief verwurzelt im deutschen Soldatentum gab er sein Leben ausschliesslich der Arbeit und dem Kampf für Führer und Reich“. Die Rede endete mit den Worten: „sein Herz gehörte dem Führer“.
Propagandafigur Rommel
Rommel wurde gezielt zu einer nationalsozialistischen Propagandafigur aufgebaut. Er war ausserordentlich ehrgeizig und sah sich als Angehöriger des Militärs auch zu einer absoluten Loyalität gegenüber den Machthabern verpflichtet, auf die er vereidigt worden war (siehe Führereid). Hinzu kamen sein militärisches Talent und sein besonderer, oftmals erfolgreicher Führungsstil. Von der Propaganda um seine Person versprach er sich eine Förderung seiner Karriere. Hilfreich war dabei das sich schon früh entwickelnde enge Verhältnis zum Diktator Hitler, als dessen „Lieblingsgeneral“ er galt. Hitler, der ansonsten strengstens die Veröffentlichung von Bildmaterial seiner Heerführer und Generäle kontrollierte, machte bei Rommel eine Ausnahme. Propagandaminister Goebbels hatte freie Hand, Rommel gezielt zu einer Propagandafigur aufzubauen, die all die Tugenden verkörperte, die nach NS-Verständnis einen idealen Soldaten ausmachten. Es gab auch ganz konkrete personelle Verbindungen zwischen dem Propagandaministerium und Rommels Stab, beispielsweise in Gestalt von Karl Hanke und Alfred-Ingemar Berndt. Goebbels schenkte Rommel eine Kamera, mit der er seine Einsätze in Frankreich und Afrika festhalten konnte. Rommel nutzte begeistert diese Möglichkeit der Selbstinszenierung, deren Resultate auch teilweise in Deutschland veröffentlicht wurden. Goebbels war daher wohl nicht zu Unrecht der Meinung, „dass kaum ein General so von der Wichtigkeit des Propagandaeinsatzes durchdrungen sei wie Rommel. Auch die Tatsache zeuge dafür, wie sehr er ein geistig aufgeschlossener, moderner General im besten Sinne des Wortes sei“. Wie wichtig Rommel für die Propaganda war, zeigte sich auch daran, dass sein erfolgreicher Durchbruch der Maginot-Linie beim Westfeldzug in Frankreich (Juni 1940) noch im selben Jahr unter dem Titel „Sieg im Westen“ vom Propagandaministerium an Originalschauplätzen verfilmt wurde. Der Film hatte im Februar 1941 im Berliner Ufa-Palast am Zoo Premiere.
Der Einsatz in Nordafrika führte dazu, dass Rommels Charakter und Fähigkeiten nun auch von alliierter Seite überhöht wurden. Die Anerkennung, die ihm beispielsweise der britische Premier Churchill zollte, war allerdings weniger dem Talent Rommels geschuldet als dem Versuch, der eigenen Öffentlichkeit zu erklären, warum die britischen Truppen in Nordafrika trotz militärischer Übermacht noch nicht gesiegt hatten. Tatsächlich, so der britische Historiker Antony Beevor, habe Rommel bei seinen militärischen Entscheidungen von Beginn an eher leichtsinnig gehandelt und letztlich nur deswegen grosse Reputation erlangt, weil die alliierten Propagandisten ein Interesse daran gehabt hätten, ihn zum fähigen Heerführer zu stilisieren, um das unfähige Handeln der britischen militärischen Führung in Nordafrika zu verschleiern.
Um das Interesse der ausländischen Presse zu befriedigen, veröffentlichte das Propagandaministerium sogar einen Lebenslauf Rommels, der nationalsozialistischen Idealen angepasst war. Rommel wurde darin eine Herkunft aus der Arbeiterschicht angedichtet und die Mitgliedschaft in SA und NSDAP unterstellt. Erfolglos protestierte Rommel gegen diese Verfälschungen.
Wie populär Rommel auch im Ausland war, zeigte eine Gallup-Umfrage aus dem Jahre 1942: Nach Hitler war Rommel der weltweit bekannteste Deutsche. Goebbels notierte dazu im Februar 1942 in seinem Tagebuch: „Rommel ist weiterhin das erklärte Lieblingsobjekt selbst der feindlichen Nachrichtendienste“.
Um Schaden von der sorgfältig inszenierten Propagandafigur Rommel abzuwenden, wurde Rommel vor der absehbaren Niederlage aus Nordafrika abberufen. Rommels anschliessende Versetzung an den Atlantikwall sollte der Bevölkerung die gleiche Hoffnung und den gleichen Durchhaltewillen vermitteln wie schon in Bezug auf Nordafrika. Die Verletzung, die er am 17. Juli 1944 bei einem alliierten Tieffliegerangriff erlitt, passte dabei nicht in das Bild eines unbesiegbaren und ehrenvollen deutschen Soldaten und wurde daher als Folge eines Autounfalls dargestellt. Spekulationen der ausländischen Presse, Rommel sei dabei ums Leben gekommen, wurde mit einer Pressekonferenz in Paris am 1. August 1944 begegnet, auf der sich Rommel zum letzten Mal der Presse stellte.
Nachwirkungen
Das öffentliche Bild Rommels ist auch weiterhin stark vom „Mythos Rommel“ geprägt. Seine Person wird dabei weniger kritisch gesehen als andere Vertreter der Wehrmacht, obwohl er in der Zeit des Nationalsozialismus den Höhepunkt seiner Karriere erreichte und ein ambivalentes Verhältnis zum Widerstand hatte. Mit ihm verbinden sich immer noch Vorstellungen von einem ehrenvollen und „ritterlichen“ Kampf, von einer „sauberen Wehrmacht“. Dabei steht vor allem sein Einsatz in Nordafrika im Vordergrund. Die Tatsache, dass dieser Kriegsschauplatz weit entfernt von den Deportationen und Vernichtungslagern im Osten war, machte es leichter, das Bild eines unbefleckten Soldaten aufrechtzuerhalten. Die Ehrenhaftigkeit seines Einsatzes in Nordafrika wurde auch von seiner Ehefrau betont, welche 1950 die Kriegsaufzeichnungen ihres Mannes unter dem Titel Krieg ohne Hass herausbrachte.
Das immer wieder thematisierte Verhältnis Rommels zum Widerstand trägt seinen Teil dazu bei, Rommel in positivem Licht erscheinen zu lassen. Welch grosse Anerkennung und Aufmerksamkeit Rommel nach 1945 auch im Ausland erfuhr, zeigt sich daran, dass die ersten Biografien Rommels von Engländern veröffentlicht wurden, beispielsweise von Desmond Young, der in Nordafrika selbst gegen Rommel gekämpft hatte. Insgesamt verwundert es daher nicht, dass sich nach dem Krieg Gruppen wie der „Verband Deutsches Afrika-Korps e.V“. sowie das „Rommel Sozialwerk e.V“. gegründet haben.
Ehrungen
Die Bundeswehr ehrte ihn 1961 mit der Benennung der Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne in Augustdorf und 1965 mit der Rommel-Kaserne in Dornstadt bei Ulm. Die Rommel-Kaserne in Osterode am Harz wurde inzwischen geschlossen. Die Bundesmarine taufte 1969 einen Zerstörer der Lütjens-Klasse auf den Namen Rommel. Den Taufakt nahm seine Witwe vor. Das Schiff wurde 1998 ausser Dienst gestellt.
Zahlreiche Strassen deutscher Städte, vor allem in Baden-Württemberg, sind nach ihm benannt, beispielsweise in seinem letzten Wohnort Blaustein-Herrlingen die Erwin-Rommel-Steige, früher Wippinger Steige, an der sein damaliges Wohnhaus liegt. In Erlangen ist ein Studentenwohnheim nach der daran angrenzenden Erwin-Rommel-Strasse benannt.
Am 12. November 1961 wurde auf dem Zanger Berg in Heidenheim ein Denkmal zu Ehren Rommels aufgestellt. Festredner war Hans Filbinger. Zum 50. Jahrestag seiner Einweihung liess die Stadtverwaltung im November 2011 auf Vorschlag von Oberbürgermeister Bernhard Ilg (CDU) eine Hinweistafel anbringen. Sie enthält den Satz „Tapferkeit und Heldenmut, Schuld und Verbrechen liegen im Krieg eng zusammen“, den Peter Steinbach, Geschichtsprofessor an der Universität Mannheim und wissenschaftlicher Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, als „betulichen Text, der Angst hat, sich mit der Komplexität der Person auseinanderzusetzen“, kritisierte: Bei Erwin Rommel von „Heldenmut“ zu sprechen, sei völlig verfehlt.
Generalfeldmarschall Georg von Küchler
Georg von Küchler (* 30. Mai 1881 auf Schloss Philippsruhe bei Hanau; † 25. Mai 1968 in Garmisch-Partenkirchen) war ein deutscher Generalfeldmarschall und während des Zweiten Weltkrieges Oberbefehlshaber von Armeen und Heeresgruppen sowie Ehrenritter des Johanniterordens.
Er wurde im April 1949 in Nürnberg im OKW-Prozess wegen Kriegsverbrechen zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt und 1953 vorzeitig entlassen.
Seine Eltern waren der Grossherzoglich hessische Oberst, Flügeladjutant und Hofmarschall Karl von Küchler (1831–1922) und dessen Ehefrau Marie, geborene von Scholten (1851–1924), eine Tochter des preussischen Generalleutnants Wilhelm von Scholten (1797–1868). Er heiratete 1921 in Darmstadt Elisabeth von Enckevort (1888–1966), eine Tochter des preussischen Generalmajors Eduard von Enckevort (1845–1924). Aus der Ehe ging der Sohn Dieter (1926–1951) sowie die Tochter Sybille (* 1929) hervor, die den Diplomaten Rudolf Hahn heiratete.
Kaiserreich und Erster Weltkrieg
Nach dem Abitur am Ludwig-Georg-Gymnasium in Darmstadt trat Küchler im Jahr 1900 in das 1. Grossherzoglich Hessische Feldartillerie-Regiment Nr. 25 der Preussischen Armee ein. 1901 wurde er zum Leutnant befördert und nach einem mehrjährigen Dienst an der Militär-Reitschule in Hannover avancierte er 1910 zum Oberleutnant. Nach dem Besuch der Kriegsakademie, wurde Küchler Anfang 1914 in den Grossen Generalstab nach Berlin versetzt.
Im Ersten Weltkrieg wurde Küchler als Batteriechef verwendet und zum Hauptmann befördert. Später wurde er in den Generalstab versetzt und zum Kriegsende hin als Erster Generalstabsoffizier (Ia) der 206. Infanterie-Division sowie der 9. Reserve-Division eingesetzt. Küchler erhielt u. a. beide Klassen des Eisernen Kreuzes sowie das Ritterkreuz des Königlichen Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern.
Weimarer Republik
Nachdem der Krieg im Westen zu Ende gegangen war, wurde Küchler Generalstabsoffizier der Brigade „Kurland“ und nahm in dieser Funktion an den aufkommenden Kämpfen im Baltikum teil.
In der Reichswehr wurde Küchler zum I. Armeekorps versetzt. Nach anschliessender kurzer Tätigkeit in der Heeresausbildungsabteilung des Reichswehrministeriums im Jahr 1920 folgten für Küchler verschiedene Verwendungen im Bereich der Ausbildung bis in die 1930er Jahre hinein. In dieser Zeit wurde er 1923 zum Major, 1929 zum Oberstleutnant und schliesslich 1931 zum Oberst befördert.
Am 1. Oktober 1932 wurde Küchler zum Artillerieführer I in Ostpreussen ernannt.
Zeit des Nationalsozialismus
Vorkriegszeit
Nach der Beförderung zum Generalmajor am 1. April 1934 wurde er im Jahr darauf zum Inspekteur der Kriegsschulen ernannt. Am 1. Dezember 1935 (inzwischen war aus der Reichswehr die Wehrmacht geworden) wurde er zum Generalleutnant befördert.
Bevor er am 1. April 1937 als General der Artillerie zum Kommandierenden General des I. Armeekorps ernannt wurde, war Küchler ein halbes Jahr lang stellvertretender Präsident des Reichskriegsgerichts. Das I. Armeekorps hatte seinen Sitz in Königsberg.
Im März 1939 betraten deutsche Soldaten unter Küchlers Befehl erstmals nach Ende des Ersten Weltkriegs das Memelland, nachdem dieses im Rahmen eines Deutsch-Litauischen Staatsvertrags an das Deutsche Reich gefallen war.
Zweiter Weltkrieg
Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde Küchler Oberbefehlshaber der 3. Armee. Für die erfolgreiche Führung seiner Truppen erhielt er das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes.
Nachdem Küchler für den am 22. September 1939 vor Warschau gefallenen ehemaligen Oberbefehlshaber des Heeres, Werner Freiherr von Fritsch, eine Trauerfeier angeordnet und bei dieser Gelegenheit kritische Worte zu den Umständen, unter denen Fritsch seinen damaligen Posten verloren hatte, geäussert hatte, wurde er umgehend seines Amtes enthoben. Auf Intervention Walther von Brauchitschs wurde er jedoch bald darauf mit dem Kommando über die 18. Armee betraut.
Im Westfeldzug besetzten Küchlers Truppen die Niederlande; am 19. Juli 1940 wurde er zum Generaloberst befördert. Küchler, der über die Verbrechen gegen die Menschlichkeit im besetzten Polen genauestens unterrichtet war, schrieb am 20. August 1940 im Kriegstagebuch:
„Ich betone die Notwendigkeit, dafür Sorge zu tragen, dass sich alle Soldaten der Armee, besonders die Offiziere, jeder Kritik an dem im Generalgouvernement durchgeführten Kampf mit der Bevölkerung, z. B. der Behandlung der polnischen Minderheiten, der Juden und kirchlicher Angelegenheiten, enthalten. Die völkische Endlösung dieses Volkskampfes, der an der Ostgrenze seit Jahrhunderten tobt, verlangt besonders strenge Massnahmen“.
Am 22. Juni 1941 sagte er in seinem Stab, der eben begonnene Feldzug sei nicht die blosse Fortsetzung eines Kampfes zwischen Germanentum und Slawentum; vielmehr stünde nun der Kampf zwischen zwei Weltanschauungen, dem Nationalismus [sic] und dem Bolschewismus, bevor.
Auch im Krieg gegen die Sowjetunion 1941–1945 befehligte Küchler die 18. Armee, die im Verband der Heeresgruppe Nord eingesetzt war. Nach dem Rücktritt von Generalfeldmarschall Ritter von Leeb als Oberbefehlshaber bekam Küchler am 17. Januar 1942 das Kommando über die Heeresgruppe Nord und übernahm damit die Verantwortung für die Belagerung von Leningrad.
Den Kommissarbefehl begrüsste Küchler ausdrücklich:

„Wenn bekannt wird, dass wir die politischen Kommissare und G.P.U.-Leute sofort vor ein Feldgericht stellen u. aburteilen, so ist zu hoffen, dass sich die russ. Truppe u. die Bevölkerung selbst von dieser Knechtschaft befreien. Wir wollen das Mittel jedenfalls anwenden. Es spart uns deutsches Blut u. wir kommen schnell voran“.
Am 26. Dezember 1941 stellte oder unterstützte Küchler einen Antrag des XXVIII. Armeekorps, wegen Seuchengefahr etwa 230 Patientinnen einer Anstalt im ehemaligen Kloster Makarevskaja Pustin durch Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD töten zu lassen. Im Nürnberger Generalsprozess bestritt er dies und sprach von einem Irrtum. Im ähnlichen Makarevskaja-Fall, bei dem etwa 1’200 Patienten (Irre) einer grossen psychiatrischen Anstalt im November 1941 zur Tötung an die Einsatzgruppen übergeben wurden, ergaben spätere Forschungen seine Mitverantwortung.
Am 30. Juni 1942 erfolgte Küchlers Ernennung zum Generalfeldmarschall. Am 21. August 1943 erhielt er das Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Nach etwas mehr als zwei Jahren auf dem Posten des Oberbefehlshabers der Heeresgruppe Nord wurde er (nach einer Meinungsverschiedenheit mit Hitler) am 29. Januar 1944 von Hitler seines Kommandos enthoben und von Walter Model abgelöst. Um diese Zeit gelangen der Roten Armee Fortschritte an der Leningrader Front (Leningrad-Nowgoroder Operation).
Bis Kriegsende wurde Küchler nicht mehr eingesetzt.
Nachkriegszeit
Küchler gehörte 1946 und 1947 der Operational History (German) Section der Historical Division der US Army an. In seiner Weisung vom 7. März 1947 für die in seinem Bereich des Lagers Garmisch zu schreibenden Erfahrungsberichte und Abhandlungen sollte als Grundsatz gelten, dass die Darstellung historischer Wahrheit mit dem Lob auf das eigene Heer zu verbinden sei:

„Es werden die deutschen Taten vom deutschen Standpunkt gesehen, festgelegt und dadurch unseren Truppen ein Denkmal gesetzt […] Die Leistungen unserer Truppen sind gebührend zu würdigen und herauszustellen. Die Wahrheit darf hierdurch natürlich nicht missachtet werden“.
Die Mitarbeit dort schützte ihn jedoch nicht wie erhofft vor Strafverfolgung. Als Angeklagter im Prozess gegen das Oberkommando der Wehrmacht wurde Küchler am 14. April 1949 zu 20 Jahren Haft verurteilt. Die Haftzeit wurde auf 12 Jahre herabgesetzt; 1953 wurde Küchler aus dem Kriegsverbrechergefängnis Landsberg entlassen.
Generalfeldmarschall Erich von Lewinski genannt von Manstein
Fritz Erich von Lewinski genannt von Manstein (* 24. November 1887 in Berlin; † 10. Juni 1973 in Irschenhausen) war ein deutscher Heeresoffizier (ab 1942 Generalfeldmarschall) und während des Zweiten Weltkrieges Armee- und Heeresgruppenoberbefehlshaber. Im August 1945 wurde er von den Briten zunächst als Kriegsgefangener behandelt, dann inhaftiert und 1949 als Kriegsverbrecher verurteilt. Nach seiner Haftentlassung 1953 wurde er als einziger ehemaliger Feldmarschall bis 1960 inoffizieller Berater der Bundesregierung zur neuen Aufstellung eines Heeres (ab 1956 Bundeswehr).
Fritz-Erich von Lewinski wurde als zehntes Kind des Obersten und späteren Generals der Artillerie Eduard von Lewinski und seiner Frau Helene in eine alte preussische Soldatenfamilie hineingeboren. Schon bei der Taufe wurde er seinem Onkel, dem Major und späteren General Georg von Manstein, und dessen Frau Hedwig übergeben, deren Ehe selbst kinderlos geblieben war. Seine Adoptivmutter war die jüngere Schwester seiner Mutter. Er wuchs zusammen mit seiner ebenfalls adoptierten Schwester Martha auf. Sechzehn direkte Vorfahren der eigenen Lewinski-Linie und der von Mansteins waren Generäle in preussisch-deutschen oder zaristisch-russischen Diensten gewesen. Mansteins ehemaliger Ordonnanzoffizier Alexander Stahlberg schreibt in seinen Memoiren, sein Chef habe ihm gegenüber während des Krieges die Abstammung von einem „Ur-Ur-Ahnherrn Lewi“ behauptet, was wiederum der Manstein-Biograph Oliver von Wrochem in seiner Dissertation als Spekulation Stahlbergs über „keine ernstgemeinte Äusserung“ des Generals bezeichnet. Im Übrigen gebe es keine Belege für eine „jüdische Herkunft des Namens“.
Manstein besuchte von 1894 bis 1899 in Strassburg das Lyzeum, ein katholisches Gymnasium. Im Alter von 13 bis 19 Jahren besuchte er zuerst die Kadettenanstalt Plön und später die Preussische Hauptkadettenanstalt in Lichterfelde bei Berlin. Im Juni 1905 war Manstein Leibpage bei der Heirat des Kronprinzen Wilhelm mit Cecilie von Mecklenburg-Schwerin.
Am 10. Juni 1920 heiratete Manstein in Lorzendorf (Kreis Namslau) Jutta Sibylle von Loesch (1900–1966). Sie hatten drei gemeinsame Kinder: Gisela (1921–2013), Gero (* 1922; gefallen am 29. Oktober 1942 als Leutnant an der Ostfront) und Rüdiger (* 1929).
Kaiserreich und Erster Weltkrieg
Im Jahr 1906 trat Manstein als Fähnrich in das 3. Garde-Regiment zu Fuss der preussischen Armee ein und wurde dort 1907 zum Leutnant befördert. In den Jahren 1913/14 besuchte er die Kriegsakademie in Berlin.
Bei Beginn des Ersten Weltkrieges war Manstein Oberleutnant und wurde Adjutant im 2. Garde-Reserve-Regiment. Nach schwerer Verwundung im November 1914 und Rückkehr in den Dienst wurde Manstein 1915 Hauptmann und als Ordonnanz- sowie Generalstabsoffizier in der Armeeabteilung Gallwitz eingesetzt. Anschliessend fand er Verwendung bei der 1. Armee, und ab Herbst 1917 war er Erster Generalstabsoffizier (Ia) der 4. Kavallerie-Division, die an der Ostfront in Estland eingesetzt war. Im Mai 1918 wurde er, ebenfalls als Ia, zur 213. Infanterie-Division an die Westfront versetzt.
Weimarer Republik
Manstein wurde nach dem Krieg in die Reichswehr übernommen und war zunächst beim Grenzschutz-Oberkommando Süd und danach im Stab des Gruppenkommandos II mit Sitz in Kassel eingesetzt.
Am 1. Oktober 1921 wurde Manstein Kompaniechef im 5. (Preussisches) Infanterie-Regiment in Angermünde, am 1. Oktober 1923 wiederum Stabsoffizier, zunächst beim Wehrkreiskommando II, dann beim Wehrkreiskommando IV zur Führergehilfenausbildung. Ab Herbst 1927, als Generalstabsoffizier beim Infanterieführer IV in Magdeburg, wurde er zum Major befördert. Ende September 1929 avancierte Manstein zum Leiter der Gruppe I in der Abteilung T 1 im Truppenamt, wo er am 1. April 1931 zum Oberstleutnant befördert wurde. Im Oktober 1932 wurde er zum Kommandeur des Jägerbataillons des 4. (Preussisches) Infanterie-Regiments in Kolberg ernannt.
Beginn der Zeit des Nationalsozialismus
Am 1. Oktober 1933 wurde Manstein Oberst, anschliessend am 1. Februar 1934 Chef des Stabes des Wehrkreises II und am 1. Juli 1935 Chef der Operationsabteilung im Generalstab des Heeres. In dieser Funktion verfasste er eine Denkschrift über die Schaffung einer Begleitartillerie auf Selbstfahrlafetten zur Infanterieunterstützung, aus welcher schliesslich die Sturmartillerie entstehen sollte. Am 1. Oktober 1936 wurde er unter gleichzeitiger Ernennung zum Generalmajor Oberquartiermeister I., somit Vertreter von Generalstabschef Beck und traditionell als dessen designierter Nachfolger vorgesehen.
Im Verlauf der Blomberg-Fritsch-Krise versetzte man Manstein am 4. Februar 1938 jedoch überraschend auf den Posten des Kommandeurs der 18. Infanterie-Division in Liegnitz (Schlesien). Im März war er noch im Auftrag des Oberkommandos der Wehrmacht an der Vorbereitung des Einmarsches deutscher Truppen in Österreich und der Eingliederung des österreichischen Heeres in die Wehrmacht beteiligt. In der Folge des Münchener Abkommens führte Manstein die 18. Infanterie-Division in das Sudetenland.
Zweiter Weltkrieg
1939/40 Polenfeldzug und Strategieplan für den Westfeldzug
1939 nahm Manstein im Rang eines Generalleutnants als Chef des Generalstabs der Heeresgruppe Süd am Polenfeldzug teil. Anschliessend erarbeitete er einen alternativen Angriffsplan für den Westfeldzug, der später als Sichelschnittplan bezeichnet wurde. Für den Einmarsch in Frankreich hatte das Oberkommando des Heeres (OKH) zunächst eine Operation geplant, die dem schon im Ersten Weltkrieg gescheiterten Schlieffen-Plan ähnelte und einen massiven Vorstoss durch Flandern vorsah. Es bestand die Gefahr, dass sich daraus ein ähnlich langwieriger Stellungskrieg wie nach 1914 entwickeln würde. Da die Wehrmacht aber wegen der knappen Ressourcen des Reichs eine schnelle strategische Entscheidung herbeiführen musste, setzte Mansteins Sichelschnittplan darauf, die deutschen Panzerverbände bei der Heeresgruppe A (ex Heeresgruppe Süd) zu konzentrieren. Sie sollte durch die Ardennen in die Flanke des nach Belgien und Holland vorrückenden Gegners stossen und ihn dort einkesseln. Auch dieser Plan barg enorme Risiken. Er setzte voraus, dass die französischen und englischen Truppen nach Belgien vorrückten. Und da der deutsche Vormarsch, auf den nur von wenigen Strassen durchzogenen Ardennen in weit auseinander gezogenen Kolonnen erfolgen musste, hätte er bei einer frühzeitigen Entdeckung leicht gestoppt und die Wehrmachtsverbände vernichtet werden können.
Manstein machte wegen seines Operationsplans laufend Eingaben beim OKH. General Franz Halder, der Generalstabschef des Heeres befürchtete, dass Generaloberst Rundstedt als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe A den riskanten Sichelschnittplan befürworten würde. Daher entfernte er dessen Urheber Manstein, der als unbequemer Mahner gesehen wurde, aus seiner Position und gab ihm am 27. Januar 1940 überraschend das Kommando über ein neu aufzustellendes XXXVIII. Armeekorps. Mittlerweile war jedoch der ursprüngliche Feldzugsplan des OKH durch den Mechelen-Zwischenfall den Alliierten bekannt geworden. Ein Kurierflugzeug mit den Plänen hatte sich im Nebel verirrt und war versehentlich in Belgien gelandet. Hitler, der von Mansteins Vorschlag erfahren hatte, befahl dem OKH daher nun, den Sichelschnittplan auszuarbeiten und zur Grundlage des Frankreichfeldzugs zu machen. An diesem Feldzug nahm Manstein mit seinem Armeekorps teil. Er selbst wurde am 1. Juni 1940 zum General der Infanterie befördert und erhielt einen Monat später das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes.
1941/42 Ostfeldzug bis zur Eroberung der Krim
Im Februar 1941 wurde ihm das Kommando über das ebenfalls neu aufzustellende LVI. Armeekorps (mot.) – so hiessen die späteren Panzerkorps bis 1942 – übertragen. In dieser Funktion hatte er keine Kenntnis und keinen Einfluss auf die strategische Planung des Krieges gegen die Sowjetunion. Wenige Tage vor Beginn des Angriffs auf die Sowjetunion erhielt er den sogenannten Kommissarbefehl, der besagte, dass alle in Gefangenschaft geratenen Politkommissare der Roten Armee sofort erschossen werden sollten. Entgegen den Behauptungen Mansteins in seinen Memoiren, „dass er den Kommissarbefehl abgelehnt habe und ihn seine Truppen nicht ausführten“, kam es schon in den ersten Wochen nach Beginn des Unternehmens Barbarossa zu „Erschiessungen von Kommissaren sowie antijüdischen Aktionen in Mansteins Befehlsbereich“.
Am 22. Juni 1941 um 3 Uhr begann das LVI. AK den Überfall auf die Sowjetunion, legte innerhalb von fünf Tagen 240 Kilometer zurück und eroberte am 27. Juni Dünaburg. Am 12. September wurde Manstein der Befehl über die 11. Armee übertragen, deren Oberbefehlshaber Generaloberst Eugen von Schobert am selben Tag gefallen war. Wenig später schlug er im Zusammenwirken mit der 1. Panzerarmee Ewald von Kleists und rumänischen Verbänden in der Schlacht am Asowschen Meer die Truppen der sowjetischen Südfront. Am rechten Flügel der Heeresgruppe Süd stehend, war das nächste Ziel die Eroberung der Krim. Nach dem Durchbruch der 11. Armee über die Landenge von Perekop wurden im November 1941 in schneller Folge Simferopol, Feodossija und Kertsch besetzt und ein erster Versuch zur Eroberung Sewastopols unternommen; nach dessen Fehlschlag begann die achtmonatige Belagerung der Festung. In Simferopol kam es im Dezember 1941 zum berüchtigten Simferopol-Massaker, bei dem annähernd 14’000 Juden innerhalb von wenigen Tagen von SS-Leuten und Angehörigen der Feldgendarmerie Abteilung 683 ermordet wurden. Am 20. November 1941 hatte von Manstein einen Befehl erlassen, der dem von Hitler gelobten Reichenau-Befehl entsprach. Von Manstein bekräftigte darin, dass das „jüdisch-bolschewistische System“ ein für alle Mal ausgerottet werden müsse, und forderte von seiner Truppe, alle Erhebungen, die meist von Juden angezettelt würden, im Keime zu ersticken.
Im Mai 1942 gelang dem zuvor zum Generaloberst beförderten Manstein im Unternehmen Trappenjagd die Vernichtung der auf der Halbinsel Kertsch im Osten der Krim gelandeten sowjetischen Truppen und wenig später in einem zweiten, diesmal erfolgreichen Anlauf die Eroberung Sewastopols. Hierfür wurde er am 1. Juli zum Generalfeldmarschall ernannt. Im Spätsommer bereitete sich die 11. Armee auf ihren Einsatz zur Eroberung des belagerten Leningrads im geplanten Unternehmen Nordlicht vor und begann mit der Verlegung dorthin.
1942/43 Stalingrad und Rückeroberung Charkows
Im Zuge der Einkesselung der 6. Armee in Stalingrad wurde Manstein jedoch am 24. November zum Oberbefehlshaber der neugebildeten Heeresgruppe Don ernannt. Zu dieser gehörte neben der 6. Armee und zwei rumänischen Armeen die 4. Panzerarmee unter Generaloberst Hermann Hoth. Letztere sollte sich mit zunächst nur zwei Panzerdivisionen aus südwestlicher Richtung bis etwa 30 Kilometer an den Kessel herankämpfen (Unternehmen Wintergewitter) und sich dort mit ausgebrochenen Teilen der 6. Armee (Unternehmen „Donnerschlag“) vereinigen, womit ein Korridor hergestellt gewesen wäre. Der Befehl zu „Donnerschlag“ wurde aber trotz heftigsten Drängens Mansteins durch Hitler verweigert, die Truppen Hoths blieben 48 Kilometer vor dem Kessel stecken. Damit war das Schicksal der 6. Armee besiegelt. Manstein hatte daraufhin allerdings massgeblichen Anteil daran, den vollständigen Zusammenbruch des gesamten deutschen Südflügels der Ostfront als Folge der Stalingrader Niederlage zu verhindern.
Im März 1943 gelang es ihm, im Rahmen einer Gegenoffensive (Schlacht um Charkow) Charkow und Belgorod zurückzuerobern, wofür er das Eichenlaub zum Ritterkreuz erhielt. Während und nach der Stalingrad-Krise zeichnete sich ein immer stärker werdendes Zerwürfnis zwischen Manstein und Hitler ab.
1943 Schlacht bei Kursk
Im Sommer 1943 bereitete sich die Wehrmacht im Frontbogen bei Kursk auf eine grosse Offensive vor, bei der durch Mansteins Heeresgruppe Süd und die Heeresgruppe Mitte unter Generalfeldmarschall Günther von Kluge die Feindtruppen abgeschnitten und anschliessend vernichtet werden sollten (Unternehmen Zitadelle). Mansteins Forderung nach einem frühzeitigen Beginn der eigenen Angriffsoperationen – gegen die noch geschwächten sowjetischen Verbände – wurde von Hitler abgelehnt, da der erst die Auffrischung der eigenen Divisionen sowie insbesondere die Zuführung neuer Waffen (Panther und Elefant) abwarten wollte. Den dadurch entstandenen Zeitgewinn nutzten die sowjetischen Verteidiger zum Aufbau tiefgestaffelter Verteidigungssysteme und ebenfalls zur Auffüllung ihrer angeschlagenen Einheiten mit dem Ergebnis, dass die letzte Grossoffensive der Wehrmacht im Osten scheiterte.
1943/44 Bemühungen des Widerstands um Manstein
Am Widerstand in der Wehrmacht und an einem Staatsstreich gegen Hitler wollte sich Manstein aber nicht beteiligen. In die verschiedenen Attentatspläne vor dem Attentat vom 20. Juli 1944 war Manstein nicht eingebunden. Er wusste aber von einem 1944 geplanten Attentat. Stauffenberg hatte ihn im Vieraugengespräch Ende Januar 1943 auf seine Unzufriedenheit mit Hitlers Entscheidungen hingewiesen, die wahren Ziele aber nicht deutlich zum Ausdruck gebracht. Manstein empfahl, den Major an die Front zu versetzen, „damit er den Kopf freibekomme“, was ihm später als Versuch der Verhaftung von Stauffenbergs ausgelegt wurde. Es gab zwei weitere Gespräche Mansteins mit Widerstandskämpfern: Am 8. August 1943, vor Beginn des Unternehmens Zitadelle, traf der Oberst i. G. Rudolf-Christoph von Gersdorff Manstein. Unter vier Augen sprach Gersdorff die unbefriedigende Situation mit der obersten Führung der Wehrmacht an. Manstein stimmte zu. Gersdorff schlug im weiteren vor, dass alle Feldmarschälle gemeinsam Hitler die Pistole auf die Brust setzen sollten, worauf Manstein laut Gersdorff mit der umstrittenen Stellungnahme erwidert haben soll: „Preussische Feldmarschälle meutern nicht“. Der Wahrheitsgehalt dieses Zitats Gersdorffs wird von Historikern bezweifelt, zumal Gersdorff es erst 1977 und damit nach Mansteins Tod bekannt machte. Schliesslich trug Gersdorff im Auftrag des Oberbefehlshabers Mitte, Günther von Kluge, Manstein vor, Kluge würde sich im Falle eines Staatsstreichs Manstein unterstellen und ihn bitten, die Position eines Chefs des Generalstabs der Wehrmacht, d. h. der vereinigten Generalstäbe aller drei Waffengattungen, zu übernehmen. Manstein lehnte das Vorhaben ab und berief sich dabei auf drei Punkte: Erstens sei politisch der Zeitpunkt für einen Frieden falsch, da der Feind von einem Sieg überzeugt sei. Zweitens besässe Hitler aus wehrmachts-interner Sicht als einzige Person das Vertrauen der Bevölkerung und der Soldaten. Drittens sei die Situation bezüglich des militärischen Oberbefehls zweifellos unbefriedigend und sei das Ergebnis von Irrtümern im Kommando. Man könne aber völlig ausschliessen, dass Hitler den Oberbefehl abgäbe. Der Antrag auf einen Wechsel Mansteins auf das Oberkommando könne nicht von ihm selbst kommen, da feindliche Propaganda ihn bereits dafür propagiert habe. Am 25. November 1943 war der mit Manstein befreundete Oberst Henning von Tresckow bei Manstein und versuchte vergeblich, ihn im Zuge der Schilderung der drohenden Kriegsniederlage zum Handeln gegen Hitler zu bewegen. Dies war der letzte Versuch der Oppositionellen, Manstein als Leitfigur für ihre Vorhaben zu gewinnen.
1943/44 Konflikt mit Hitler und Entlassung
Nach dem Scheitern des Unternehmens Zitadelle befehligte Manstein weiterhin die Heeresgruppe Süd während deren weiterer Abwehrkämpfe. Im Februar 1944 kam es zu einer eigenmächtigen Entscheidung Mansteins ohne Befehl Hitlers, als er sechs Divisionen mit 56’000 Soldaten aus einer drohenden Umklammerung zurück befahl. Am 21. März 1944 wurde die 1. Panzerarmee in der Kesselschlacht von Kamenez-Podolski annähernd eingeschlossen. Manstein stellte Hitler am 24. März Mittag ein Ultimatum, dass er den Rückzug der Armee anordnen würde, wenn er von Hitler bis 15 Uhr nichts Gegenteiliges höre. Hitlers Antwort traf um 16 Uhr ein und enthielt das Einverständnis, dass die 1. Panzerarmee ihre Kommunikationswege nach Westen aufrechterhalten solle bei gleichzeitigem Halten der gegenwärtigen Frontposition. Manstein erkannte, dass dies einer Wiederholung der Situation von Stalingrad gleichkam, das Verbot des Ausbruchs aus dem Kessel mit ähnlichen Konsequenzen. Eine vergleichbare Katastrophe stand neuerlich bevor. Manstein wurde von Hitler für den nächsten Tag zur Besprechung nach Lemberg beordert. Die 1. Panzerarmee erhielt noch am 24. März abends von Manstein Weisung, sich auf einen Rückzug vorzubereiten.
Unter Androhung des Rücktritts von seinem Kommando gegenüber Hitlers Chefadjutanten Rudolf Schmundt rang Manstein am 25. März Hitler dieses Mal in langwierigen, wiederholten Lagebesprechungen in Lemberg unter gegenseitigen Vorwürfen die Zustimmung zum Rückzug ab und befahl den riskanten Ausbruch der Armee nach Westen, der von der sowjetischen Armeeführung wegen einer noch verbliebenen Lücke nach Süden erwartet worden war. Der Gegner wurde durch Mansteins Plan getäuscht. Die von drei Seiten eingeschlossene Armee mit 220’000 Soldaten konnte mit diesem überraschenden Manöver gerettet werden.
Die Befreiung der 1. Panzerarmee war die letzte Grossoperation Mansteins. Sie führte auf Grund seiner wiederholten militärischen Hartnäckigkeit zur unüberbrückbaren Zuspitzung des Verhältnisses mit Hitler. Das Umfeld der sich anbahnenden Entlassung Mansteins wurde auch mitbestimmt durch einen Leitartikel Battle of Russia des amerikanischen Magazins Time vom 10. Januar 1944, auf dessen Titelseite Manstein zudem abgebildet war. In dem Artikel wurde Mansteins Können auf ungewöhnliche Art dargestellt und neben seiner Loyalität zum Staatschef die Loyalität gegenüber dem Staat herausgestellt. Der Artikel vertrat die These: „Sogar für den geradlinigen Manstein mag ein solcher Verrat annehmbar sein. Denn ebenso wie andere Junker ist er erzogen worden im Geiste der immer gültigen Lektionen des Junkers Carl von Clausewitz“. Damit wurde die Frage des Verrats am Staatsoberhaupt im Interesse eines legitimen Kampfes gegen einen Tyrannen aufgeworfen und Manstein durch diese kaum versteckte Aufforderung mit dem militärischen Widerstand in Verbindung gebracht. Am 27. Januar 1944 provozierte Manstein Hitler bei einem Treffen der Feldmarschälle in der Wolfsschanze mit dem Einwurf, dass unbedingter Gehorsam und Loyalität Hitler gegenüber selbstverständlich sei. Hitler fasste das als Affront und „als hinterlistigen Anwurf auf“. Am 30. März 1944 entliess Hitler Manstein als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Süd und versetzte ihn in die Führerreserve, verlieh ihm aber gleichzeitig die Schwerter zum Eichenlaub des Ritterkreuzes. Eine weitere Verwendung, etwa auf dem Posten des Generalstabschefs des Heeres, erfolgte nicht mehr, obwohl er hierfür geeignet gewesen wäre. Als Alternative erwartete er auch vergeblich die Wiedereinberufung als Oberbefehlshaber West. Manstein wurde am 26. August 1945 von britischen Truppen interniert.
1946 Zeuge im Nürnberger Prozess
In der Gefängniszelle des Nürnberger Justizpalastes arbeitete von Manstein zusammen mit Walther von Brauchitsch, Franz Halder, Walter Warlimont und Siegfried Westphal intensiv an der Verteidigung des als verbrecherische Organisationen angeklagten OKW und des Heeresgeneralstabs. Dazu wurde er am 10. August 1946 als Zeuge im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher gehört. Der Gerichtshof beurteilte Generalstab und OKW formal nicht als „Gruppe“ oder „Organisation“ im Sinne der Gerichtssatzung und verordnete die Durchführung von Einzelverfahren. Von Manstein wurde 1948 aus der Kriegsgefangenschaft entlassen und unmittelbar anschliessend in Haft genommen.
Generalfeldmarschall Friedrich Paulus
Friedrich Wilhelm Ernst Paulus (* 23. September 1890 in Guxhagen; † 1. Februar 1957 in Dresden-Oberloschwitz) war ein deutscher Heeresoffizier (ab 1943 Generalfeldmarschall) und im Zweiten Weltkrieg Oberbefehlshaber der 6. Armee während der Schlacht von Stalingrad. Am 4. Juli 1912 heiratete er die rumänische Adelstochter Constance Elena Rosetti-Solescu (* 25. Januar 1889; † 9. November 1949), die Schwester eines Regimentskameraden. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor: Olga, verh. von Kutzschenbach (1914–2003) und die 1918 geborenen Zwillinge Friedrich († 29. Februar 1944 in der Schlacht von Anzio) und Ernst Alexander († 1970). Paulus war von 1943 bis 1953 in sowjetischer Kriegsgefangenschaft und lebte danach bis zu seinem Tod in der DDR.
Kaiserreich und Erster Weltkrieg
Nach dem Umzug seiner Familie nach Kassel schloss Friedrich Paulus seine Schulzeit am dortigen Wilhelmsgymnasium 1909 mit dem Abitur ab. Sein ursprüngliches Ziel, Offizier bei der Kaiserlichen Marine zu werden, konnte er nicht verwirklichen, da er abgelehnt wurde. Stattdessen schrieb er sich an der Philipps-Universität Marburg für Rechtswissenschaften ein. Nach einem Semester verliess er die Universität wieder und trat am 18. Februar 1910 als Fahnenjunker in das Infanterie-Regiment „Markgraf Ludwig Wilhelm“ (3. Badisches) Nr. 111 der Preussischen Armee in Rastatt ein, wo er am 18. Oktober 1910 zum Fähnrich ernannt wurde. Nach dem Besuch der Kriegsschule Engers avancierte er am 15. August 1911 zum Leutnant. Vor Kriegsausbruch war er Adjutant des III. Bataillons.
Nach dem Kriegsausbruch und der Verlegung seines Regiments nach Freiburg im Breisgau am 6. August 1914 wurde Paulus’ Verband wenig später an der Westfront eingesetzt. Das Rastatter Regiment wurde zunächst zur Unterstützung der deutschen Truppen eingesetzt, die unmittelbar nach Kriegsbeginn durch das französische Heer auf das rechte Rheinufer zurückgeworfen worden waren. Das französische Heer hatte durch die Vogesen Mülhausen erreicht und einen grossen Teil des Oberelsass besetzt. Die Kämpfe um die Rückeroberung des Sundgaus begannen am 9. August, am 13. wurde Belfort von deutschen Truppen besetzt. Zwei Tage später wurde Paulus’ Regiment nach Strassburg transportiert. Bei Saarburg erlitt der Verband bei wiederholten Sturmangriffen gegen französische Stellungen schwere Verluste, konnte aber anschliessend die Verfolgung der flüchtenden Feinde aufnehmen. Mitte September wurde das Regiment in die Region zwischen Nancy und Metz (Festung Metz) verlegt, von wo aus es zwischen den französischen Festungen Toul und Verdun nach Westen vorstossen sollte. Dieser Plan war erfolglos, der Durchbruch misslang. Am 8. Oktober, mittlerweile im Einsatz zwischen Lille und Arras, meldete sich Paulus krank.
Nach einer längeren Krankheit war er erst 1915 wieder voll verwendungsfähig und wurde als Ordonnanzoffizier beim Stab des Pommerschen Jäger-Bataillons „Fürst Bismarck“ Nr. 2 eingesetzt. Im Mai 1916 stieg Paulus, mittlerweile zum Oberleutnant befördert, zum Bataillonsadjutanten auf. Das Bataillon wurde, im Rahmen des im Mai 1915 neu aufgestellten Deutschen Alpenkorps, zunächst in Südtirol zur Verteidigung der Grenze Österreich-Ungarns gegen Italien eingesetzt. Im Oktober 1915 kam es nach Serbien und stand im Februar 1916 in Mazedonien. Wenig später kämpfte Paulus mit seinem Bataillon an der Westfront, zunächst (März 1916 bis Mai 1916) in der Champagne, dann (bis August 1916) in der Schlacht um Verdun. Es folgten bis zum September 1916 die Teilnahme an den Kämpfen in den Argonnen und danach der Krieg in Rumänien. Dort blieb er, von einem kurzen Einsatz in den Vogesen im Mai/Juli 1917 abgesehen, bis zum September 1917. Ab September 1917 Teilnehmer der Isonzoschlachten, wurde er im Frühjahr 1918 mit seinem Regiment nach Flandern verlegt. Er war unterdessen als für das Nachrichtenwesen zuständiger Dritter Generalstabsoffizier seines Korps zum Hauptmann befördert und im Mai 1918 in den Stab des Reserve-Infanterie-Regiments Nr. 48 versetzt worden, das aber nicht mehr zum Einsatz kam. Deshalb nahm er an den Kämpfen in Flandern nicht mehr teil.
Die Kriegszeit hatte auf Paulus in mehrfacher Hinsicht weitreichende Auswirkungen. Bei den Einsätzen auf dem Balkan erkrankte er an der Amöbenruhr, von der er sich zeitlebens nicht mehr völlig erholte. Abgesehen von der Beförderung zum Hauptmann wurde er mit beiden Klassen des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet. Er hatte aber auch die Eskalation der Kriegsführung erlebt. In den Materialschlachten wurde der Gegner gnadenlos bekämpft, die örtliche Bevölkerung durch Geiselnahmen und Erschiessungen eingeschüchtert. Paulus erlebte in Serbien den Bewegungskrieg und in der „Hölle von Verdun“ den Stellungskrieg. Prägend wurde für ihn auch ein starkes elitäres Bewusstsein, da er einer bereits gut motorisierten Eliteeinheit angehörte. Sein Vorbild fand er in dem erzkonservativen Truppenführer Franz Ritter von Epp.
Weimarer Republik
Nach dem Krieg war Paulus seit Ende 1918 Angehöriger eines Freikorps beim Grenzschutz Ost, das gegen die Besetzung schlesischer Gebiete durch polnische Truppen kämpfte. Er war in der Organisation des Freiwilligeneinsatzes sowie der Werbung und Rekrutierung eingesetzt, nahm aber selbst nicht an Kämpfen teil.
1919 wurde Paulus in die vorläufige Reichswehr übernommen, 1920 wurde er in Konstanz Regimentsadjutant des 14. Infanterie-Regiments. Paulus sympathisierte mit den Kapp-Putschisten, konnte aber seine Karriere dennoch zielstrebig fortsetzen. In Stuttgart war er von 1924 bis 1927 als Generalstabsoffizier eingesetzt und erhielt anschliessend als Kompaniechef im 13. Infanterie-Regiment sein erstes Truppenkommando. Hier lernte er Erwin Rommel kennen, der Kompaniechef der Maschinengewehrkompanie war. Danach war Paulus bis 1931 als Taktiklehrer in der Division tätig und machte in dieser Funktion durch seine operative Begabung auf sich aufmerksam. Im Februar 1931 wurde er an die Kriegsschule nach Berlin versetzt und zum Major ernannt. Als Lehrgangsleiter für Taktik und Kriegsgeschichte wurde er in der Offiziersausbildung eingesetzt.
Zeit des Nationalsozialismus
Vorkriegszeit
In der Reichshauptstadt wurde Paulus Zeuge der Machtübernahme der NSDAP; seine persönliche Einstellung dazu ist nicht dokumentiert. Das Offizierkorps blieb eher indifferent, da die Reichswehr an der unmittelbaren Verfolgung der politischen Gegner und den Strassenschlachten nicht beteiligt war. Lediglich die Ambitionen der SA wurden mit Beunruhigung gesehen.
Seit April 1934 Kommandeur der Kraftfahr-Abteilung 3 in Wünsdorf nahe Berlin, wurde Paulus mit seinem Verband während des Röhm-Putsches zwar in Alarmbereitschaft versetzt, kam jedoch nicht zum Einsatz.
Die 1935 wieder eingeführte Wehrpflicht sowie die verstärkte Aufrüstung fanden ausdrücklich Zustimmung im Offizierskorps. Paulus profitierte von dieser Entwicklung, als er 1935 zum Oberst befördert und im September zum Chef des Generalstabs der Kraftfahrtruppen ernannt wurde. Hier war er massgeblich am Aufbau und an der Entwicklung der deutschen Panzerwaffe beteiligt. Nach vier Jahren wurde er Anfang 1939 Chef des Generalstabs des XVI. Armeekorps unter dem Kommando Generalleutnant Erich Hoepners, gleichzeitig wurde er zum Generalmajor ernannt.
Zweiter Weltkrieg
Die Mobilmachung 1939 brachte Paulus den Posten als Chef des Generalstabs der 10. Armee in Leipzig, die nach dem Sieg über Polen am 10. Oktober 1939 in 6. Armee umbenannt wurde. Als rechte Hand von Oberbefehlshaber Generaloberst Walter von Reichenau nahm Paulus am Polenfeldzug und am Westfeldzug teil, dabei gelangte er im Osten über Częstochowa, Kielce, Radom und Lublin bis nach Warschau, im Westen über Lüttich, Flandern, Lille, die Somme, Oise, Aisne, Marne und Seine nach Orléans und über die Loire bis an die Kanalküste in der Normandie, die sein Verband Ende Juli 1940 erreichte.
Oberquartiermeister I
Am 3. September 1940 trat Paulus seine neue Stelle als Oberquartiermeister I beim Generalstab des Heeres an. Damit war er Stellvertreter des Generalstabschefs Franz Halder. Über ihm standen nur noch Halder und der Oberbefehlshaber des Heeres, Generalfeldmarschall Walther von Brauchitsch. Erste Operationsstudien für den von Hitler befohlenen Angriff auf die Sowjetunion, das Unternehmen Barbarossa, lagen bereits vor. Paulus übernahm nun die detaillierte Ausarbeitung des operativen Vorgehens. Er erkannte die Notwendigkeit eines schnellen Vorstosses mit dem Ziel der Eroberung Moskaus. Um die Sowjetunion schnell niederwerfen zu können, war es nach seinem Dafürhalten notwendig, mit schnellen Panzerverbänden vorzustossen und zu verhindern, dass kampfkräftige feindliche Verbände in die Weite des Raumes abziehen konnten. Für den Fall, dass dieser Plan nicht gelang, sah der Generalstab einen lange dauernden Krieg voraus, dem die Wehrmacht schwerlich gewachsen wäre. Am 18. Dezember 1940 gab Hitler den Befehl, den Angriff in die Wege zu leiten.
Im ersten Halbjahr 1941 war Paulus an den Verhandlungen mit den deutschen Verbündeten für den Krieg gegen die Sowjetunion beteiligt. Sein Anteil an der Vorbereitung des Unternehmens Barbarossa beschränkte sich somit nicht nur auf Planspiele, sondern schloss auch die aktive Abstimmung mit den anderen Partnern der Achse mit ein.
Am 24. April wurde Paulus nach Nordafrika gesandt, wo seit Februar 1941 das Deutsche Afrikakorps das italienische Heer im Kampf gegen die britische Armee unterstützte. Der Generalstab stand den Offensiven Rommels skeptisch gegenüber, da sie nicht von dauerhaftem Erfolg gekrönt waren und für den Angriff auf die Sowjetunion benötigte Ressourcen banden. Ein verzögerter Angriffstermin aber würde es unmöglich machen, die Kampfhandlungen vor Beginn der herbstlichen Schlammperiode siegreich zu Ende zu führen. In Nordafrika nahm Paulus am 30. April und 1. Mai am erfolglosen Angriff auf die Festung Tobruk teil, flog dann am 8. Mai nach Rom zu einem Treffen mit dem Duce Benito Mussolini. Von Rom aus kehrte er zwei Tage später nach Berlin zurück.
Am 22. Juni 1941 begann der Feldzug gegen die Sowjetunion. Nach anfänglichen grossen Erfolgen der deutschen Truppen geriet der Vormarsch in den Monaten August und September 1941 durch das Hereinbrechen der Schlammperiode ins Stocken. Hitler, der von Anfang anstatt einer militärischen Kriegführung eine wirtschaftliche angestrebt hatte, entschloss sich nun gegen den heftigen Widerstand des Generalstabes des Heeres, das Hauptgewicht auf die Besetzung des wichtigen Industriegebietes im Donezbecken zu legen und gleichzeitig an dem Ziel der Eroberung Leningrads festzuhalten. Diese gelang nicht, es kam zur jahrelangen Leningrader Blockade. Damit fehlten der Wehrmacht die Kräfte für die Einnahme Moskaus und ein langwieriger Krieg stand bevor. In dieser Situation schickte Generalstabschef Halder Paulus zur Beurteilung der örtlichen Lage an verschiedene Frontabschnitte. Im August 1941 besuchte er auch die 6. Armee und ihren Oberbefehlshaber von Reichenau im Abschnitt der Heeresgruppe Süd. Hier erkrankte er wieder an der Amöbenruhr, zudem machte er auf Beobachter einen müden und überarbeiteten Eindruck. Obwohl Paulus wusste, dass Hitler sich mit der Einschätzung, die Sowjetunion würde schnell zusammenbrechen, geirrt hatte, versah er seinen Dienst dennoch pflichtschuldig und gestand Hitler die Entscheidungsgewalt zu.
Verwendung an der Ostfront
Am 3. Dezember 1941 wurde von Reichenau als Oberbefehlshaber der 6. Armee in Personalunion zum Chef der Heeresgruppe Süd ernannt. Er erinnerte sich seines fähigen Untergebenen aus den Jahren 1939 und 1940 und wünschte sich diesen zu seiner Entlastung auf den Posten des Oberbefehlshabers der 6. Armee. Tatsächlich wurde Paulus am 5. Januar 1942 unter gleichzeitiger Beförderung zum General der Panzertruppe dazu ernannt. Er trat seinen Posten allerdings erst an, nachdem von Reichenau an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben war. Seine Nominierung stiess auch auf Kritik: So waren nicht nur dienstältere Offiziere übergangen worden, Paulus verfügte auch kaum über Kommandoerfahrung. Er hatte noch nicht einmal eine Division oder ein Armeekorps geführt und bekam nun Befehlsgewalt über eine ganze Armee mit rund 300’000 Mann. Am 20. Januar trat Paulus seinen neuen Posten bei der im Grossraum Charkow liegenden Armee an.
Mit ihm änderte sich der Führungsstil des AOK 6: Während von Reichenau ein „Troupier“ und „Haudegen“ gewesen war, führte Paulus seine Armee eher vom Schreibtisch aus. Erste Amtshandlung von Paulus als neuer Oberbefehlshaber war die Aufhebung des Befehls von Reichenaus, der deutsche Soldat habe „Träger einer unerbittlichen völkischen Idee“ zu sein. Gleichzeitig sprach er sich gegen die weitere Befolgung des Kommissarbefehls in seinem Armeebereich aus. Er konnte sich mit dieser Haltung freilich nicht bei allen seinen Kommandeuren durchsetzen.
Die Angriffe der Roten Armee seit Mitte Januar 1942 nördlich Charkow konnte die 6. Armee abweisen. Am 12. Mai begann ein massiver sowjetischer Grossangriff in dieser Region. Paulus bewährte sich und ging siegreich aus der Zweiten Schlacht um Charkow hervor. 20’000 Mann eigenen Verlusten standen allein knapp 240’000 gefangengenommene Rotarmisten gegenüber. Damit verstummten alle seine Kritiker, die ihm vorgeworfen hatten, keine Ahnung von der Führung einer Armee zu haben. Nach diesem militärischen Desaster waren die Sowjets soweit geschwächt, dass das Unternehmen Blau beginnen konnte, der Angriff auf das Donezbecken und den Kaukasus. Am 23. Juli bekam die 6. Armee den Auftrag, anders als ursprünglich geplant, allein gegen Stalingrad zu marschieren, während die Masse der deutschen Truppenverbände weiter im Südabschnitt gegen den Kaukasus vorstiess. Paulus warnte noch am 29. Juli den persönlichen Adjutanten Hitlers, dass die 6. Armee zu schwach sei, um allein die Stadt einzunehmen. Er erhielt aber nur die Zusage einer gewissen Unterstützung durch Verbände der am Südflügel der 6. Armee stehenden 4. Panzerarmee.
Stalingrad
Bereits in der Frühphase des Angriffs auf Stalingrad bestanden erhebliche Nachschubschwierigkeiten, unter anderem auch wegen der Sprunghaftigkeit Hitlers, so dass sich die Überquerung des Don durch die 6. Armee um acht Tage verzögerte. Dies gab der Roten Armee genug Zeit, um sich nach Stalingrad zurückzuziehen und die Stadt zu befestigen. Während bis dahin noch eine gewisse Schwerpunktbildung geherrscht hatte, wonach drei Armeen nach Süden vorstossen sollten, bekam die 4. Panzerarmee nun ebenfalls Befehl, südlich Stalingrads vorzustossen. Hier wurden erste operative Fehler begangen: Statt die Stadt nach zu besetzenden Schwerpunkten einzuteilen, wurden Angriffsstreifen festgelegt. Nach einigen Tagen Kampf war die Lage schon zu verfahren und zu gefährlich für eine Umgruppierung. So blieb die Fährstelle an der Wolga, der wichtigste Punkt in der Stadt, in sowjetischer Hand. Dennoch war am 4. September das strategische Ziel erreicht: Die Wolga war als Verkehrsweg unterbrochen. Der in den folgenden Wochen erbittert geführte Kampf um die vollständige Einnahme der Stadt wäre nicht notwendig gewesen, wurde aber auf beiden Seiten zu einer „Frage der Ehre“. Den deutschen Truppen gelang es trotz ständig neuer Angriffe jedoch nicht, Stalingrad komplett unter Kontrolle zu bringen.
Paulus, der am 26. August das Ritterkreuz erhalten hatte, erbat angesichts der schlechten Versorgung seiner Soldaten die Einstellung der Kämpfe und den Rückzug aus der Stadt: Hunger, Kälte und Seuchen setzten den Soldaten zu; auch Paulus selbst war erneut an der Amöbenruhr erkrankt. Hitler verbot eine Einstellung der Kämpfe; die Front durfte um keinen Meter zurückgenommen werden. Am 19./20. November 1942 durchbrachen die sowjetischen Armeeverbände in einem Grossangriff, der Operation Uranus, die rumänischen Linien nördlich und südlich Stalingrads und schlossen die Stadt vollständig ein. Hitler hatte der Roten Armee diesen Durchbruch nicht mehr zugetraut, obwohl Paulus ihn am 12. September bei einem Gespräch im Führerhauptquartier „Werwolf“ bei Winniza (Ukraine) auf die Gefahr aufmerksam gemacht hatte. Nun sass die 6. Armee in der Falle.
Das Armeeoberkommando (AOK) 6, das durch den sowjetischen Vorstoss von den eigenen Linien abgeschnitten worden war, erhielt am 22. November den Befehl, in den Kessel einzufliegen und sich mit der gesamten Armee einzuigeln. Gleichzeitig bereitete die 6. Armee jedoch ihren Ausbruch vor. Paulus meldete am Abend des gleichen Tages die Einkesselung und bat Hitler um Handlungsfreiheit für den Ausbruch. Hitler gewährte ihm diese nicht; stattdessen erhielt die 6. Armee am 24. November seine endgültige Entscheidung, die Stellungen unter allen Umständen zu halten. Der General der Infanterie Walther von Seydlitz-Kurzbach als Befehlshaber des eingeschlossenen LI. Armeekorps hatte bereits begonnen, seine Verbände in Richtung auf den Ausbruchsschwerpunkt zurückzunehmen. Als Hitler davon erfuhr, verlangte er dafür sofort Rechenschaft von der Armeeführung. Paulus stellte sich vor von Seydlitz, verlangte aber eine Erklärung von ihm; gleichzeitig teilte er den anderen Kommandeuren den Haltebefehl mit. Seydlitz fügte sich zwar, forderte aber in einer Denkschrift an Paulus den sofortigen Ausbruch und erklärte, dass wenn „das OKH den Befehl zum Ausharren in der Igelstellung nicht unverzüglich [aufhebt], so ergibt sich vor dem eigenen Gewissen gegenüber der Armee und dem deutschen Volk die gebieterische Pflicht, sich die […] Handlungsfreiheit selbst zu nehmen und von der […] noch bestehenden Möglichkeit, die Katastrophe […] zu vermeiden, Gebrauch zu machen“. Bei Paulus fand er für diese Position keine Unterstützung, dieser verliess sich auf die oberste Führung und deren besseren Überblick über die Gesamtsituation, worin er durch einen Brief seines neuen Oberbefehlshabers von Manstein bestärkt wurde, der ihm versprach, man werde ihn nicht im Stich lassen. Nach dem Krieg wurde Paulus von verschiedenen Seiten vorgeworfen, nicht auf eigene Verantwortung einen Ausbruch befohlen zu haben.
Trotz der bereits katastrophalen Lage herrschte im Kessel Zuversicht, dass das am 12. Dezember 1942 von der Heeresgruppe Don begonnene Unternehmen Wintergewitter zur Befreiung der 6. Armee zum Erfolg führen würde. Paulus selbst machte einen abgespannten und nervösen Eindruck, offenbar war er mit der Entwicklung unzufrieden, konnte sich aber nicht zu einem Durchbruchsversuch in Richtung Entsatzarmee entschliessen. Die Kräfte der 6. Armee reichten längst nicht mehr für einen erfolgreichen Durchbruch zu den deutschen Linien aus. Der Mangel an Munition, Proviant, Treibstoff, Heiz- und Sanitätsmaterial war so gross, dass die Armee praktisch unbeweglich geworden war.
Der Entsatzangriff musste am 23. Dezember beendet werden, Paulus hoffte angesichts der Unmöglichkeit eines Ausbruchs dennoch auf Hilfe von aussen. In einem Fernschreiben an die Heeresgruppe Don bekundete er am 26. Dezember zwar den unbedingten Durchhaltewillen, bat aber gleichzeitig darum, das Führerhauptquartier zu energischen Massnahmen zu bewegen, da sich die „Festung Stalingrad“ ansonsten trotz ihres Willens zum Widerstand nicht mehr lange gegen die massiven Angriffe würde halten können.
Paulus, der am 30. November 1942 zum Generaloberst befördert wurde, erhielt am 8. Januar 1943 ein Kapitulationsangebot der Roten Armee, gleichzeitig überbrachte aus dem Führerhauptquartier der am selben Tag im Kessel gelandete General der Panzertruppe Hube von Hitler die Nachricht, dass im Februar ein neuer Entsatzversuch geplant sei; so lange habe die Armee auszuhalten. Paulus glaubte nicht, dass ohne verstärkten Nachschub ein weiteres Durchhalten möglich sei, bemerkte aber, dass er die Transportmöglichkeiten durch die Luftwaffe nicht kenne. Das Kapitulationsangebot wurde sowohl vom Oberkommando des Heeres als auch vom AOK 6 abgelehnt, so dass Paulus es schliesslich zurückwies und Befehl gab, sowjetische Parlamentäre durch Beschuss abzuweisen. Der durch Flugblätter und Lautsprecherdurchsagen von der Roten Armee informierten Truppe liess er mitteilen, dass es sich lediglich um Propaganda und Täuschung handle.
Am Morgen des 10. Januar 1943, einem Sonntag, begann um sechs Uhr früh mit 47 Divisionen der sowjetische Generalangriff auf die 6. Armee. Mit 218’000 Soldaten, über 5’000 Geschützen, 170 Panzern sowie 300 Flugzeugen wurde der Kessel von Westen her zusammengedrückt. Die 6. Armee hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen: Am 14. Januar ging der provisorische Landeplatz Basargino, am 16. Januar schliesslich der Flugplatz Pitomnik verloren. Die Verzweiflung der Eingeschlossenen erreichte ihren Höhepunkt: Tausende versuchten, vom verbliebenen Behelfsflugplatz Gumrak ausgeflogen zu werden. Der grösste Teil der Armee flüchtete aber bereits in die Ruinenstadt von Stalingrad, die einen gewissen Schutz gegen die feindlichen Angriffe verhiess. Angesichts der Härte der Kämpfe erhielt Paulus am 15. Januar das Eichenlaub zum Ritterkreuz.
Die kommandierenden Offiziere im Kessel waren sich der Lage bewusst. Das Versprechen Hitlers, die Armee zu retten, sahen sie durch die Luftwaffe sabotiert. Ein Major, der zur Inspektion des Flugplatzes Gumrak eingeflogen war, musste sich heftigste Vorwürfe machen lassen. Das Spektrum der Emotionen der Armeeführung reichte von bemühter Objektivität (Seydlitz) über hochgradige Nervosität (Paulus) bis zum Wutanfall des Stabschefs Arthur Schmidt. Ihr Glaube an Hitler war dennoch ungebrochen. Als am 22. Januar der Flugplatz Gumrak verloren ging, funkte Paulus erkennbar verzweifelt und hilflos an das OKH:

„Russe im Vorgehen in 6 km Breite beiderseits Woroponowo, zum Teil mit entrollten Fahnen nach Osten. Keine Möglichkeit mehr, Lücke zu schliessen. Zurücknahme in Nachbarfronten, die auch ohne Munition, zwecklos und nicht durchführbar. Ausgleich mit Munition von anderen Fronten auch nicht mehr möglich. Verpflegung zu Ende. Über 12’000 unversorgte Verwundete im Kessel. Welche Befehle soll ich den Truppen geben, die keine Munition mehr haben und weiter mit starker Artillerie, Panzern und Infanteriemassen angegriffen werden? Schnellste Entscheidung notwendig, da Auflösung an einzelnen Stellen schon beginnt. Vertrauen zur Führung aber noch vorhanden“.
Als Folge dieses Funkspruchs verwendete sich auch Paulus’ Vorgesetzter v. Manstein gegenüber Hitler für die Aufnahme von Kapitulationsverhandlungen, die Hitler aber weiterhin ablehnte: Schon aus Gründen der Ehre würde eine Kapitulation nicht in Frage kommen.
Paulus fügte sich und forderte seine Truppen weiter zum Durchhalten auf. Am 25. Januar 1943 verliess vom Behelfsplatz Stalingradski das letzte Flugzeug den Kessel, jetzt musste jeglicher Nachschub abgeworfen werden, wobei der grösste Teil verlorenging. Bis Ende Januar gelang es den Sowjets, den Kessel in einen nördlichen und einen südlichen Teil zu spalten. Paulus und sein Stab befanden sich im Univermag-Kaufhaus im Südteil. Tatsächlich hatte er aber die Befehlsgewalt über die Verbände schon weitgehend verloren: Einzelne Kommandeure bereiteten die Kampfeinstellung vor und gingen mit ihren Truppenteilen in Gefangenschaft. Andere versuchten, mit ihren Gruppen auszubrechen: Einer einzigen Gruppe gelang das Unternehmen, aber nur ein Mann kam durch. Viele Offiziere begingen Selbstmord oder suchten den Tod im feindlichen Feuer: Beim IV. Armeekorps führte am 24. Januar der Kommandeur der 297. ID die Reste seiner Division in die Gefangenschaft, am Abend des 25. Januar erschoss sich der Kommandeur der 371. ID, Generalleutnant Richard Stempel, und am nächsten Morgen stellten sich die Kommandeure des IV. Armeekorps, der 71. Infanterie-Division und der Artillerieabteilung IV. Armeekorps auf den Bahndamm an der Zariza und schossen ohne Deckung auf die Russen. Bis Paulus davon erfuhr und ihnen befahl, die Linien zurückzunehmen, war einer bereits tot. Während Paulus anderen Offizieren die Initiative überliess, hielt er sich an den gegebenen Befehl, durchzuhalten, und liess noch am 29. Januar eine Ergebenheitsadresse an Hitler funken. Der Funkspruch lautete:

„An den Führer! Zum Jahrestage Ihrer Machtübernahme grüsst die 6. Armee ihren Führer. Noch weht die Hakenkreuzfahne über Stalingrad. Unser Kampf möge den lebenden und kommenden Generationen ein Beispiel dafür sein, auch in der hoffnungslosesten Lage nie zu kapitulieren, dann wird Deutschland siegen. Heil mein Führer! Paulus, Generaloberst“.
Dafür wurde er am 30. Januar, quasi in letzter Minute, zum Generalfeldmarschall befördert. Am 31. Januar drangen morgens Truppen der Roten Armee in das Kaufhaus „Univermag“ ein, wo sich im Keller das Hauptquartier der 6. Armee befand. Um 7:35 Uhr gab die dortige Funkstation ihre letzten beiden Meldungen ab: „Russe steht vor der Tür. Wir bereiten Zerstörung vor“. Kurz darauf: „Wir zerstören“.
Offiziere aus dem Hauptquartier von General Michail Schumilow führten daraufhin mit General Arthur Schmidt die Übergabeverhandlungen, während sich Paulus in einem Nebenraum vom Adjutanten der 6. Armee Oberst Wilhelm Adam informieren liess. Er wurde anschliessend in seinem eigenen Stabs-Mercedes zum Hauptquartier der Donfront bei Zawarykino gefahren, 80 km von Stalingrad entfernt.
Gefangenschaft
Paulus wurde per se ohne eigene Mitwirkung am 31. Januar 1943 Kriegsgefangener der Roten Armee. Zunächst wurde er von der sowjetischen Armeeführung durch den späteren Marschall der Sowjetunion, Konstantin Rokossowski, am 2. Februar 1943 um 4 Uhr nachmittags verhört: Er leugnete vehement, der Südkessel habe kapituliert, sondern bestand darauf, man habe lediglich aus Munitionsmangel den Kampf einstellen müssen. Ausserdem weigerte er sich trotz mehrfacher Aufforderung, dem noch kämpfenden Nordkessel von Stalingrad die Einstellung der Kampfhandlungen zu befehlen. Er sagte, er habe keine Befehlsgewalt über diesen, weil er sich nicht bei der Truppe befinde. Am 20. Februar 1943 wurden Paulus und sein Stab dann in das Kriegsgefangenenlager Nr. 27 in Krasnogorsk bei Moskau verlegt, wo sie sechs Wochen blieben, bevor sie weiter ins Lager Nr. 160 in Susdal kamen.
Die Offiziere der Stalingrad-Armee unterlagen seit ihrer Gefangennahme geheimer Überwachung durch das NKWD, das regelmässig Dossiers über deren politische Haltung erstellte. Mitte Mai 1943 wurde über Paulus berichtet, dass er bemüht sei, Haltung zu bewahren, und damit rechne, bei sich bietender Gelegenheit gegen einen russischen General ausgetauscht zu werden, zudem begrüsse er seine Offiziere weiterhin mit „Heil Hitler“ und lehne die sozialistischen Feiern zum 1. Mai ab.
Bei einem Besuch Wilhelm Piecks, der Werbung für das neu zu begründende Nationalkomitee Freies Deutschland machen wollte, zeigte er sich jedoch – anders als der grösste Teil der Offiziere, die Pieck lediglich Verachtung entgegenbrachten – gesprächsbereit. In diesem Gespräch gestand er seine Enttäuschung über Hitler ein, beharrte aber darauf, dass er als Soldat unter allen Umständen zu gehorchen habe. So weigerte er sich entschieden, zur Gründung des Komitees beizutragen.
Nach der Verlegung in das Kriegsgefangenenlager 5110/48 Woikowo im Juli 1943 musste sich Paulus als ranghöchster Offizier als Schlichter in Streitigkeiten zwischen der Gruppe, der zur Mitarbeit beim NKFD bereiten Soldaten und den übrigen Lagerinsassen betätigen. Zudem wurde er von General von Seydlitz, dessen Vorgesetzter er im Kessel von Stalingrad noch gewesen war, bedrängt, an der Gründung des NKFD teilzunehmen, da von der Teilnahme eines so hochdekorierten Soldaten Signalwirkung erwartet wurde. Paulus begründete seine Weigerung aber mit dem Hinweis, dass er als Kriegsgefangener nicht gegen seine politische Führung Stellung beziehen dürfe. Eine von ihm mitunterschriebene Erklärung, die die Mitglieder des Bundes Deutscher Offiziere (BDO) des Landesverrats bezichtigte, fand allerdings ebenso wenig seine innere Zustimmung.
Die sowjetischen Behörden liessen in ihrem Bemühen dennoch nicht nach und verlegten ihn ohne seine Begleitung nach Saretschje bei Lunowo/Moskau. Nachdem am 11./12. September in Lunowo der BDO ohne Paulus gegründet werden musste, wurde der Druck auf den Feldmarschall grösser: Er durfte nur noch mit Angehörigen des BDO Kontakt haben, diese wie auch seine sowjetischen Bewacher drängten ihn zum Beitritt. Paulus beschwerte sich: Er teile die Meinung seiner Stubengenossen nicht, tue das aber nicht aus Borniertheit, sondern weil er sich zu einer Entscheidung in dieser Angelegenheit nicht in der Lage fühle. Bis zum 20. Juli 1944 wurde er daher zurück nach Woikowo gebracht, nach dem Attentat auf Hitler aber erneut für zwei Wochen unter Druck gesetzt, bis Paulus sich zu einer Kooperation bereit erklärte. Der Grund lag im Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei, die zu einer Landung der Alliierten auf dem Balkan führen würde, der Krieg sei damit für Deutschland verloren. Am 8. August 1944 unterschrieb er daher einen Appell an das deutsche Volk, in dem er es aufrief, sich von Hitler loszusagen.
Mit seinem langen Zögern bzw. mit seinem Einschwenken auf die sowjetische Linie erntete Paulus beim BDO bzw. den anderen deutschen Kriegsgefangenen nur Empörung. Die Angehörigen des BDO vertraten den Standpunkt, dass Paulus keine leitende Funktion haben könne, da seine Unentschlossenheit ihn unglaubwürdig gemacht habe. Auch im Ausland stiess sein Schritt auf Befremden, da doch gerade Paulus Hitlers Befehle bedingungslos und bis in die letzte Konsequenz befolgt hatte. In Deutschland wurden seine Angehörigen in Sippenhaft genommen, seine Frau kam ins KZ Dachau und sein Sohn nach Immenstadt in Festungshaft. Paulus selbst überschätzte seinen Einfluss und versuchte, andere Offiziere vom Beitritt zu überzeugen, zudem stellte er sich einen neuen Stab zusammen. Zwei Aufrufe an die Heeresgruppe Nord und die neuaufgestellte 6. Armee, die Waffen niederzulegen, blieben ohne Resultat. Am 30. Oktober 1944 bat er Stalin um ein Gespräch, um ihm die Aufstellung deutscher Freiwilligenverbände – vergleichbar zur auf deutscher Seite eingerichteten Russischen Befreiungsarmee unter Andrei Andrejewitsch Wlassow – vorzuschlagen. Angesichts der Erfolg- und Bedeutungslosigkeit des NKFD und des BDO, sowohl unter den deutschen Kriegsgefangenen als auch bei der kämpfenden Truppe, blieb sein Ersuchen ohne Reaktion.
Nachkriegszeit
Zeuge der Anklage in Nürnberg
Die Ankündigung der Prozesse gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher war im November 1945 Grund für grosse Unruhe unter den kriegsgefangenen Offizieren, die in Stalingrad gekämpft hatten: Ein Anklagepunkt bezog sich auf die Tötung von 40’000 Zivilisten im Raum Stalingrad. Untergebene von Paulus wiesen jede Verantwortung dafür von sich und verwiesen auf ihn als Vorgesetzten. Möglicherweise veranlasste ihn das zur Zusammenarbeit mit der Sowjetunion: Er machte dem NKWD-Verbindungsoffizier deutlich, dass er zur Vorbereitung des Russlandfeldzuges und zu dem Wissen der Generalität aussagen wolle.
Unter dem Decknamen „Satrap“ wurde Paulus Anfang 1946 nach Deutschland geflogen und trat am 11. Februar unter sowjetischer Protektion im Gericht als Zeuge der Anklage auf. Er berichtete über seine eigene Rolle bei der Vorbereitung von Unternehmen Barbarossa und dessen Charakter eines Eroberungs- und Vernichtungskrieges, der den Angeklagten nicht verborgen geblieben sei. Nach den Hauptschuldigen befragt, nannte er Wilhelm Keitel, Alfred Jodl und Hermann Göring. Der Verteidigung gelang es nicht, seine Aussagen durch Vorhaltung seiner Rolle im Generalstab, in der 6. Armee und im NKFD abzuweisen, da die Richter diese Aspekte nicht für relevant hielten. Paulus’ Aussage erfüllte in vollem Umfang die Erwartungen seiner sowjetischen Betreuer. Paulus nützte das freilich nichts: Ein Wiedersehen mit seiner schwerkranken Frau blieb ihm mangels „Zweckdienlichkeit“ verwehrt. Sie starb 1949, ohne ihren Mann noch einmal gesehen zu haben.
Der Auftritt des Feldmarschalls fand bei Soldaten und Offizieren in sowjetischer Gefangenschaft ein geteiltes Echo: Die meisten hielten es für würdelos und ihn für nicht weniger schuldig als Keitel, Jodl und Göring. Sehr viele gingen deshalb auch davon aus, dass man ihm später selbst den Prozess machen würde. Paulus wurde nach seiner Rückkehr nicht in das allgemeine Lager zurückgebracht, sondern in eine Datscha in Tomilino verlegt. Ausser ihm waren dort noch die Generale Vincenz Müller und Arno von Lenski untergebracht; Paulus’ Adjutant, Oberst Wilhelm Adam, war ebenfalls häufiger anwesend. Zur Genesung nach einer verschleppten Lungentuberkulose verbrachten sie im Sommer 1947 zwei Monate auf der Krim. Eine Änderung trat 1948 ein, als – im Gegensatz zu Paulus selbst – die Offiziere entlassen wurden, so dass ihm lediglich als Koch und Ordonnanz zwei deutsche Kriegsgefangene verblieben. Dies und die Nachrichten über den sich stetig verschlechternden Gesundheitszustand seiner Frau führten bei Paulus zu zunehmenden Depressionen. Im Juni 1948 bat er daher um Repatriierung in die Sowjetische Besatzungszone, da er beim Aufbau eines demokratischen, eng mit der Sowjetunion verbundenen Deutschland mithelfen wolle. Anscheinend rechnete er sich damit grössere Chancen aus, entlassen zu werden. Diese Bitte blieb unbeantwortet. Paulus ahnte, dass man begonnen hatte, gegen ihn zu ermitteln. Theaterbesuche in Moskau waren ihm nicht mehr gestattet, Funktionäre besuchten ihn nicht mehr, und man hatte ihm unter einem Vorwand das Radio weggenommen. Obwohl 1949 genügend belastende Hinweise vorlagen, kam es jedoch zu keiner Anklage gegen ihn.
Der Tod seiner Frau im November 1949 wurde ihm vier Wochen lang verheimlicht: Es sollte vermieden werden, dass Paulus seine Zusage, in die DDR überzusiedeln, zurückzog, nachdem ihm nur noch Sohn und Tochter geblieben waren, die beide in der Bundesrepublik Deutschland wohnten. Aus diesem Grund wurde einem erneuten Ersuchen im Mai 1950 lediglich prinzipiell zugestimmt, die konkrete Erlaubnis blieb aber aus. In einem Bericht von 1953 heisst es: „Im Weiteren wurde die Repatriierung von Paulus bis auf besondere Anordnung verschoben, danach wurde die Frage nicht mehr geprüft“. Im September 1953 kam es noch zu einem Treffen zwischen Walter Ulbricht und Paulus, bei dem seine Rückkehr besprochen wurde. Bevor Paulus am 24. Oktober 1953 mit seinen beiden Bediensteten den Zug nach Frankfurt (Oder) bestieg, schrieb er voller Dankbarkeit noch eine weitere Ergebenheitsadresse an die Sowjetunion, mit der er sich in den Augen der westdeutschen Öffentlichkeit endgültig zum Verräter und „Wendehals“ abstempelte.
Weiteres Leben
Am 26. Oktober 1953 betrat Paulus erstmals seit 1946 wieder deutschen Boden. Am Bahnsteig wurde er von Arno von Lenski und Wilhelm Adam empfangen. Anschliessend wurde er nach Ost-Berlin zu einem offiziellen Empfang der Staats- und Parteiführung der DDR gebracht. Sein Name hatte wieder Gewicht gewonnen, seit Bundeskanzler Adenauer die Bundesrepublik auf Westkurs geführt hatte. Die DDR wollte mit Prominenten, die sie unterstützten, gegensteuern. So bekam Paulus als Wohnung eine Dresdner Villa am Weissen Adler in Oberloschwitz zugewiesen und erhielt das Privileg einer eigenen Handfeuerwaffe sowie eines westdeutschen PKW, eines Opel Kapitän.
Paulus stand seit seiner Ankunft als „Objekt Terrasse“ unter der Überwachung durch die Staatssicherheit. Ein Teil seiner Bediensteten waren Zuträger des Geheimdienstes, seine Post wurde kontrolliert, das Telefon und die Wohnung wurden abgehört. Einflussreiche Positionen wurden ihm in der DDR nicht übertragen, seine offizielle Funktion war Leiter des Kriegsgeschichtlichen Forschungsrates an der Hochschule der Kasernierten Volkspolizei.
Paulus beschäftigte sich mit der Niederlegung seiner Ansichten sowie in zwei Vorträgen 1954 mit der Schlacht von Stalingrad. 1955 war er die Galionsfigur der SED-Initiative „Gesamtdeutsche Offizierstreffen“, die die Wiederbewaffnung sowie aussenwirtschaftliche und aussenpolitische Westintegration Westdeutschlands verhindern sollte. Während der Treffen wurde er von den Beteiligten West beauftragt, sich um die Freilassung der letzten Kriegsgefangenen zu bemühen. Er wandte sich deswegen an die DDR-Führung, die allerdings den Interessen Moskaus an einer Annäherung an die Bundesrepublik in dieser Phase Tribut zollen musste. Ein zweites Treffen der Initiative rief „zum nationalen Widerstand gegen die Politik der dauernden Spaltung Deutschlands“ auf. Diese Töne und die Beteiligung von Waffen-SS-Offizieren führten zur Beendigung der Treffen durch die DDR. Danach zog sich Paulus, vor allem aus gesundheitlichen Gründen, aus der Öffentlichkeit zurück, da er seit 1955/1956 an amyotropher Lateralsklerose litt, die bei völliger geistiger Klarheit zur Lähmung der Muskulatur führt. Aufgrund seines sich rapide verschlechternden Gesundheitszustandes blieb eine Studie über die Schlacht von Stalingrad, mit der er sich noch zuletzt beschäftigt hatte, unvollendet. Paulus starb am späten Nachmittag des 1. Februar 1957 in seiner Dresdner Villa. Er wurde mit militärischen Ehren auf dem Friedhof von Dresden-Tolkewitz beigesetzt. Seine Urne wurde später in das Familiengrab auf dem Hauptfriedhof in Baden-Baden umgebettet.
Generalfeldmarschall Ewald von Kleist
Paul Ludwig Ewald von Kleist (* 8. August 1881 in Braunfels an der Lahn; † 13. oder 16. November 1954 im Zentralgefängnis Wladimir, Sowjetunion) war ein deutscher Kavallerie-Offizier (ab 1943 Generalfeldmarschall) und während des Zweiten Weltkrieges Oberbefehlshaber verschiedener Armeen und Heeresgruppen der Wehrmacht. Er wurde in Jugoslawien und in der Sowjetunion wegen Kriegsverbrechen verurteilt.
Kaiserreich und Erster Weltkrieg
Ewald von Kleist war Angehöriger des Adelsgeschlechts von Kleist, sein Vater war der geheime Studienrat Christof Hugo von Kleist. Ewald von Kleist trat am 9. März 1900 als Fahnenjunker in das Feldartillerieregiment „Generalfeldzeugmeister“ Nr. 3 ein, wo er am 18. August 1901 zum
Leutnant befördert wurde. Am 22. März 1914 wurde er als Rittmeister zum Leibhusarenregiment Nr. 1 versetzt.
Nach Beginn des Ersten Weltkrieges nahm Ewald von Kleist an der Schlacht bei Tannenberg teil. Von 1915 bis 1918 wurde er als Stabs- und Truppenoffizier an der Westfront verwendet.
Weimarer Republik
Kleist trat 1919 in ein Freikorps ein. Im Baltikum führte er die Angriffsgruppe der Eisernen Division während der Schlacht von Wenden. 1920 wurde er in die Reichswehr übernommen. Ab 1924 war er als Taktiklehrer an der Kavallerieschule in Hannover tätig, bevor er 1928 als Chef des Stabes zur 2. Kavalleriedivision nach Breslau versetzt wurde. Dieselbe Position hatte er anschliessend von 1929 bis 1931 bei der 3. Division in Berlin inne. Der inzwischen zum Oberst beförderte Kleist wurde 1931 Kommandeur des 9. (Preussisches) Infanterie-Regiments in Potsdam und mit Beginn des Jahres 1932 Kommandeur der 2. Kavalleriedivision. Im Oktober 1932 erfolgte in dieser Stellung die Beförderung zum Generalmajor.
Zeit des Nationalsozialismus
Vorkriegszeit
Nachdem er am 1. Dezember 1933 zum Generalleutnant befördert worden war, wurde Kleist im Oktober 1934 Befehlshaber der „Heeresdienststelle Breslau“, aus der das spätere VIII. Armeekorps hervorging. Seit der Enttarnung der Verbände 1935 trug er den Titel des Befehlshabers im neugebildeten Wehrkreis VIII und Kommandierenden Generals des VIII. Armeekorps. Am 1. August 1936 wurde er als solcher zum General der Kavallerie befördert. Im Februar 1938 wurde von Kleist im Zusammenhang mit den Vorgängen während der Blomberg-Fritsch-Krise aus dem Dienst verabschiedet, wobei er die Erlaubnis zum Tragen der Uniform des 8. Kavallerieregiments erhielt. Zur Sicherung seines Ruhestands erwarb er anschliessend ein Gut bei Breslau.
Zweiter Weltkrieg
Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde Kleist reaktiviert und nahm als Befehlshaber des XXII. motorisierten Armeekorps am Überfall auf Polen teil. Dort gelang seinem Korps der Durchbruch durch den Südflügel der polnischen Armee. Im Mai 1940 bildete die „Panzergruppe Kleist“, die allein fünf Panzerdivisionen umfasste, die Spitze des Westfeldzuges. Kleist wurde am 19. Juli 1940 zum Generaloberst befördert und erhielt das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Im April 1941 nahm er mit der Panzergruppe 1 als Teil der 12. Armee unter der Führung von Generalfeldmarschall Wilhelm List am Balkanfeldzug teil. Im Juni des gleichen Jahres führte er im Russlandfeldzug die Panzergruppe 1, die unter anderem für den Durchbruch durch die „Stalin-Linie“ verantwortlich war. Die Panzergruppe 1 erbeutete in den Kesselschlachten von Uman und Kiew zusammen mit der Panzergruppe 2 von Generaloberst Heinz Guderian über 800 sowjetische Panzer und nahm ca. 650’000 Kriegsgefangene. In Anerkennung ihrer Leistungen wurden die Panzergruppen Kleists und Guderians Anfang Oktober 1941 in Panzerarmeen umgewandelt, was eine Gleichstellung ihrer Oberbefehlshaber mit anderen Armeebefehlshabern bedeutete. Am 18. Februar 1942 wurde Kleist zudem mit dem Eichenlaub zum Ritterkreuz ausgezeichnet. Im Sommer 1942 führte er die durch Unterstellung der 17. Armee gebildete „Armeegruppe Kleist“, bis im weiteren Verlauf des Falls Blau Generalfeldmarschall Wilhelm List den Oberbefehl über die für die Operationen im Kaukasus gebildete Heeresgruppe A übernahm. Im selben Jahr erhielt er Grundbesitz im Wert von 567’000 Reichsmark als Dotation.
Kleist wurde am 22. November 1942 neuer Oberbefehlshaber der Heeresgruppe A, die nach der Entlassung Lists im September Hitler zeitweilig persönlich geführt hatte, und am 1. Februar 1943 zum Generalfeldmarschall befördert. Nach wiederholten Meinungsverschiedenheiten mit Hitler über die Kriegsführung im Osten wurde Kleist im März 1944 von diesem entlassen und durch Ferdinand Schörner ersetzt. Infolge des Attentats vom 20. Juli 1944 wurde er von der Gestapo verhaftet, aber anders als sein Verwandter Ewald von Kleist-Schmenzin, der bereits in die Septemberverschwörung involviert gewesen war und enge Kontakte zum Goerdeler-Kreis unterhalten hatte, später freigelassen.
Nachkriegszeit
Kleist wurde Ende April 1945 in Bayern von US-Soldaten verhaftet, an die britische Armee übergeben und von dieser im September 1946 an Jugoslawien ausgeliefert. Dort wurde er wegen Kriegsverbrechen zu 15 Jahren Haft verurteilt. 1948 wurde er an die Sowjetunion ausgeliefert und dort wegen Kriegsverbrechen zu lebenslanger Haft verurteilt. Am 13. oder 16. November 1954 starb er im Gefangenenlager Wladimirowka. Er war der ranghöchste unter den in sowjetischer Kriegsgefangenschaft gestorbenen deutschen Soldaten.
Generalfeldmarschall Maximilian Freiherr von Weichs
Maximilian Maria Joseph Karl Gabriel Lamoral Reichsfreiherr von und zu Weichs an der Glon (* 12. November 1881 in Dessau; † 27. September 1954 auf Schloss Rösberg in Bornheim-Rösberg) war ein deutscher Heeresoffizier (ab 1943 Generalfeldmarschall) und während des Zweiten Weltkrieges Armee- und Heeresgruppen-oberbefehlshaber. Er entstammte dem alten bayerischen Adelsgeschlecht Weichs und war der Sohn eines herzoglich anhaltinischen Oberstallmeisters und Rittmeisters a. D. Weichs verheiratete sich 1928 mit Margarethe von Niesewand.
Bayerische Armee
Weichs trat nach dem Abitur am Wilhelmsgymnasium München 1900 als Fahnenjunker in das 2. Schwere-Reiter-Regiment „Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich-Este“ der Bayerischen Armee in Landshut ein. Dort stieg er bis zum Oberleutnant auf und war von 1905 bis 1908 als Regimentsadjutant eingesetzt. Nachdem Weichs 1908 in München die Equitationsanstalt besucht hatte, absolvierte er von 1910 bis 1913 die Kriegsakademie, die ihm die Qualifikation für den Generalstab und den Referatsdienst aussprach. Im Anschluss wurde Weichs in die Zentralstelle des Generalstabs versetzt und hier 1914 zum Rittmeister befördert.
Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs war Weichs als Kommandant des Stabsquartiers der Kavallerie-Division eingesetzt und bereits im Oktober 1914 wurde er zum Adjutanten der 4. Kavallerie-Brigade ernannt. 1915 wurde Weichs Ib der 5. Infanterie-Division, bei Kriegsende 1918 war er im Stab des stellvertretenden Generalkommandos des II. Armee-Korps eingesetzt.
Weimarer Republik
Nach Abschluss des Versailler Vertrags war Weichs im Stab der Reichswehr-Brigade 23 eingesetzt und seit 1920 für drei Jahre Generalstabsoffizier bei der 3. Kavallerie-Division in Kassel. 1923 wurde Weichs, zwischenzeitlich zum Major befördert, Eskadronchef beim 18. Reiter-Regiment in Stuttgart-Cannstatt. Anschliessend war er bis Ende Januar 1928 als Taktiklehrer an der Infanterieschule in Ohrdruf eingesetzt. Ab 1. Februar 1928 war Weichs als Oberstleutnant Kommandeur des 18. Reiter-Regiments. Mit dem 1. März 1930 wurde er Chef des Stabes der 1. Kavallerie-Division in Frankfurt (Oder). Am 1. November desselben Jahres wurde er zum Oberst ernannt.
Zeit des Nationalsozialismus
Vorkriegszeit
Nachdem Weichs am 1. April 1933 zum Generalmajor befördert und gleichzeitig zum Infanterieführer III in Potsdam ernannt worden war, erfolgte bereits im Oktober 1933 die Ernennung zum Kommandeur der 3. Kavallerie-Division in Weimar.
1935 wurde unter Weichs’ Leitung begonnen, die 3. Kavallerie-Division zur 1. Panzer-Division umzubilden. Weichs wurde im April 1935 zum Generalleutnant befördert, eineinhalb Jahre später zum General der Kavallerie und nach einem weiteren Jahr am 12. Oktober 1937 zum Kommandierenden General des XIII. Armeekorps und des Wehrkreises XIII in Nürnberg.
Im Frühjahr 1939 war Weichs mit seinem Korps an der Besetzung der Rest-Tschechei beteiligt.
Zweiter Weltkrieg
Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges während des Polenfeldzuges war Weichs weiterhin Kommandierender General des XIII. Armeekorps und nahm in dieser Stellung an der Eroberung Warschaus teil. Im Oktober 1939 wurde er zum Oberbefehlshaber der 2. Armee ernannt und nahm am Frankreichfeldzug teil. Nach Abschluss der Kampfhandlungen wurde Weichs am 19. Juli 1940 zum Generaloberst befördert.
Mit der 2. Armee nahm Weichs dann ab dem 10. April 1941 am Balkanfeldzug teil und nahm am 16. April die Kapitulation der jugoslawischen Armee entgegen.
Bei Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion am 22. Juni 1941 waren Weichs und seine 2. Armee im Verband der Heeresgruppe Mitte eingesetzt. Für die Schlacht um Kiew wurden die 2. Armee und die Panzergruppe 2 zeitweilig nach Süden abgedreht. Im Juni 1942 wurde Weichs zum Oberbefehlshaber einer nach ihm benannten Armeegruppe ernannt, die den Auftrag erhielt, Woronesch einzunehmen. Mitte Juli 1942 übernahm er anstelle des abgesetzten Fedor von Bock die Führung der neu gebildeten Heeresgruppe B, mit der er das Unternehmen Braunschweig, den Vorstoss nach Stalingrad, durchführen sollte. Nach den Erfolgen der sowjetischen Operation Uranus in der Schlacht von Stalingrad bildete der südliche Teil seiner Heeresgruppe die neue Heeresgruppe Don, die jedoch bereits im Winter 1942/43 durch Gegenoffensiven der Roten Armee praktisch zerschlagen und aufgelöst wurde. Am 1. Februar 1943 wurde Weichs dennoch zum Generalfeldmarschall ernannt und im Juli 1943 in die Führerreserve versetzt.
Bereits im August 1943 wurde Weichs jedoch reaktiviert und zum Oberbefehlshaber Südost und gleichzeitig zum OB der Heeresgruppe F ernannt. In dieser Zeit war er Empfänger, Leser und vermutlich Verteiler der Sonette von Reinhold Schneider, welche seine mit Schneiders Verleger Karl Borromäus Glock befreundete Frau ihm zusandte.
Im Herbst 1944 organisierte er die Räumung Griechenlands und Jugoslawiens von deutschen Truppen während der sowjetischen Belgrader Operation entgegen den Befehlen Hitlers, indem er planmässige Rückzugsbewegungen in den Lagemeldungen an das OKW als durch feindliche Angriffe bedingt darstellte.
Am 25. März 1945 wurde Weichs endgültig in die Führerreserve versetzt und am 2. Mai 1945 von US-amerikanischen Einheiten in Ettal in Bayern gefangen genommen.
Im Geiselmord-Prozess wurde Weichs mit anderen Offizieren der Wehrmacht wegen der Ermordung Hunderttausender von Personen der Zivilbevölkerung angeklagt. Das Verfahren gegen Weichs wurde aber wegen seines schlechten Gesundheitszustands eingestellt und Weichs aus der Haft entlassen.
Generalfeldmarschall Ernst Busch
Ernst Wilhelm Bernhard Busch (* 6. Juli 1885 in Essen-Steele, Rheinprovinz; † 17. Juli 1945 in Aldershot, Hampshire, Vereinigtes Königreich) war ein deutscher Offizier, zuletzt Generalfeldmarschall im Zweiten Weltkrieg. Er war einer der treuesten Anhänger Hitlers in der deutschen Generalität und mitverantwortlich für den Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte während der sowjetischen Sommeroffensive Operation Bagration.
Ernst Busch war der Sohn des Direktors des königlichen Waisenhauses der Fürstin-Franziska-Christine-Stiftung Essen-Steele, Wilhelm Ernst Busch. Im Alter von zwölf Jahren begann er seine militärische Laufbahn, als er 1897 in die Kadettenanstalt Bensberg eintrat. 1901 wechselte er in die Preussische Hauptkadettenanstalt Gross-Lichterfelde und legte dort 1904 sein Abitur ab
und wurde daraufhin in die Preussische Armee als Fähnrich übernommen. Nach seiner Beförderung wurde er in das Infanterie-Regiment „Herwarth von Bittenfeld“ (1. Westfälisches) Nr. 13 nach Münster in Westfalen versetzt. Im folgenden Jahr wurde er zum Leutnant befördert. 1908 wurde Busch zum Infanterie-Regiment „Herzog Ferdinand von Braunschweig“ (8. Westfälisches) Nr. 57 nach Wesel versetzt, in dem er bis zum Jahr 1913 Dienst tat. Es folgte am 16. Juni 1913 die Beförderung zum Oberleutnant und eine Versetzung an die Kriegsschule Kassel, wo er als Inspektionsoffizier tätig war.
Erster Weltkrieg
Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde Busch als Kompaniechef in das Infanterie-Regiment „Vogel von Falckenstein“ (7. Westfälisches) Nr. 56 versetzt, mit dem er fast während des ganzen Ersten Weltkrieges an der deutschen Westfront eingesetzt wurde. Er nahm an den folgenden Schlachten teil:
- Angriff auf Lüttich (4.–16. August 1914)
- Schlacht bei St. Quentin (29. August 1914)
- Wettlauf zum Meer (13. September bis 19. Oktober 1914)
- Erste Flandernschlacht (20. Oktober bis 18. November 1914)
- Winterschlacht in der Champagne (16. Februar bis 20. März 1915)
- Zweite Flandernschlacht (22. April bis 25. Mai 1915)
- Schlacht um Verdun (21. Februar bis 20. Dezember 1916)
- Schlacht an der Aisne (16. April bis Ende Mai 1917)
- Deutsche Frühjahrsoffensive 1918 (21. März bis 17. Juli 1918)
1915 wurde er zum Hauptmann befördert und im Lauf des Jahres 1916 als Bataillonskommandeur eingesetzt. Aufgrund seiner militärischen Erfolge wurde Busch 1918 mit dem Orden Pour le Mérite ausgezeichnet. Während des Kriegs wurde er dreimal verwundet. (21. Mai 1915, 10. März 1917, 23. Oktober 1917). Am 7. September 1918 übernahm er eine Kompanie des Regiments z. b. V. „von Möller“, mit dem er in das Deutsche Reich zurückkehrte.
Sein Status als hochdekorierter Veteran des Ersten Weltkriegs brachte Busch später bei Adolf Hitler grosse Anerkennung ein.
Weimarer Republik
In der chaotischen Zeit nach dem Waffenstillstand von Compiègne verblieb Busch, der im Dezember 1918 zum Infanterie-Regiment 56 zurückgekehrt war, bis zum August des folgenden Jahres in dieser Einheit. Danach hatte er verschiedene, nur kurz andauernde Verwendungen, bevor er mit der Bildung des 100’000-Mann-Heeres am 1. Oktober 1920 Kompaniechef im 18. Infanterie-Regiment wurde. Anschliessend kam er zum Stab der 6. Division in Münster. 1924 wurde er zum Stab des Reichswehrgruppenkommandos I versetzt und am 1. April 1925 zum Major befördert. Im Oktober 1925 wurde er Inspekteur der Verkehrstruppen im Reichswehrministerium. 1928 wurde Busch dann zur 2. Division nach Stettin versetzt, wo er im Divisionsstab als Erster Generalstabsoffizier (Ia) eingesetzt war.
Am 1. Februar 1930 erfolgte Buschs Beförderung zum Oberstleutnant und die Ernennung zum Bataillonskommandeur im 9. Preussischen Infanterie-Regiment. Im Jahr 1932 wurde Busch schliesslich Kommandeur des Regiments und am 1. Oktober 1932 folgte die Ernennung zum Oberst.
Busch war bereits vor der Machtergreifung Adolf Hitlers ein Anhänger des Nationalsozialismus.
Zeit des Nationalsozialismus
Am 1. September 1935 wurde Busch zum Generalmajor und gleichzeitig zum Kommandeur der 23. Infanterie-Division ernannt. Am 1. Oktober 1937 erfolgte die Beförderung zum Generalleutnant. Während der Blomberg-Fritsch-Krise Ende Januar und Anfang Februar 1938 stand er klar auf der Seite Hitlers und wurde deshalb noch im gleichen Monat zum General der Infanterie befördert und als Kommandierender General des VIII. Armeekorps und Befehlshaber im Wehrkreis VIII in Breslau eingesetzt. Im Sommer 1938 wandte er sich auf dem Generalstreffen am 4. August 1938 zusammen mit Walter von Reichenau gegen den Generalstabschef Ludwig Beck, als dieser die aggressive Politik Hitlers gegenüber der Tschechoslowakei als falsch darstellte (Sudetenkrise). Generell gehörte Busch zusammen mit Walter von Reichenau, Wilhelm Keitel und Alfred Jodl zu den treuesten Anhängern Hitlers in der deutschen Generalität und war mit den Angriffsplänen auf Polen voll einverstanden.
Busch war ein Kritiker der von Heinz Guderian entwickelten Panzertruppe als selbstständiger Waffengattung, da er zwar die Möglichkeiten der Motorisierung erkannte, jedoch auf der schlachtentscheidenden Rolle der Infanterie beharrte und Panzern nur eine unterstützende Funktion im Schlachtgeschehen zugestand. Er verband diese Ansicht mit sozialdarwinistischem Gedankengut. Das Schlachtfeld sollte in einer von Busch 1937 veröffentlichten Schrift der Ort sein, an dem die Auslese erfolgen sollte:

„Der Krieg der Zukunft wird ein totaler Krieg sein, ein Krieg, der die drei Dimensionen – Land, Wasser, Luft – ausnutzen wird, ein Volkskrieg, mit allen politischen, wissenschaftlichen und psychologischen Kräften [… Es ist selbstverständlich], dass in Zukunft Kriege ohne die Mitwirkung von mechanisierten und motorisierten Einheiten und auch ohne allgemeine Ausnutzung des Motors nicht denkbar sind. […] Die Zone des Angriffs, in der der Infanterist auch im Kriege der Zukunft die Hauptlast des Kampfes tragen wird, ist zugleich die Zone des Siegens oder Sterbens. […] Nur Kampfnaturen, selbstständig, entschlussfreudig, hart und zäh, können die an den Infanteristen zu stellenden Forderungen erfüllen“.
Zweiter Weltkrieg
Während des Polenfeldzugs eroberte Busch mit dem VIII. Armeekorps Krakau und stiess bis nach Lemberg (heute Ukraine, 1918–1939 polnisch) vor. Er erhielt anschliessend den Oberbefehl über die neuaufgestellte 16. Armee. Mit dieser war er im Westfeldzug am linken Flügel der Heeresgruppe A eingesetzt. Für seine Führungsleistung wurde ihm am 26. Mai 1940 das Ritterkreuz verliehen. Am 19. Juli 1940 erfolgte seine Beförderung zum Generaloberst. Bis zum Mai 1941 verblieb Busch mit der 16. Armee in Frankreich.
Befehlshaber der 16. Armee im Deutsch-Sowjetischen Krieg
Mit Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges war Buschs 16. Armee im Verband der Heeresgruppe Nord der südliche Flügel. In der zweiten Augustwoche 1941 eroberte die 16. Armee Staraja Russa südlich des Ilmensees, wobei sie Gefahr lief, von der sowjetischen 38. Armee eingeschlossen zu werden. Deswegen musste das LVI. motorisierte Armee-Korps unter dem Kommando von Erich von Manstein seinen Vorstoss auf Leningrad abbrechen, um die 38. sowjetische Armee zu zerschlagen.
Während der am 8. Januar 1942 beginnenden sowjetischen Winteroffensive durchbrachen fünf Armeen der sowjetischen Nordwestfront die Verteidigungsstellungen der 16. Armee zwischen Seligersee und Ilmensee. Busch befahl gemäss den Weisungen Adolf Hitlers seinen Korps-Kommandeuren, ihre Stellung unbedingt zu halten, obwohl dies aufgrund des ungünstigen Kräfteverhältnisses in Kombination mit den Witterungsbedingungen bei Temperaturen um −40 Grad praktisch unmöglich war. Im Ergebnis von Buschs Haltebefehl wurden 5’500 deutsche Soldaten am 28. Januar 1942 in der Stadt Cholm eingeschlossen (Schlacht um Cholm) und das II. Armee-Korps am 8. Februar 1942 im Raum Demjansk (Kesselschlacht von Demjansk). Die Verbindung zur Heeresgruppe Mitte ging vollständig verloren und die 290. Infanterie-Division wurde bei Demjansk fast vollständig aufgerieben. Busch hatte das Glück, dass die sowjetischen Verbände nach ihrem Durchbruch in südlicher Richtung in den Rücken der Heeresgruppe Mitte vorstiessen, wo sie vom XXXXI. deutschen Armee-Korps unter dem Kommando von Generalleutnant Walter Model aufgehalten wurden.
Generaloberst Georg von Küchler war mit Buschs Führungsleistung so unzufrieden, dass er sich zusammen mit dem Generalstabschef Franz Halder bei Hitler darum bemühte, ihn von seinem Kommando zu entheben. Hier kam Busch wieder seine unbedingte Treue zu Hitler zugute. Hitler schlichtete den Streit und Busch konnte, seiner selbstständigen Kommandoführung beraubt, weiterhin Befehlshaber der 16. Armee bleiben.
Die 16. Armee wurde im Frühjahr verstärkt, sodass im April 1942 die Entsetzung des Kessels von Demjansk durchgeführt werden konnte und im Mai 1942 auch die Besatzung von Cholm aus der sowjetischen Umklammerung befreit wurde. Ab Sommer 1942 konzentrierten sich die sowjetischen Angriffe bis zum Januar 1944 auf die weiter nördlich gelegene 18. Armee, die die Leningrader Blockade aufrechterhielt (Erste Ladoga-Schlacht, Zweite Ladoga-Schlacht, Dritte Ladoga-Schlacht). Buschs Armee konzentrierte sich auf Abwehrkämpfe bei Demjansk und Staraja Russa, sodass der Generaloberst vorerst keine kritische Situation zu meistern hatte. Trotz seiner mittelmässigen Leistung als Befehlshaber der 16. Armee wurde er als Günstling Adolf Hitlers am 1. Februar 1943 zusammen mit Ewald von Kleist und Maximilian von Weichs zum Generalfeldmarschall befördert. Im August 1943 erhielt Busch das Eichenlaub zum Ritterkreuz.
Nachdem der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte Günther von Kluge am 12. Oktober 1943 bei einem Autounfall schwer verletzt worden war, übertrug Hitler Busch das Kommando über die Heeresgruppe.
Befehlshaber der Heeresgruppe Mitte
Die Aufgaben eines Heeresgruppenbefehlshabers überforderten Busch. Er hatte sich nicht wirklich bewährt und war sich dessen bewusst. Er neigte dazu, sich auf Hitlers Lagebeurteilungen zu verlassen. Eine Weisung Hitlers musste nach der Auffassung Buschs unbedingt befolgt werden. Laut dem US-amerikanischen Historiker Earl Ziemke wurde das Hauptquartier der Heeresgruppe Mitte unter Busch zu einem „ideenlosen Werkzeug, das lediglich Führerbefehle weiterleitete“.
Busch unterstanden mit Generaloberst Georg-Hans Reinhardt (3. Panzer-Armee), Generaloberst Gotthard Heinrici (4. Armee) und Generaloberst Walter Weiss (2. Armee) erfahrene Befehlshaber. Deshalb gelang es im Winter 1943/44, die Stellungen der Heeresgruppe Mitte im Wesentlichen zu halten. Einzig der Verlust des Eisenbahnknotenpunkts Newel war ein schwerwiegenderer Rückschlag. Doch im Vergleich zu den Gebietsverlusten der anderen beiden deutschen Heeresgruppen war der Rückzug der Heeresgruppe Mitte minimal. Während der sogenannten Rollbahnschlachten bei Witebsk und Orscha, die von Januar 1944 bis zum März 1944 andauerten, konnte die Front der Heeresgruppe Mitte gehalten werden. Busch trug wenig zu diesem Erfolg bei, der von der NS-Propaganda im Frühjahr 1944 intensiv ausgeschlachtet wurde.
Aufgrund von Fehlinformationen der Abteilung Fremde Heere Ost liess Busch es zu, dass seine Heeresgruppe im Frühjahr 1944 von nahezu allen beweglichen und gepanzerten Einheiten mit Ausnahme der 20. Panzer-Division entblösst wurde. Seinen Untergebenen Armeebefehlshabern war die Unhaltbarkeit des von der Heeresgruppe besetzten Frontvorsprungs bewusst; daher versuchten sie mehrfach, Busch dazu zu bewegen, von Hitler eine Rückzugsgenehmigung zu erhalten. Zunächst lenkte Busch ein und liess eigenmächtig eine Sehnenstellung errichten, die die Frontlinie der Heeresgruppe erheblich verkürzte. Als er auf einer Besprechung am 20. Mai 1944 versuchte, eine Rückzugsgenehmigung von Hitler zu erhalten, fragte dieser, ob Busch jetzt auch zu den Generälen gehöre, „die nach hinten blicken“. Tief getroffen nahm Busch von den Rückzugsplänen Abstand und setzte sie trotz energischen Protests seiner Armeebefehlshaber nicht um. Stattdessen wurden die von Hitler definierten „festen Plätze“ Witebsk, Orscha, Mogilew und Bobruisk weiter befestigt.
Der mit weit überlegenen Kräften geführten sowjetischen Sommeroffensive, die am dritten Jahrestag des deutschen Angriffes am 22. Juni 1944 begann, war die Heeresgruppe Mitte nicht gewachsen und bereits am zweiten Tag der Offensive zerriss die Frontlinie. Die durch Hitler vorgegebene, starre Verteidigungstaktik der „festen Plätze“ entsprach nicht dem asymmetrischen Kräfteverhältnis zwischen den deutschen und sowjetischen Streitkräften. Busch informierte das OKH nur unvollständig über die tatsächliche Lage der Heeresgruppe und untersagte zunächst jegliche Rückzugsbewegungen. Erst am 26. Juni flog er zu Hitler auf den Obersalzberg, um die Genehmigung für eine beweglichere Kriegführung zu erreichen. Hitler lehnte die Bitten Buschs erneut ab, begriff aber erstmals, dass die Heeresgruppe einer Katastrophe entgegenging.
Busch hatte ab dem 27. Juni keinerlei Überblick mehr über die tatsächliche Lage, am Morgen des 28. Juni 1944 bat er erneut telefonisch im OKH um die Freigabe der „festen Plätze“ Bobruisk und Mogilew. An beiden Orten war die Vernichtung grosser Korpsverbände jedoch bereits unabwendbar. Busch wurde als Oberbefehlshaber entlassen und am Abend des 28. Juni durch Generalfeldmarschall Walter Model ersetzt. Er empfand diese Entlassung als persönliche Kränkung, da er immer treu die Befehle Adolf Hitlers befolgt hatte. Busch verliess daher am 29. Juni seinen Posten, ohne Model in die gegenwärtige Lage einzuweisen, die ihm ohnehin nur noch lückenhaft bekannt war. Durch sein unselbstständiges Handeln trug er eine grosse Teilschuld am Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte.
Endphase des Dritten Reiches
Nach dieser Niederlage schien die Militärkarriere von Busch beendet zu sein. Er zog sich nach Schlesien und später nach Ostbevern zurück. Jetzt bewahrte ihn seine Loyalität gegenüber Hitler vor einem möglichen Kriegsgerichtsverfahren. Unabhängig davon nagte der von ihm mitverursachte katastrophale Untergang der Heeresgruppe Mitte an seiner Psyche. Im Juli 1944 wurde er als gebrochen und deprimiert beschrieben. Es kursierten bald Gerüchte, dass er Suizid begangen habe. Auf Anraten von Generaloberst Guderian, der nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 zum Chef des Generalstabes des Heeres ernannt worden war, liess Hitler Busch die Beerdigungsrede für den an den Folgen des Attentats am 1. Oktober 1944 verstorbenen General der Infanterie Rudolf Schmundt halten.
Im April 1945 übernahm Busch offenbar die Heeresgruppe H, die offenbar kurz darauf in Heeresgruppe Nordwest umbenannt wurde. Als Nachfolger von Grossadmiral Karl Dönitz, der nach Hitlers Tod zum „Staatsoberhaupt“ und Oberbefehlshaber der Wehrmacht aufgerückt war, wurde Busch in den letzten Kriegstagen noch „Oberbefehlshaber Nord“ (d. h. Befehlshaber aller Resttruppen im norddeutschen Raum). Buschs Hauptquartier befand sich Anfang Mai 1945 bei Flensburg in Kollerup, ungefähr zehn Kilometer von Flensburg-Mürwik entfernt, wo sich die letzte Reichsregierung unter Karl Dönitz angesiedelt hatte. Nach der Teilkapitulation im Nordwesten, die am 4. Mai durch Generaladmiral Hans-Georg von Friedeburg, nach Autorisation durch Dönitz, gegenüber dem britischen Feldmarschall Bernard Montgomery in der Lüneburger Heide unterzeichnet worden war, ergab sich auch Busch den Alliierten.
Gefangenschaft und Tod
Nach seiner Gefangennahme am 23. Mai 1945 wurde Busch nach England gebracht und dort im Lager Aldershot in der Grafschaft Hampshire interniert. Dort verstarb er als gebrochener Mann am 17. Juli des gleichen Jahres an Angina pectoris. Er wurde ohne Zeremonie auf der Deutschen Kriegsgräberstätte Cannock Chase bestattet.
Generalfeldmarschall Walter Model
Otto Moritz Walter Model (* 24. Januar 1891 in Genthin, Provinz Sachsen; † 21. April 1945 bei Duisburg) war ein deutscher Heeresoffizier (ab 1944 Generalfeldmarschall) und während des Zweiten Weltkrieges Oberbefehlshaber verschiedener Armeen und Heeresgruppen sowie 1944 kurzzeitig Oberbefehlshaber West. Aufgrund der von ihm befohlenen Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung wurde er von der Sowjetunion in die Liste der Kriegsverbrecher aufgenommen. Er galt unter Offizieren der Wehrmacht als Anhänger Hitlers und wurde in den deutschen Stäben auch „Hitlers Feuerwehrmann“ genannt, da er ab 1943 immer wieder an verschiedene, kritisch gewordene Punkte der (Ost-)Front geschickt wurde, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.
Kaiserreich und Erster Weltkrieg
Walter Model war der ältere Sohn des städtischen Musiklehrers Otto Model und seiner Frau Maria, geborene Demmer. In seiner Kindheit und Jugend besuchte er Schulen in Genthin, Erfurt und Naumburg. Seine Schullaufbahn endete mit dem Bestehen der Abiturprüfung. Im Jahr 1909 trat Walter Model als Fahnenjunker in das Infanterie-Regiment „von Alvensleben“ (6. Brandenburgisches) Nr. 52 in Cottbus ein. Im selben Jahr besuchte er, nun als Fähnrich, die Kriegsschule Neisse. Am 22. August 1910 wurde er zum Leutnant im I. Bataillon in Crossen ernannt.
Ernennungen/Beförderungen:
- Februar 1909 Fahnenjunker
- November 1909 Fähnrich
- August 1910 Leutnant
- Februar 1915 Oberleutnant
- Dezember 1917 Hauptmann
- Oktober 1929 Major
- November 1932 Oberstleutnant
- Oktober 1934 Oberst
- März 1938 Generalmajor
- März 1940 Generalleutnant
- Oktober 1941 General der Panzertruppe
- Februar 1942 Generaloberst
- März 1944 Generalfeldmarschall
Bei Beginn des Ersten Weltkriegs war Model Bataillonsadjutant; noch vor dem Jahresende wurde er Regimentsadjutant.
Am 25. Februar 1915 erhielt er die Beförderung zum Oberleutnant und wurde im Mai 1915 schwer verwundet. Ab April 1916 belegte Model einen Kurzlehrgang für angehende Generalstabsoffiziere in Sedan und wurde – zurück an der Westfront – Adjutant bei der 10. Infanterie-Brigade und später Kompaniechef im Leib-Grenadier-Regiment „König Friedrich Wilhelm III“. (1. Brandenburgisches) Nr. 8. Hier wurde er abermals schwer verwundet. Nach seiner Genesung wurde Model am 7. Juni 1917 als Ordonnanzoffizier zur Obersten Heeresleitung (OHL) kommandiert. Dort wurde er dem Chef der Operationsabteilung zugeteilt und begab sich unter anderem auf eine Dienstreise in die Türkei. Am 18. November 1917 wurde er zum Hauptmann ernannt. Am 10. März 1918 wurde Model als Zweiter Generalstabsoffizier (Ib) zur Garde-Ersatz-Division und am 30. August 1918 als Ib zur 36. Reserve-Division versetzt.
Weimarer Republik
Nach dem Waffenstillstand vom 11. November 1918 marschierte die 36. Reservedivision über Aachen nach Danzig zurück und wurde dort demobilisiert. Model meldete sich zu neuer Verwendung und wurde vom 19. Januar bis zum 19. Juli 1919 als Generalstabsoffizier beim XVII. Armee-Korps dem Grenzschutz Ost zugeteilt. Nach dem am 28. Juni 1919 unterzeichneten Frieden von Versailles wurde Danzig Freistaat und Model zur Reichswehrbrigade 7 in Westfalen versetzt. Im Auftrag löste Model ab September/Oktober 1919 im Baltikum widerstrebende Truppeneinheiten auf, vor allem die sogenannte Eiserne Division. Kurzzeitig tat er Dienst in Münster als Kompaniechef im II. Bataillon des Infanterieregiments 14. Im März 1920 wurde Model dem Kommandeur der Sicherungstruppen im Abschnitt II der ‚militärisch verdünnten Zone‘ östlich des Rheins, im Bergischen Land, zugeteilt. Er übernahm die MG-Kompanie im I. Bataillon des I.R. 14, die am 15. März 1920 nach Elberfeld-Barmen wegen schwerer Unruhen während des Generalstreiks gegen den Kapp-Putsch verlegt wurde. Gegen die Übermacht der Aufständischen musste Models Bataillon den Rückzug der Reichswehrtruppen decken. Nach der Konsolidierung der Reichswehr im Oktober 1920 wurde Model 1921 Generalstabsoffizier im ‚getarnten Generalstab‘ in Münster. Im Oktober 1925 erfolgte die Versetzung zum 8. (Preussisches) Infanterie-Regiment und die Umsiedlung mit seiner Frau Herta nach Görlitz. Dort schrieb Model die biografisch-kriegsgeschichtliche Studie über Gneisenau, die 1929 im Sammelband „Führertum“ publiziert wurde. Am 30. September 1928 wurde er als Generalstabsoffizier zur 3. Division nach Berlin versetzt und unterrichtete unter anderen auch die späteren Bundeswehr-Generale Hans Speidel und Adolf Heusinger. 1929 wurde Model zum Major ernannt und im Jahr darauf zum Truppenamt in die Ausbildungsabteilung versetzt. Vom 20. August bis zum 1. Oktober 1931 befand sich Model auf einer ‚Russlandreise‘ im Rahmen der geheimen Beziehungen zwischen Reichswehr und Roter Armee. 1932 engagierte sich Model für Aktivitäten, um die „ob der Arbeitslosigkeit verzweifelnde Jugend […]“ weg von den in „grossen paramilitärischen Verbänden organisierten Gruppen […]“ an die Reichswehr heranzuführen (Reichskuratorium für Jugendertüchtigung). „Einer der Mitarbeiter des Reichskuratoriums, Oblt. a. D. Dr. Boysen, gewann die Überzeugung, Model sei aufgrund der ewigen Schwierigkeiten mit der SA-Führung damals zum Gegner der NSDAP geworden“. Am 1. November 1932 wurde Model zum Oberstleutnant befördert.
Nationalsozialismus
Vorkriegszeit
Bald nach der Machtübernahme durch Hitler am 30. Januar 1933 löste die SA das „Reichskuratorium“ auf. Anfang November wurde Model als Bataillonskommandeur zum Infanterieregiment Nr. 2 nach Allenstein in Ostpreussen versetzt. Am 1. Oktober 1934 wurde Model zum Oberst befördert und am 1. November 1934 Kommandeur des 2. (Preussisches) Infanterie-Regiments, ebenfalls in Allenstein. Model wurde am 15. Oktober 1935 zum Chef der neu eingerichteten technischen Abteilung im Generalstab des Heeres ernannt. Auf Models Anregung ging „die Konstruktion eines motorisierten, gepanzerten Infanteriebegleitgeschützes“, das Sturmgeschütz, zurück.
Am 1. März 1938 wurde er zum Generalmajor und am 10. November 1938 zum Chef des Generalstabes des IV. Armeekorps in Dresden ernannt.
Zweiter Weltkrieg
Krieg gegen Polen und Frankreich
Den Zweiten Weltkrieg begann Model als Chef des Generalstabes des IV. Korps der 10. Armee des Generals Walter von Reichenau. Schon kurz nach dem Ende des Polenfeldzugs, am 13. Oktober 1939, wurde Model vom Chef des Generalstabs des Heeres, General Franz Halder, als Chef des Generalstabes der neuen 16. Armee unter General Ernst Busch vorgesehen. In dieser Funktion nahm Model ab dem 10. Mai 1940 am Westfeldzug teil. Am 1. April 1940 war Model zum Generalleutnant befördert worden. Am 13. November 1940 wurde er Kommandeur der 3. Panzer-Division, einem wegen zahlreicher Abgaben nach Nordafrika in Auflösung befindlichen Verband, den er erst wieder einsatzfähig machen musste und ein halbes Jahr lang nach seinen Vorstellungen völlig umformte.
Krieg gegen die Sowjetunion
Am 31. Mai 1941 erhielt die 3. Panzer-Division Befehl zur Verlegung nach Ostdeutschland. In der Truppe dachte man an eine Verwendung als Grenzschutz. Mitte Juni 1941 bezog die Division Bereitstellungsräume in Polen, westlich des Bugs. „Seit April 1941 muss Model klar gewesen sein, was die Stunde geschlagen hatte“.
Marsch bis vor Moskau
Nach dem Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 erzielten Models Panzer Anfang Juli 1941 den Durchbruch über den Bug, nahmen an weiteren Gefechten teil und schlossen im September 1941 den Kessel von Kiew. Mit Wirkung vom 1. Oktober 1941 zum General der Panzertruppe befördert, erreichte ihn am 26. Oktober 1941 auf dem Weg nach Moskau die Nachricht von seiner Versetzung als Kommandierender General des XXXXI. Panzerkorps an den Mittelabschnitt der Ostfront. Beim Angriff auf Moskau gelangte Models Korps Anfang Dezember 1941 in eine Position nördlich der Hauptstadt. „Am 5. und 6. Dezember 1941 schlug jedoch der Gegner zurück“.
Frontbogen von Rschew
Die 9. Armee, der Models XXXXI. Korps unterstellt war, wurde nach Südwesten auf Rschew abgedrängt. Über ihren Oberbefehlshaber notierte Generalstabschef Halder: „Strauss kann nicht mehr“. Model wurde am 16. Januar 1942 für das Kommando über die 9. Armee vorgesehen. Die Armee war im ‚Bogen von Rschew‘ durch einen Zangenangriff von Konews Kalinin-Front und Schukows Westfront schon fast eingekesselt, als Model sich die Lage erläutern liess. Am nächsten Tag stand Model in der Wolfsschanze erstmals Hitler gegenüber: Er schlug eine Klärung der Lage durch eine Angriffsoperation vor. „Hitler war perplex und sagte: ‚Dann machen Sie es!‘“ Am 5. Februar 1942 war die Lage bereinigt – die abgeschnittenen Reste von drei sowjetischen Angriffsarmeen bedrohten jedoch in den grossen Waldgebieten weiterhin den Rücken der 9. Armee. Am 28. Februar 1942 wurde Model zum Generaloberst befördert und erhielt das Eichenlaub zum Ritterkreuz. Am 25. Mai 1942 wurde Model schwer verwundet. Am 7. August 1942 brach er seinen Genesungsurlaub in Dresden ab und flog wieder zur Front, „wo die Hölle los war“. Die Schlacht endete am 26. September 1942 mit hohen Verlusten der sowjetischen Westfront. Gleichzeitig mit der Operation Uranus setzten die Sowjets unter Marschall Schukow am 24. November 1942 in der Operation Mars auch zum Grossangriff am Rschew-Bogen an, der am 10. Januar 1943 mit dem nächsten Abwehrerfolg Models endete. Obwohl Model offensiv weiterdachte, hatte sich doch die Gesamtlage so entwickelt, dass selbst Hitler die Räumung des „kräftezehrenden Bogen von Rschew“ unumgänglich schien. Das „Unternehmen Büffel“ organisierte Model als geordneten Rückzug bis Ende März 1943. Am 3. April 1943 erhielt er das Eichenlaub mit Schwertern zum Ritterkreuz. Die schweren Schlachten um Rschew, die Model gegen einen weit überlegenen Gegner über zwei Jahre lang führte und mit einem geglückten Rückzug abschloss, begründeten seinen Ruhm als „Meister der Defensive“. Die durch den Rückzug eingesparten Kräfte bestärkten Hitler in seinen Plänen zu einer Sommeroffensive 1943.
Im Krieg gegen die Sowjetunion war Model in seinem Befehlsbereich verantwortlich für die Umsetzung der Taktik der verbrannten Erde; dies beinhaltete unter anderem die Vernichtung der russischen Ernte und die Deportation der Zivilbevölkerung nach Westen. Er kooperierte auch mit den Einsatzgruppen von SS und SD. Vor allem für seine Zeit als Kommandeur der 9. Armee ist eine „laufende Zusammenarbeit“ mit der Einsatzgruppe B nachzuweisen. Entsprechend seiner Gräueltaten gegenüber russischen Zivilisten wurde Model von der Sowjetunion auf die Liste der Kriegsverbrecher gesetzt.
Kursk
Als Oberbefehlshaber der 9. Armee hatte Model eine Schlüsselposition für das Unternehmen Zitadelle, der dritten und letzten Sommeroffensive der Wehrmacht in Russland, die am 5. Juli 1943 begann. Die deutschen Soldaten kamen aufgrund schwerer Kämpfe nur langsam voran. In den Tagen zwischen dem 5. und dem 13. Juli 1943 fand im Rahmen des Unternehmens Zitadelle im Kursker Frontbogen die bis heute grösste Panzerschlacht der Geschichte statt, in der auf deutscher knapp über 1’000 und auf sowjetischer Seite mehrere tausend Panzer eingesetzt waren. Am 12. Juli 1943 ordnete Hitler an, die Offensive abzubrechen. Am 5. November 1943 wurde Model für zwei Monate in die Führerreserve versetzt. Das Kommando über die 9. Armee übernahm Josef Harpe.
Ernennung zum Generalfeldmarschall
Im Januar 1944 wurde Model von Adolf Hitler zum Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Nord ernannt (Leningrad-Nowgoroder Operation) und am 30. März 1944 zum Generalfeldmarschall ernannt, bei gleichzeitiger Ernennung zum Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Nordukraine. Als im Zuge der am 22. Juni 1944, dem 3. Jahrestag des deutschen Angriffs, beginnenden sowjetischen Sommeroffensive die Heeresgruppe Mitte zusammenbrach, löste Model Generalfeldmarschall Busch als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe am 28. Juni 1944 ab. Den Befehl über die Heeresgruppe Nordukraine gab er erst einen Monat später ab (Lwiw-Sandomierz-Operation). Nach dem gescheiterten Attentat vom 20. Juli 1944 bekundete Model gegenüber Hitler seine Loyalität. Er tat dies so ausdrücklich, dass er hierin alle anderen Ergebenheitsadressen deutscher Generalfeldmarschälle übertraf. Model war einer der wenigen, die es riskierten, Hitler in Fragen der Kriegsführung zu widersprechen. Sein Umgang mit untergebenen Offizieren und auch mit gleichrangigen Befehlshabern war ruppig und harsch, weshalb er gefürchtet und bisweilen gehasst wurde.
Krieg im Westen
Nachdem sich Model bei verschiedenen Verwendungen in Russland den Ruf erworben hatte, in schwierigen Situationen Fronten stabilisieren zu können, wurde er am 16. August 1944 von Hitler von der Ostfront nach Berlin befohlen und zum Oberbefehlshaber West (OB West) ernannt bei gleichzeitiger Übernahme des Oberbefehls über die Heeresgruppe B. Am 17. August 1944 erhielt er die Brillanten zum Ritterkreuz und traf noch am selben Tag an der Westfront ein. Seine Aufgabe dort war, die Lage zu festigen und Paris zu halten, doch handelte es sich zu diesem Zeitpunkt – nach der Schlacht um Falaise – bereits um eine zusammengebrochene Front. Da auch die Seine-Linie nicht mehr zu halten war, organisierte Model sofort den Rückzug der deutschen Truppen aus Frankreich. Mit dem Abwehrerfolg bei Arnheim gelang die Stabilisierung der Front an der deutschen Grenze (Westwall). Zu seiner Entlastung und aus propagandistischen Zwecken wurde auf dem Posten des Oberbefehlshabers West sein Vorgänger, Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt, am 5. September 1944 wieder sein Nachfolger.
Nach dem Scheitern der Ardennenoffensive im Dezember 1944 und dem Durchbruch der alliierten Streitkräfte ab März 1945 in das Reichsgebiet über den Rhein wurde Models Heeresgruppe B im Ruhrkessel eingeschlossen.
Zusammenbruch des Reichs
Das Bild Walter Models in den letzten Kriegstagen ist zwiespältig. Noch Ende März 1945 betonte er vor den ihm unterstellten Generälen und Offizieren: „Der Sieg der nationalsozialistischen Idee steht ausser Zweifel, die Entscheidung liegt in unserer Hand!“. Er unterstützte die Weisungen Heinrich Himmlers, mit unmenschlicher Härte gegen Deserteure vorzugehen. In Essen liess er Fahnenflüchtige standrechtlich erschiessen. In Düsseldorf wurden der Kommandant der Schutzpolizei Franz Jürgens und einige andere Personen, die sich im Rahmen der Aktion Rheinland eigenmächtig um Übergabeverhandlungen mit den bis an den Rhein vorgerückten amerikanischen Streitkräften bemüht hatten, von einem Standgericht, das von Model offenbar geduldet worden war, am 16. April 1945 abgeurteilt und erschossen. Model beschwor somit einerseits den Endsieg, andererseits hatte er jedoch die Aussichtslosigkeit der militärischen Lage erkannt und schliesslich zumindest teilweise zur Handlungsgrundlage genommen.
Model führte den „Nerobefehl“, die von Hitler angeordnete vollständige Zerstörung sämtlicher Industrie-, Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen, im Ruhrgebiet zwar teilweise, aber nicht vollständig aus.
Er entschied sich eigenmächtig, seine Heeresgruppe aufzulösen. Seinen Stabschef Generalmajor Carl Wagener wies er an, die ganz jungen und die alten Soldaten sofort zu entlassen, damit sie als Zivilisten nach Hause zurückkehren konnten. Die übrigen sollten sich innerhalb der nächsten drei Tage entscheiden, entweder ebenfalls heimzukehren, sich einzeln zu ergeben oder aber sich zur nächsten noch kämpfenden Truppe durchzuschlagen. Schon zwei Tage später, am 15. April 1945, spalteten die Alliierten den Kessel. Noch am gleichen Abend war der östliche Teil überrannt. Models Truppe löste sich nun schnell auf. Da ihm der Gedanke an eine Kapitulation unerträglich war, lehnte er noch am 17. April das Angebot des US-Generals Matthew B. Ridgway ab, sich zu ergeben und so die Zivilbevölkerung zu schonen.
Tod
Am 21. April 1945 erschoss sich Walter Model unter einer Gruppe Eichen im Spee’schen Wald, zwischen Wedau und Lintorf unweit der Sechs-Seen-Platte. Denn für ihn war schon der Gedanke einer Kapitulation als verantwortlicher Feldmarschall gegenüber Bernard Montgomery oder den Amerikanern unvorstellbar gewesen. Seine verbliebenen Generalstabsoffiziere, Oberst Theodor Pilling, Oberstleutnant Roger Michael und Major Winrich Behr, begruben ihn, seinem Wunsch entsprechend, an Ort und Stelle. Den unterstellten Kommandeuren im Ruhrkessel hinterliess er die nationalsozialistisch geprägte Botschaft: „Unter dem Druck der Kriegsereignisse zeigt sich, dass noch immer weite Kreise des deutschen Volkes und damit auch der Truppe vom jüdischen und demokratischen Gift der materialistischen Denkweise verseucht sind“. Das Vorbild des Offiziers sei entscheidend, um den Sieg der nationalsozialistischen Idee zu erzwingen. Am 26. Juli 1955 wurde Models Feldgrab mit Hilfe von Winrich Behr und im Beisein seines Sohnes Hansgeorg Model wiedergefunden und die Leiche exhumiert. Auf der Kriegsgräberstätte Vossenack in der Nordeifel fand er seine letzte Ruhe. Sein Grab dort trägt die Nummer 1074. Die Grabplatte von Models Grab musste aufgrund Diebstahls mehrfach erneuert werden.
Privatleben
Am 12. Mai 1921 heiratete Model in Frankfurt am Main Herta Huyssen (* 4. Februar 1892 in Niederbreisig; † 5. Mai 1985 in Bonn). Aus dieser Ehe gingen zwei Töchter und ein Sohn hervor. Der Sohn Hansgeorg war Brigadegeneral bei der Bundeswehr.
Alle drei Kinder Models wurden von Pastor Martin Niemöller getauft. Model und Niemöller waren seit 1923 miteinander bekannt. Sie stimmten in vielem überein. Model war evangelischer Christ und Kirchgänger und hielt sich von den nationalsozialistischen, auch von Niemöller abgelehnten „Deutschen Christen“ fern. Auch ab 1929 in Berlin war Niemöller ein gern gesehener Gast im Hause Model.
Ein Bruder von Walter Model war der Rechtsanwalt und Publizist Otto Model.
Einem breiteren Publikum wurde die Person Models durch den englisch-amerikanischen Spielfilm „Die Brücke von Arnheim“ aus dem Jahr 1977 bekannt, in dem die Ereignisse um die alliierte Operation Market Garden behandelt werden. Darin wird Model von dem österreichischen Schauspieler Walter Kohut dargestellt.
Persönlichkeit
Heinz Guderian beschrieb Model als „kühnen, unermüdlichen Soldaten“. In der Tat war Model ein rastloser, unentwegt hart arbeitender Offizier. Er wurde von vielen als sehr ehrgeizig, dabei doch immer kompetent eingeschätzt. Darüber hinaus galt Model als ein sehr unbequemer Mensch, der sich nicht scheute, seine Meinung – auch Vorgesetzten oder Hitler persönlich – zu sagen. Friedrich Wilhelm von Mellenthin erwähnte sein hitziges und oft unberechenbares Temperament. Bei der Übernahme neuer Kommandos kam es oft zu Beleidigungen, so zum Beispiel 1944, als Model Georg von Küchler als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Nord ablöste.
Model versuchte stets demonstrativ als unpolitischer Soldat aufzutreten. Damit erreichte er jedoch das genaue Gegenteil, so dass er zuletzt sogar unter Offizieren der Wehrmacht als überzeugter Anhänger Hitlers galt. Dementsprechend äusserte er sich – wie viele andere Generäle auch – abfällig über das am 20. Juli 1944 auf Adolf Hitler verübte Attentat. Auch Models Sohn Hansgeorg beschrieb seinen Vater als loyalen Gefolgsmann Hitlers.
Typisch für ihn war ein enormes Selbstbewusstsein, das bisweilen in Selbstüberschätzung ausartete. Beispielhaft hierfür seien folgende Begebenheiten erwähnt: Als er Anfang 1942 das Kommando über die 9. Armee an der linken Flanke der Heeresgruppe Mitte übernahm, wurde er gefragt, wie viele Männer er (für einen bevorstehenden Angriff) an Verstärkung mitgebracht habe. Seine Antwort: „Mich!“. Als er von der alliierten Luftlandeoperation bei Arnheim erfuhr, dachte er, es handele sich um ein Kommandounternehmen, durch das er entführt werden sollte. Eine Marotte Models war, dass er ledige Offiziere nur ungern für Orden oder Beförderungen vorschlug.
Generalfeldmarschall Ferdinand Schörner
Ferdinand Schörner (* 12. Juni 1892 in München; † 2. Juli 1973 ebenda) war ein deutscher Heeresoffizier (seit 1945 Generalfeldmarschall). Im Zweiten Weltkrieg war er Oberbefehlshaber von Armeen und Heeresgruppen sowie 1945 kurzzeitig der letzte Oberbefehlshaber des Heeres. Schörner galt als überzeugter Nationalsozialist. Er wurde in der Sowjetunion 1952 wegen Kriegsverbrechen und in der Bundesrepublik Deutschland 1957 wegen Totschlags an deutschen Soldaten verurteilt.
Bayerische Armee
Schörners militärische Laufbahn begann nach dem Abitur mit einer Dienstzeit als Einjährig-Freiwilliger beim Infanterie-Leib-Regiment der Bayerischen Armee. Anschliessend zur Reserve entlassen, studierte er in München sowie in Lausanne und Grenoble Philosophie und neue Sprachen.
Mit dem Kriegsausbruch 1914 wurde Schörner als Vizefeldwebel und Reserveoffiziersanwärter beim Infanterie-Leib-Regiment reaktiviert und im November 1914 zum Leutnant der Reserve befördert sowie als Kompanieführer verwendet. Schörner war an der Westfront, in Tirol, Serbien, Rumänien und in der Zwölften Isonzoschlacht gegen Italien eingesetzt. Für die Erstürmung des Monte Matajur im Oktober 1917 wurde ihm – als einzigem bayerischen Infanterieleutnant – der Orden Pour le Mérite verliehen. Neben Schörner erhielt auch der damalige Oberleutnant Erwin Rommel diese hohe Auszeichnung. 1918 wechselte Schörner von der Reservelaufbahn in den aktiven Dienst und wurde zum Oberleutnant befördert. Während des Krieges wurde er dreimal schwer verwundet.
Weimarer Republik
Nach dem Waffenstillstand war Schörner zunächst beim Freikorps Epp aktiv, und im Jahr 1920 trat er in die Reichswehr ein. Er wurde als Kompanieführer eingesetzt und absolvierte den Führergehilfenlehrgang. Im Jahr 1923 war Schörner Adjutant des Wehrkreisbefehlshabers von München, General von Lossow, und an der Niederschlagung des Hitlerputsches beteiligt.
Nachdem er seine Generalstabsausbildung beendet hatte, wurde Schörner am 1. Juli 1926 zum Hauptmann befördert, verbunden mit der Übernahme einer Kompanie in Landshut und wenig später in Kempten (Allgäu). Schörner, der gute Italienischkenntnisse besass, wurde anschliessend für einige Zeit als Dolmetscher zu den Alpini, der italienischen Gebirgsjägertruppe, versetzt. Ab dem Jahr 1931 war Schörner als Taktiklehrer an der Infanterieschule Dresden eingesetzt.
Zeit des Nationalsozialismus
Vorkriegszeit
Im Jahr 1934 wurde Schörner zum Major befördert und zum Leiter der 4. Gruppe in der 3. Abteilung (Fremde Heere) des Truppenamtes ernannt. In dieser Stellung war er für den Süden bzw. Südosten Europas zuständig. Am 1. März 1937 wurde Schörner zum Oberstleutnant befördert.
Am 1. Oktober 1937 wurde Schörner Kommandeur des Gebirgsjäger-Regiments 98. In dieser Dienststellung war er auch am Einmarsch in Österreich im März 1938 beteiligt. Am 27. August 1939, wenige Tage vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges, wurde Schörner zum Oberst befördert.
Zweiter Weltkrieg
Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs war Schörner beim Angriff auf Polen Kommandeur des Gebirgsjäger-Regiments 98. Im Mai 1940 wurde Schörner Kommandeur der neu aufgestellten 6. Gebirgs-Division und nahm am Frankreichfeldzug teil. Am 1. August 1940 wurde er zum Generalmajor ernannt.
Im Frühjahr 1941 war Schörner mit der 6. Gebirgs-Division im Balkanfeldzug eingesetzt. Am 20. April 1941 wurde ihm das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes für das Durchstossen der Metaxas-Linie bei Belasica-Planina, einen erfolgreichen Angriff bei Krusa-Planina und einen weiteren Vorstoss in Richtung Thessaloniki verliehen. Am 27. April hisste seine Vorausabteilung auf der Akropolis die Reichskriegsflagge. Nach Abschluss des Feldzuges blieb Schörner mit seiner Division in Griechenland als Besatzungstruppe.
Im Herbst 1941 wurden Schörner und die 6. Gebirgs-Division an die Eismeerfront verlegt (siehe: Verteidigung des Hohen Nordens). Im Januar 1942 übernahm Schörner als Nachfolger von Eduard Dietl die Führung des Gebirgskorps Norwegen (später XIX. Gebirgskorps) und wurde Ende des Monats zum Generalleutnant befördert. Bereits im Juni 1942 erhielt er die Beförderung zum General der Gebirgstruppe, als der er auch Kommandierender General des Korps wurde.
Im Oktober 1943 übernahm Schörner für den verwundeten Sigfrid Henrici als Kommandierender General das XXXX. Panzerkorps der 1. Panzerarmee in der Ukraine. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Rote Armee mit der Überquerung des Dnepr begonnen und bereitete einen Vorstoss auf Kriwoi Rog vor, um die im Dnepr-Bogen stehenden deutschen Truppen abzuschneiden (Nikopol-Kriwoi Roger Operation). Ende des Monats übernahm Schörner die Führung der in diesem Brückenkopf stehenden drei Korps, die als Gruppe Schörner oder Armeeabteilung Nikopol bezeichnet wurden.
Schörner, der stets eine demonstrativ nationalsozialistische Gesinnung zur Schau stellte, wurde trotzdem erst 1943 Mitglied der NSDAP. Er führte die ihm unterstellten Truppen mit grosser Härte („Mehr Angst im Rücken, als von vorne!“) und wurde am 1. Februar 1944 zum Chef des neu geschaffenen Nationalsozialistischen Führungsstabes des Heeres ernannt. In dieser Funktion war er für die Schulung der Truppe im nationalsozialistischen Sinn verantwortlich. Am 17. Februar 1944 erhielt Schörner das Eichenlaub zum Ritterkreuz für die erfolgreiche Räumung des Brückenkopfes bei Nikopol. Bereits zwei Wochen später legte er aufgrund eines schweren Konfliktes mit Hitlers Sekretär Martin Bormann das Amt nieder.
Anfang März übernahm er zeitweilig die Führung der 17. Armee auf der Krim und wurde nach der Entlassung des Oberbefehlshabers der Heeresgruppe A, Generalfeldmarschall Ewald von Kleist, Ende des Monats mit der Führung der nunmehrigen Heeresgruppe Südukraine beauftragt. Rückwirkend zum 1. März 1944 wurde Schörner im Mai zum Generaloberst befördert.
Im Juli 1944 übernahm Schörner das Kommando über die Heeresgruppe Nord. Am 28. August 1944 wurde er für die Wiederherstellung der Verbindung zur Heeresgruppe Mitte in Kurland (Unternehmen Doppelkopf) mit den Schwertern zum Ritterkreuz mit Eichenlaub ausgezeichnet, am 1. Januar 1945 erhielt er die Brillanten für drei schwere, zweimonatige Abwehrkämpfe im Raum Kurland. Mit dem 20. Januar 1945 wurde Schörner Oberbefehlshaber der Heeresgruppe A (Weichsel-Oder-Operation) und am 5. April 1945 in dieser Stellung zum Generalfeldmarschall ernannt.
Unter Schörners Führung konnten 1,6 Millionen Flüchtlinge aus Schlesien und dem Sudetenland dem Zugriff der anrückenden sowjetischen Verbände entzogen werden (siehe Vertreibung). Gleichzeitig schickte er zahlreiche Soldaten und Volkssturmmänner auf sogenannte Himmelfahrtskommandos. Regelmässig riss er zurückweichenden Offizieren Orden und Rangabzeichen herunter und verurteilte versprengte Soldaten zum Tode. Im März 1945 wollte Schörner Generalmajor Hanns von Rohr hinrichten lassen, weil dieser sich geweigert hatte, Soldaten, die vor sowjetischen Panzern geflüchtet waren, zu erschiessen. Das OKH milderte das Todesurteil zu Degradierung und Bewährungseinsatz ab.
Im Tagebucheintrag von Joseph Goebbels zum 12. März 1945 heisst es:

„Ich berichte dem Führer dann ausführlich von meinem Besuch in Lauban. Der Führer ist auch der Meinung, dass Schörner einer unserer hervorragendsten Heerführer ist. … Es sei Schörner gelungen, die Front in seinem Kampfraum im wesentlichen zu stabilisieren. Auf ihn sei es zurückzuführen, dass die Moral der Truppe dort so hervorragend gehoben worden sei. Ich berichte dem Führer von den radikalen Methoden, die Schörner zur Erreichung dieses Zieles anwendet. Deserteure finden bei ihm keine Gnade. Sie werden am nächsten Baum aufgeknüpft, und ihnen wird ein Schild um den Hals gehängt mit der Aufschrift: ‚Ich bin ein Deserteur. Ich habe mich geweigert, deutsche Frauen und Kinder zu beschützen und bin deshalb aufgehängt worden.‘ Solche Methoden wirken natürlich. Jedenfalls weiss der Soldat im Kampfraum Schörners, dass er vorne sterben kann und hinten sterben muss“.
Hitler bestimmte Schörner am 30. April 1945 in seinem politischen Testament zum Oberbefehlshaber des Heeres. Am 8. Mai 1945 überbrachten ihm amerikanische Truppen unter Oberstleutnant Robert Pratt in seinem Hauptquartier in Bad Welchow die deutsche Kapitulationsurkunde. Am nächsten Tag floh Schörner in Zivilkleidung und mit einigen tausend Mark aus der Stabskasse in einem Fieseler Storch auf eine Alm in Göriach (Österreich), wo er von amerikanischen Truppen gefangen genommen und wenige Tage später an die Sowjetunion ausgeliefert wurde.
Verurteilungen und Nachkriegszeit
Schörner wurde im Februar 1952 in der Sowjetunion wegen Kriegsverbrechen zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt und war bis Ende 1954 in verschiedenen Lagern inhaftiert. Am 15. Januar 1955 wurde er entlassen. Seine Rückkehr nach Deutschland (zunächst nach Dresden, dann nach Bayern) fiel in die Zeit der Wiederbewaffnung; die Gründung der Bundeswehr stand bevor. Am 31. März 1955 eröffnete der Bundesdisziplinaranwalt das Disziplinarverfahren mit dem Ziel der Aberkennung seiner Versorgungsbezüge. Dass ehemalige dem NS-Regime ergebene Wehrmachtoffiziere in der Bundesrepublik Pensionen nach der 131er-Regelung erhielten und teilweise sogar mit nationalsozialistischen Äusserungen hervortraten, wurde von den Wiederbewaffnungsgegnern scharf kritisiert. Auch konservative Politiker sprachen sich nun im Fall Schörners gegen die Gewährung einer Pension aus. Der spätere Verteidigungsminister Franz Josef Strauss distanzierte sich von ihm („Ungeheuer in Uniform“), und der Bundestag beschloss am 13. Juli 1955 eine rückwirkende Änderung der Bundesdisziplinarordnung, die als Lex Schörner galt. Die zuständige Bundesdisziplinarkammer sah das Rückwirkungsverbot verletzt und legte den Fall dem Bundesverfassungsgericht vor, das im Sinne des Bundesdisziplinaranwalts entschied.
Im Jahr 1957 wurde gegen Schörner Anklage erhoben. Er wurde wegen der von ihm ausgesprochenen Todesurteile bei Kriegsende, die vom Gericht als verübter und in einem anderen Fall als versuchter Totschlag gewertet wurden, zu viereinhalb Jahren Freiheitsstrafe und der Aberkennung der Pensionsberechtigung verurteilt. Am 4. August 1960 wurde Schörner aus Gesundheitsgründen vorzeitig aus der Haft in der Justizvollzugsanstalt Landsberg entlassen. 1963 wurde ihm vom Bundespräsidenten Heinrich Lübke ein Teil seiner Pension gewährt.
Der „blutige Ferdinand“ galt als „der brutalste von Hitlers Feldmarschällen“. Er wurde 1973 in Mittenwald bestattet. Soldaten der Bundeswehr war die Teilnahme an der Beisetzung in Uniform verboten, eine Teilnahme in Zivil war nicht erwünscht.