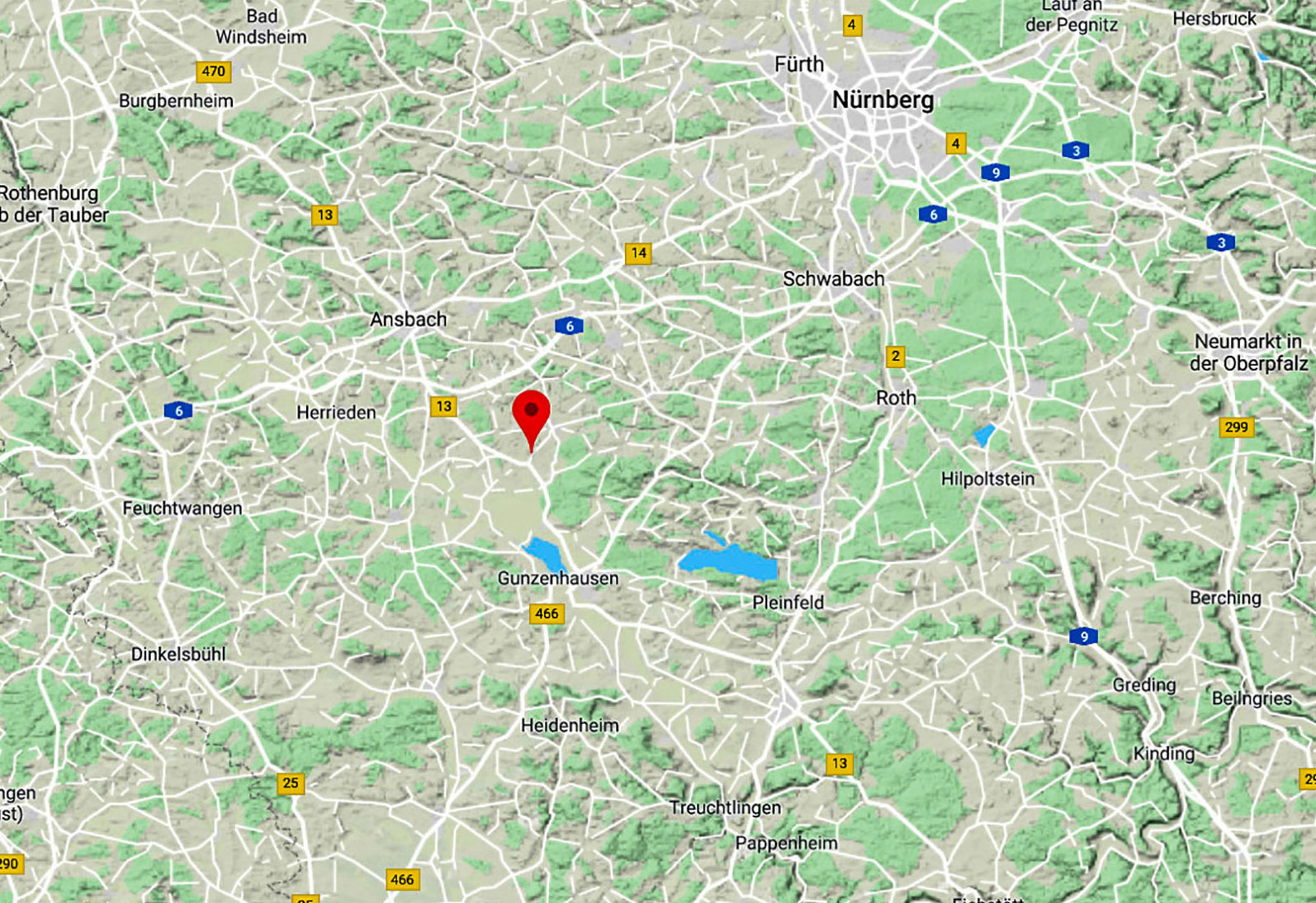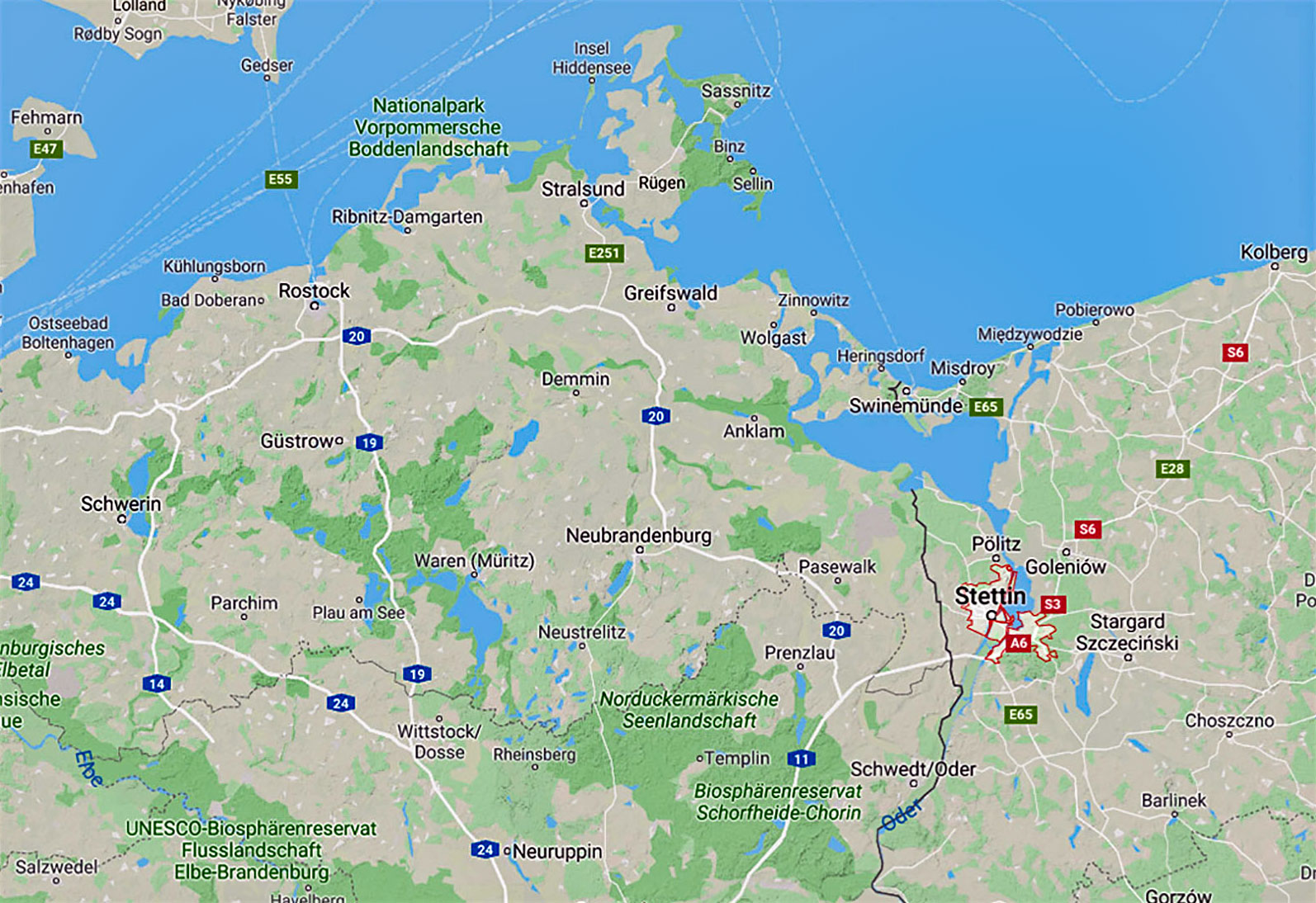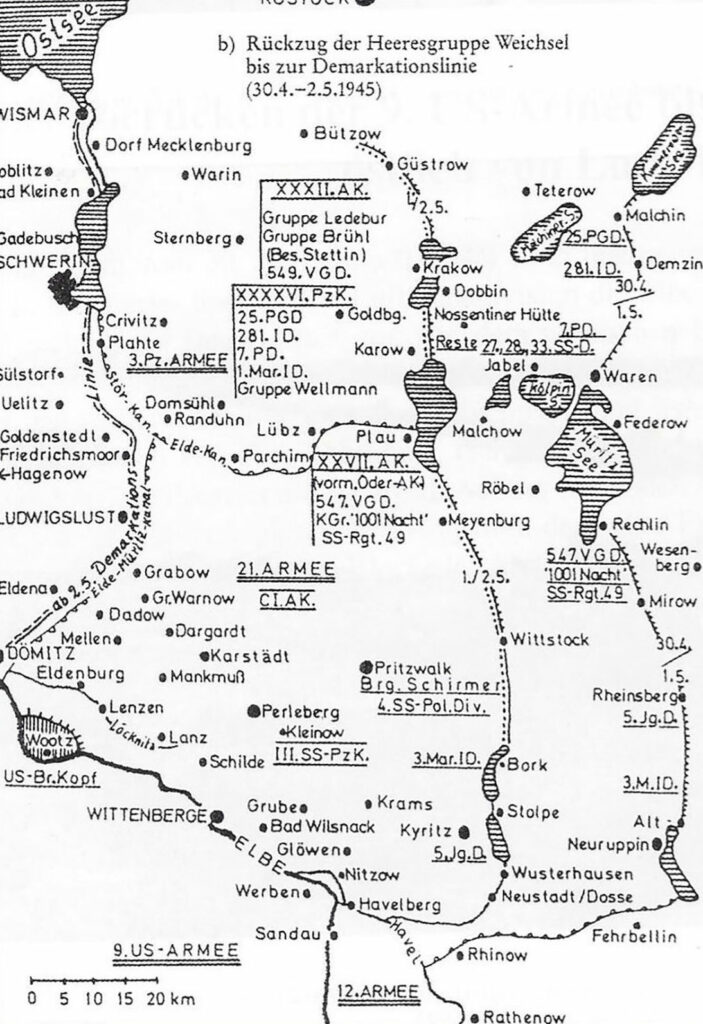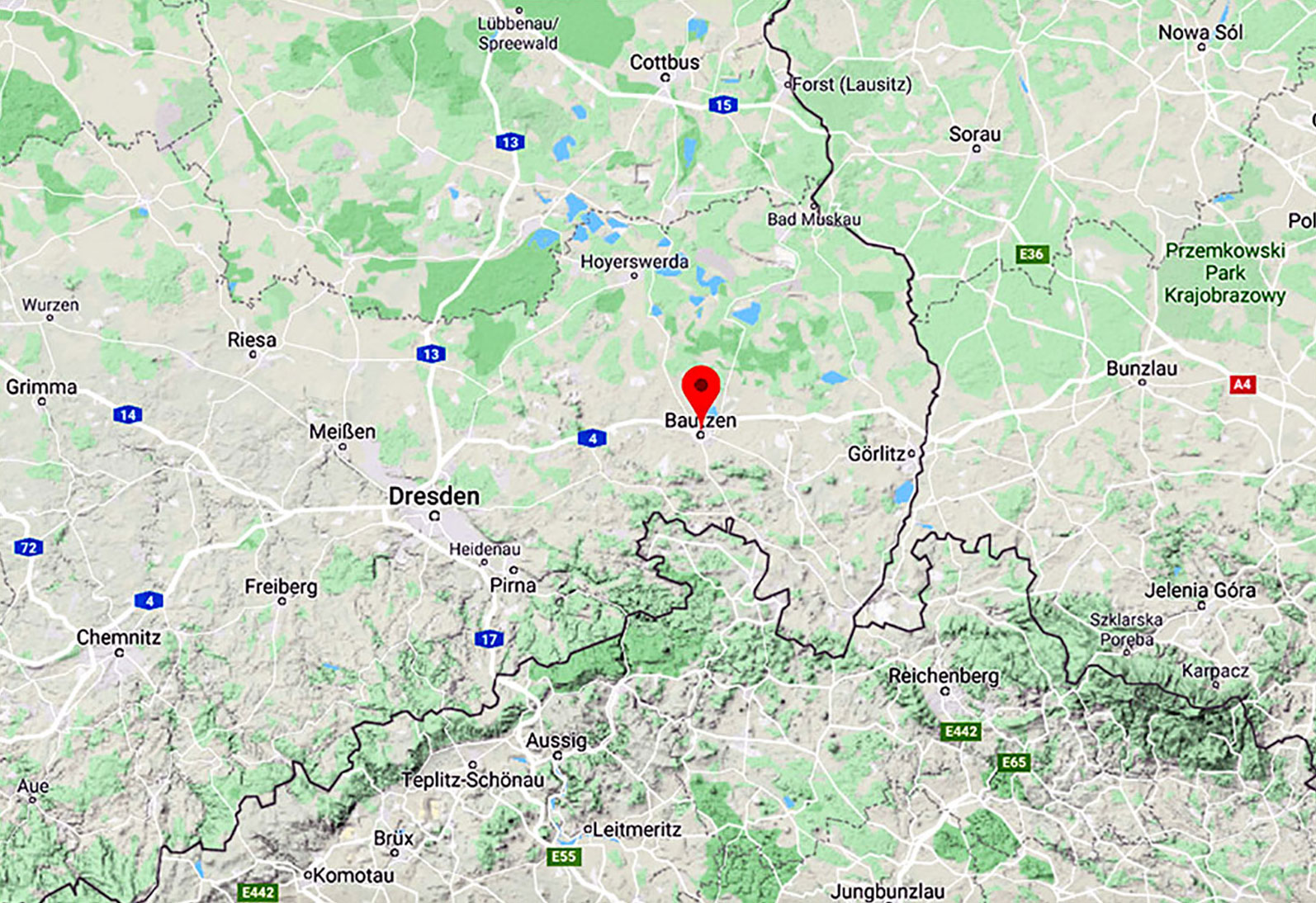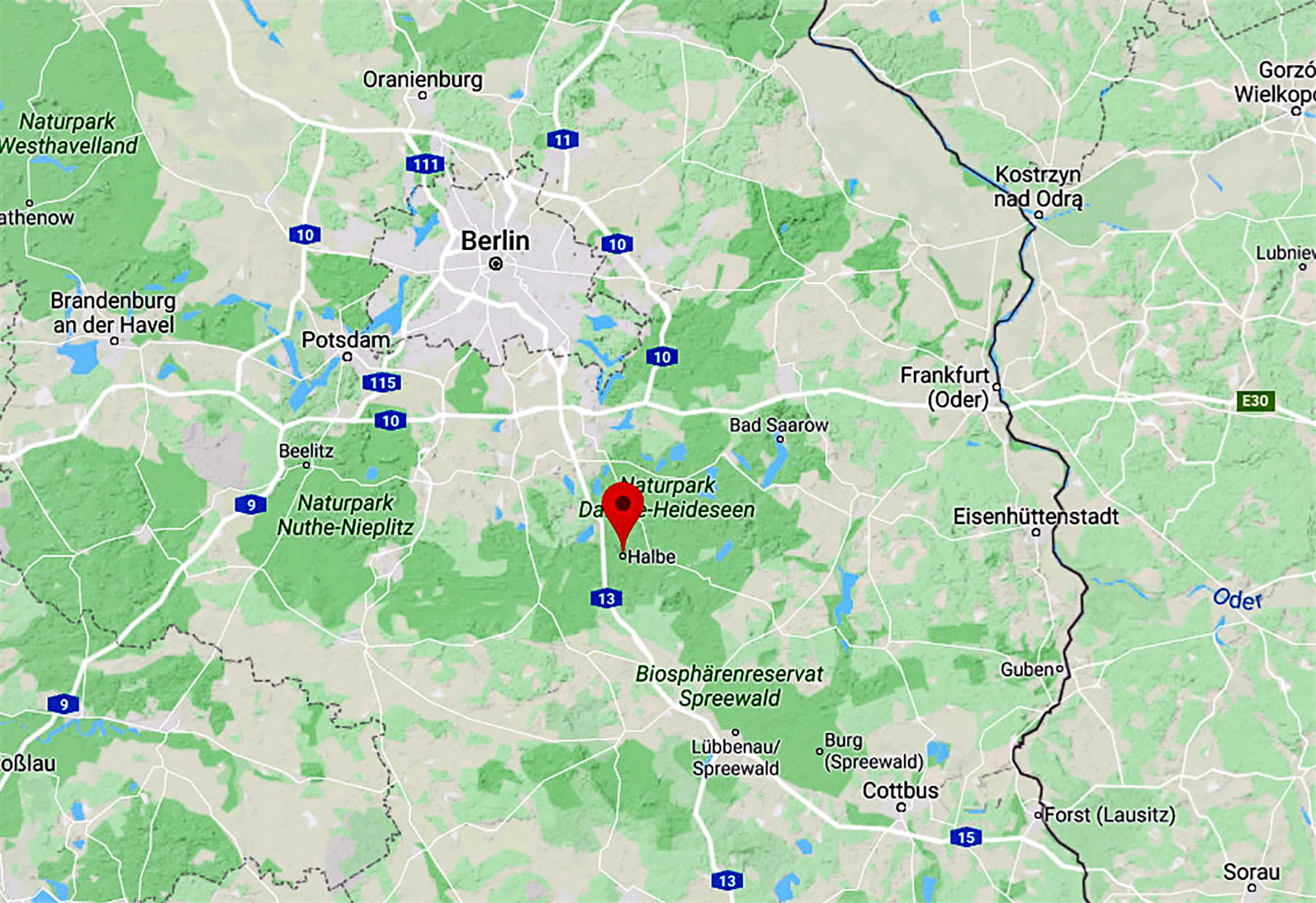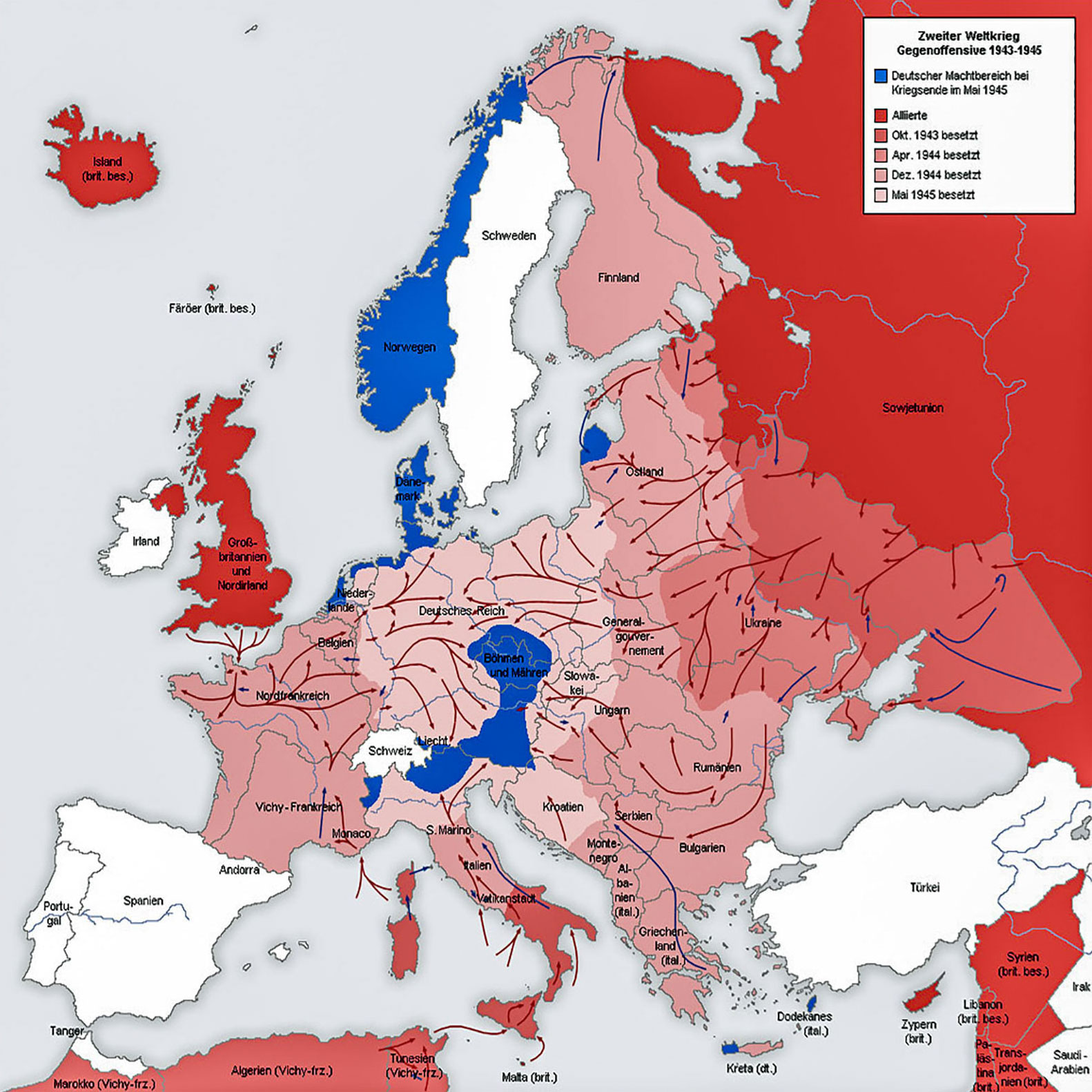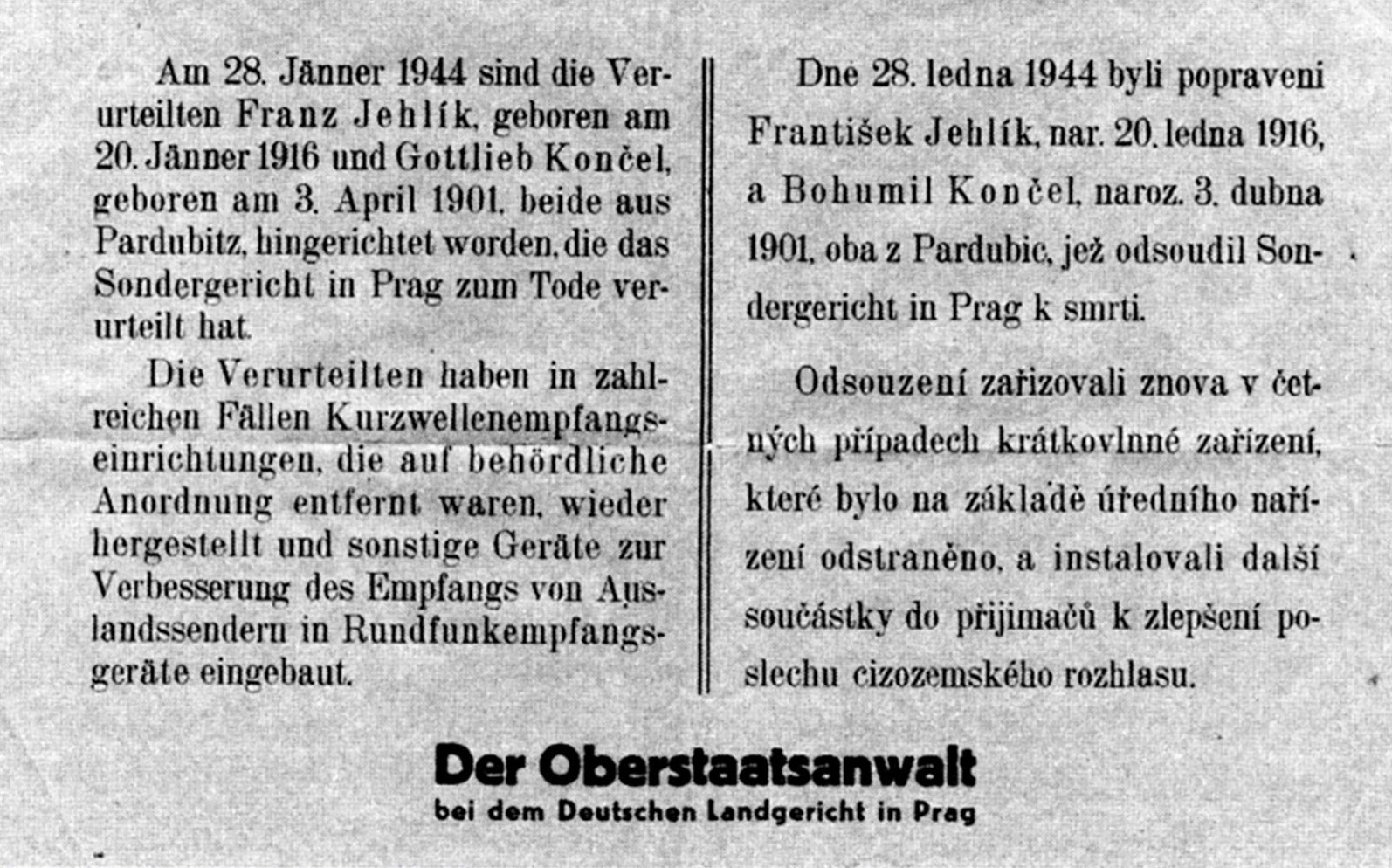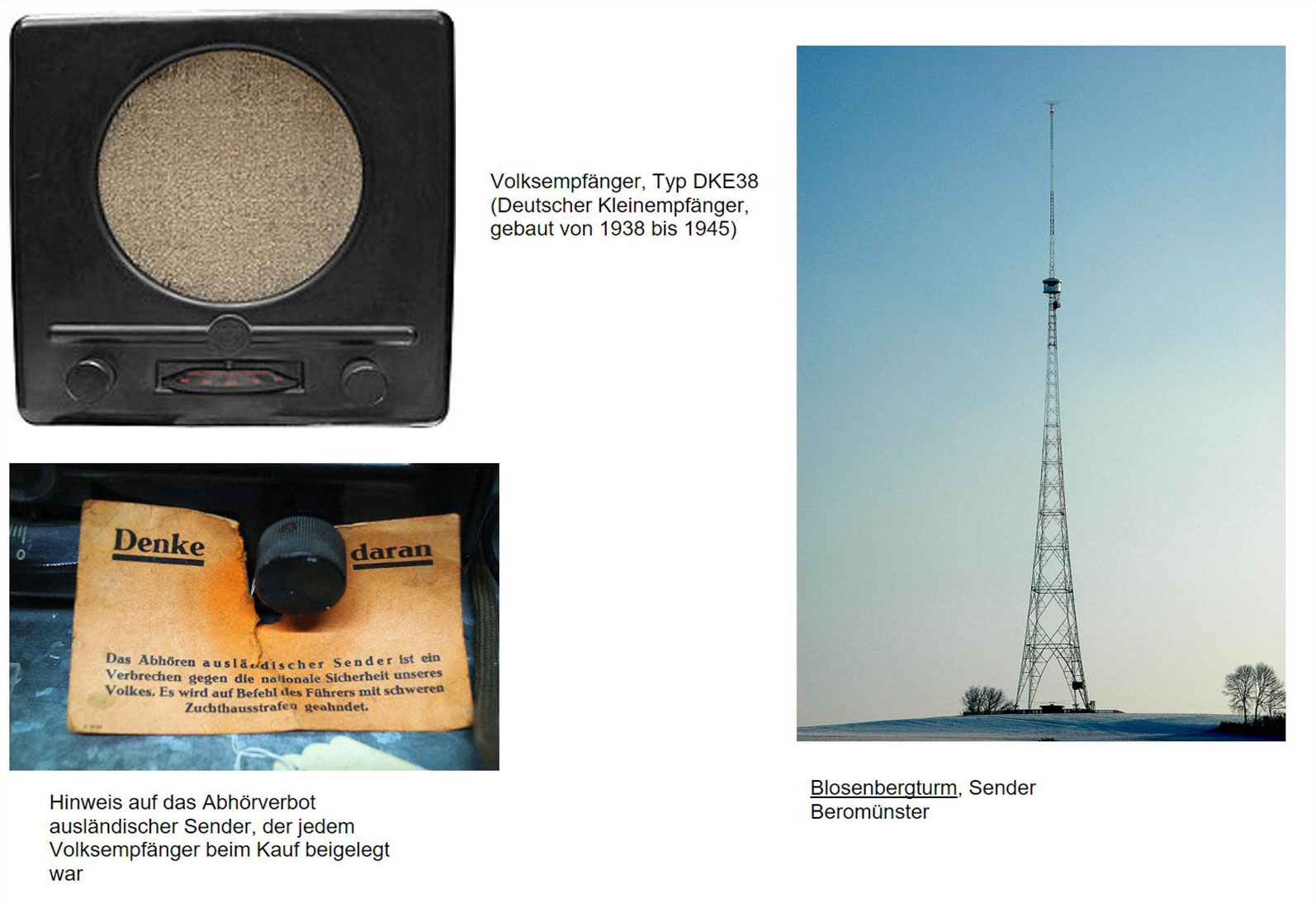Die letzten Tage des "Tausendjährigen Reiches"
Datenherkunft: Die Datenherkunft wird beim jeweiligen Thema angezeigt.
aus-der-zeit.site > Kriegsverlauf 1945
- Kampf um Merkendorf (18.04.1945 – 20.04.1945)
- Stettin-Rostocker Operation (20.04.1945 – 05.05.1945)
- Schlacht um Bautzen (21.04.1945 – 26.04.1945)
- Kesselschlacht von Halbe (25.04.1945 – 28.04.1945)
- Befreiung KZ Dachau (29.04.1945)
- Tod von Adolf Hitler (30.04.1945)
- Tod von Joseph Goebbels
- Schlacht um Schloss Itter (05.05.1945)
- Fronten in Auflösung
- Rückblick auf die letzten Gefechte im zweiten Weltkrieg 1945
- Weitergekämpft bis fünf nach zwölf
- Rundfunkpropaganda im Zweiten Weltkrieg
- Alltagsleben in Deutschland im 2. Weltkrieg
Kampf um Merkendorf (18.04.1945 – 20.04.1945)
Der Kampf um Merkendorf war eine militärische Auseinandersetzung zwischen Verbänden der US Army und der Waffen-SS gegen Ende des Zweiten Weltkrieges um die Stadt Merkendorf in Mittelfranken. Bei den dreitägigen Kämpfen vom 18. bis 20. April 1945, die mit der Einnahme Merkendorfs durch die Amerikaner endeten, starben 96 Menschen. Viele, teils historische Gebäude wurden zerstört.
Vorgeschichte
Ab dem 26. März 1945 begann die 7. US Armee, den Rhein bei Worms zu überqueren. Zu den Verbänden gehörte die 101. Cavalry Group (mechanized) der Nationalgarde unter dem Kommando von Colonel Charles B. McClelland. Sie war mit Spähpanzern und einigen Jagdpanzern ausgerüstet und übernahm Aufklärungs- und Sicherungsaufgaben an den Flanken der 7. Armee. Hierbei geriet sie in kleinere Hinterhalte deutscher Truppen, die versuchten, das Vordringen der Alliierten zu verzögern. „Troop A“ der 101. wurde am 18. April 1945 in Wolframs-Eschenbach in Kämpfe verwickelt, während „Troop C“ diesen Ort umging und auf Merkendorf vorrückte.
Geschwächte Truppenverbände der deutschen Wehrmacht wichen vor den heranrückenden amerikanischen Panzerverbänden immer weiter nach Süden zurück, auch über die Reichsstrasse 13, an der Merkendorf lag. Die Heeresgruppe B entschied, Merkendorf zu verteidigen. Der Ort wurde zur „Festung“ erklärt. Mit der Aufgabe wurde, die der Heeresgruppe B unterstellte SS-Kampfgruppe „Bataillon Deggingen“ unter dem Befehl von SS-Sturmbannführer Willy Baumgärtel beauftragt und vom württembergischen Deggingen aus in die Region beordert. Merkendorf war die einzige Gemeinde im weiteren Umkreis, die verteidigt werden sollte.
Am 14. April protestierten einige Merkendorfer Frauen erfolglos gegen die Verteidigung der Stadt. Am 16. April wurden in Merkendorf Verteidigungsanlagen errichtet, darunter eine Panzersperre. Am Nachmittag des 17. April besichtigte Kreisleiter Gerstner die Verteidigungsanlagen. 150 Frauen und Kinder protestierten erneut gegen die geplante Verteidigung, jedoch ebenfalls ohne Erfolg. Amerikanische Truppenverbände überschritten die Reichsstrasse 14 bei Ansbach. Im Merkendorfer Rathaus hielten deutsche Offiziere eine Lagebesprechung ab. Zerschlagene Heeresteile der 2. Gebirgs-Division zogen sich auf der Reichsstrasse 13 von Ansbach kommend und auf der Staatsstrasse Wolframs-Eschenbach–Windsbach zurück. Sprengkommandos zerstörten auf ihrem Rückzug in Richtung Gunzenhausen alle grösseren Brücken, wie die in Ornbau.
Verlauf
Am Mittag des 18. April 1945 erschienen amerikanische Beobachtungsflugzeuge über Merkendorf. Amerikanische Truppen drangen in Richtung Wolframs-Eschenbach–Merkendorf vor. Der Volkssturm, der weitere Verteidigungsanlagen um die Stadt errichten sollte, wurde aus dem nahen Mönchswald zurückbeordert. In den nächsten Stunden suchte die Stadtbevölkerung Schutz in Kellern und behelfsmässig errichteten Unterständen in Gärten. Die deutschen Truppen bezogen Positionen in und um den Ort. Anrückende amerikanische Panzer auf der Anhöhe bei Gerbersdorf wurden mit Maschinengewehren beschossen. Diese erwiderten das Feuer. Die Stadtkirche „Unserer Lieben Frau“ und weitere Gebäude gerieten in Brand.
Die Kampffront verlief im Nordosten zur Altstadt. US-Panzer beschossen die Stadt. Um den weiteren Beschuss zu verhindern ging ein Bewohner mit einem weissen Tuch den Gegnern entgegen und erreichte die Einstellung des Feuers. Die Amerikaner besetzten Merkendorf mit 40 bis 50 Panzern und Panzerspähwagen. Es brannte an 28 Stellen in der Stadt.
Das Kampfbataillon „Deggingen“ zog sich etwa 2,5 Kilometer von Merkendorf entfernt in die Wälder zurück. Der Kommandant der SS-Truppen verfügte, dass zwei Kampfgruppen in der Nacht vom 18. auf den 19. April in der Nacht in Merkendorf einzudringen hätten, um die Panzer der Amerikaner zu zerstören.
Gegen 3 Uhr am 19. April arbeitete sich eine Kampfgruppe an das Untere Tor und das Taschentor heran und zerstörte in einem verlustreichen Strassenkampf sechs amerikanische Panzer und einen Panzerspähwagen. Ein weiterer Verband rückte von Süden und Südosten in die Vorstadt ein. Bei heftigem Kampf wurden mehrere Panzer zerstört. Unterdessen drang die 1. Kompanie des SS-Verbands bis zum Marktplatz vor. Beim Unteren Tor kam es erneut zu schweren Gefechten. Aufgrund der letztlichen militärischen Überlegenheit der Amerikaner zogen sich die SS-Kampftruppen wieder in den Mönchswald zurück. Der amerikanische Besatzungskommandant erliess für die Stadtbevölkerung für den Abend eine Ausgangssperre. Auch die amerikanischen Verbände zogen sich aus der Stadt zurück. Die Nacht vom 19. auf den 20. April blieb ruhig.
Am Morgen des 20. April kamen erneut deutsche Soldaten in die Stadt und versuchten, die Amerikaner aufzuhalten. Viele Bewohner flohen in Panik in die umliegenden Dörfer. Als die Amerikaner am Morgen des 21. April anrückten, war kein deutscher Soldat mehr in der Stadt. Sie liessen die Barrikade im Oberen Tor wegräumen und besetzten Merkendorf endgültig.
Folgen
Nach dem Zusammenbruch der Front bei Merkendorf wurde die Kampfgruppe „Deggingen“ an die Bahnlinie Gunzenhausen–Cronheim–Wassertrüdingen beordert, um dort in Stellung zu gehen.
Insgesamt wurden bei den Kämpfen um Merkendorf 96 Menschen getötet, davon waren 12 Zivilisten, 70 amerikanische Soldaten und 14 Soldaten der Waffen-SS. Die getöteten Zivilisten und Soldaten wurden auf dem Merkendorfer Friedhof beigesetzt. Eine geplante Umbettung der Soldaten auf den Soldatenfriedhof Nagelberg bei Treuchtlingen unterblieb auf Wunsch der Stadt Merkendorf.
Sowohl in der Altstadt als auch in der Vorstadt wurden zahlreiche Gebäude während der Kampfhandlungen komplett zerstört oder schwer beschädigt. Insgesamt brannten 39 Gebäude ab, vier wurden schwer und 23 leicht beschädigt.
Zahl der Toten
Die Anzahl und Zusammensetzung der Getöteten ist umstritten. Die Dokumentation der 101st Cavalry gibt auf Seite 37 80 Tote SS-Soldaten bei nur zwei getöteten US-Soldaten an, während Stephen G. Fritz auf Seite 178 in „Endkampf: Soldiers, Civilians, And The Death Of The Third Reich“ auf deutsche Berichte verweist, die elf Tote, 24 Verwundete und 29 Vermisste unter den angreifenden Waffen-SS Soldaten angeben, die Amerikaner verloren nach Fritz zwei Tote und vier Vermisste. Koch nennt in Krieg und Frieden – Merkendorf 1944–1949 insgesamt 96 Tote.
Stettin-Rostocker Operation (20.04.1945 – 05.05.1945)
Die Stettin-Rostocker Operation vom 20. April bis 5. Mai 1945 war im Zweiten Weltkrieg eine der letzten Operationen der sowjetischen Truppen im Raum Mecklenburg und Vorpommern sowie Teil der Berliner Operation. Im Verlauf dieser Kämpfe wurde die deutsche 3. Panzerarmee an der nördlichen Oderfront durch mehrere sowjetische Armeen der 2. Weissrussischen Front geschlagen und verfolgt. Beim Abschluss der Kämpfe wurde der sowjetische Vormarsch in Vorpommern an der Linie Stralsund – Rostock, in Mecklenburg vor Schwerin und im nördlichen Brandenburg an der Linie Wittstock – Wittenberge an der Demarkationslinie gestoppt und die Verbindung mit den verbündeten Truppen der alliierten 21. Armeegruppe hergestellt.
Vorgeschichte
Nach der Schlacht um Ostpommern wurden die Truppen der 2. Weissrussischen Front unter Marschall K. K. Rokossowski nach Westen an die nördliche Oder-Front verschoben, um die Truppen der 1. Weissrussischen Front bei der Berliner Operation zu unterstützen. Rokossowskis Front verlief auf etwa 170 Kilometer von der Mündung der Oder, weiter entlang des östlichen Ufers bis südlich nach Schwedt und Oderberg, wo der Anschluss an die 61. Armee der 1. Weissrussischen Front erfolgte. Die Hauptmacht der Front (65., 70. und 49. Armee) wurde zwischen Altdamm und Schwedt konzentriert.
Am 10. April führte Marschall Rokossowski die Erkundung des künftigen Angriffsraumes durch. Es stellte sich heraus, dass die Flussaue zwischen den beiden Armen der Oder überflutet war, es hatte sich ein durchgehender Wasserraum von bis 3 km Breite gebildet, der wegen des flachen Wassers durch Boote schwer passierbar war. Um die überflutete Oder-Aue besser zu überwinden, sollten die Überreste der baufälligen Staudämme genutzt werden. In Folge wurde beschlossen, den Fluss auf der ganzen Strecke gleichzeitig zu überschreiten, und an der Stelle wo sich der Erfolg zeigte, sofort alle Reserven zum Nachstossen nachzuführen. Am 13. April begannen sich die Truppen der 2. Weissrussischen Front auf die Offensive vorzubereiten, die 65. Armee besetzte die Ausgangsposition am Brückenkopf von Altdamm bei Ferdinandstein.
Südlich davon kamen ab 16. April die Truppen der 70. Armee an der Oder an. Zwischen Kranzfelde bis Nipperwiese etablierte sich die sowjetische 49. Armee, einen Tag früher rückte als südlicher Nachbar die 61. Armee der 1. Weissrussischen Front in ihre Ausgangsstellungen. Die Truppen der 2. Stossarmee lösten ab 15. April früh, die nördlich der 65. Armee zwischen Kammin und Greifenberg stehenden Teile der polnischen 1. Armee ab. Am selben Tag bezog ein Teil der 19. Armee (W. S. Romanowski) die Ostsee-Küste und löste das 3. Garde-Kavallerie-Korps ab, das einen Übergang nach Schwedt führen sollte.
Aufmarsch
Im Rahmen der Heeresgruppe Weichsel stand die 3. Panzerarmee der sowjetischen Übermacht mit etwa 11 Divisionen und etwa 220 Panzer gegenüber: Von Nord nach Süd standen folgende Formationen unter General der Panzertruppe Hasso von Manteuffel und dessen Stabschef Generalmajor Burkhart Müller-Hillebrand an der Oderfront:
- Verteidigungsbereich Swinemünde (Generalleutnant John Ansat) mit der Ausbildungs-Division 402 (Generalleutnant von Schleinitz) am Peeve-Abschnitt als Reserve bei Mellenthin, Festung Swinemünde und die 3. Marine-Division (Oberst Henning von Witzleben, später Oberst Fritz Fullriede) zunächst am Ostufer der Halbinsel Wollin. Als Seekommandant Swinemünde fungierte der Kapitän zur See Johannes Rieve.
- Armeekorps (General der Infanterie Friedrich-August Schack) hielt mit der Kampfgruppe Ledebur die Küste am Haff von Neuwarp abwärts, die 549. Volksgrenadier-Division (Generalmajor Karl Jank) südlich davon zwischen Ziegenort bis Pölitz im Raum nördlich von Stettin. Als Reserve fungierte dahinter die Infanterie-Division „Voigt“ (Oberst Hans-Jürgen von Ledebur) und die 281. Infanterie-Division (Generalleutnant Bruno Ortner) beidseitig der Festung Stettin, deren Garnison unter Generalmajor Ferdinand Brühl stand. Erste Teile der 7. Panzerdivision (Oberst Hans Christern) wurden bereits über See aus Danzig herangeführt.
- Das Korps Oder (SS-Obergruppenführer und General der Polizei und Waffen-SS Erich von dem Bach-Zelewski) im Hauptangriffsfeld liegend mit der 610. Infanterie-Division (Oberst Fritz Fullriede) südlich von Stettin bei Kurow beiderseits der Autobahn, mit der Division „Wellmann“ folgend nördlich von Pargow bis südlich Gartz, als Reserve bei Hohenleihe fungierte die Infanterie-Brigade „Klossek“.
- Panzerkorps (General der Infanterie Martin Gareis) mit der 547. Volksgrenadier-Division (Generalmajor Erich Fronhöfer) beiderseits von Schwedt und südlich davon mit der 1. Marine-Division (Generalmajor Wilhelm Bleckwenn) bis Hohensaaten, wo an der Naht zur 9. Armee die 5. Jäger-Division des CI. Armeekorps (General der Artillerie Wilhelm Berlin) anschloss.
- Als Reserve war im Raum Passow und Löcknitz das III. SS-Panzerkorps (SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS Felix Steiner) mit den Resten der 27. SS-Division „Langemark“ (SS-Standartenführer Thomas Müller) und der 28. SS-Division „Wallonien“ (SS-Standartenführer Leon Degrelle) verfügbar.
- Panzer-Grenadier-Division (Generalmajor Josef Rauch) im Raum Joachimsthal
- Waffen-Grenadier-Division der SS (lettische Nr. 1) (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS Karl Burk)
In der Nacht zum 16. April haben einzelne sowjetische Einheiten die Dämme in der Oderaue besetzt. Der erkannte Aufmarsch der sowjetischen Truppen wurde durch die Artillerie der Festung Stettin behindert. In den folgenden Tagen wurde die Masse der Angriffstruppen nach vorne verlegt. Bis zum 17. April war der Aufmarsch der gepanzerten Reserve, bestehend aus dem 1., 3. und 8. Garde-Panzer- und dem 8. Mechanisierten Korps abgeschlossen. Die ganze Nacht vom 19. auf den 20. April hindurch, bombardierte die sowjetische Luftwaffe die deutschen Verteidigungsanlagen. Um den Feind in die Irre zu führen, wurden Vorbereitungen getroffen, um den Fluss auch nördlich von Stettin mit Truppen der 2. Stossarmee zu überschreiten.
Der Angriff über die Oder am 20. April
Die 2. Weissrussische Front zählte 33 Schützendivisionen, drei Artilleriedivisionen und mehrere Artillerie- und Raketenwerferbrigaden. Rokossowskis Front besass 951 Panzer und Selbstfahrgeschütze sowie 8320 Artilleriegeschütze (davon 2770 Minenwerfer). Am Morgen des 20. April begann der Angriff der 49., 70. und 65. Armee zwischen Schwedt und Stettin über die Oder, als Reserve wurde die 2. Stossarmee bereitgestellt. Zu Beginn der Operation wurde die 4. Luftarmee unter General K. A. Werschinin eingesetzt. Die Trennlinie mit der 1. Weissrussischen Front war beim Vormarsch nach Westen an der Linie Arnswalde, Schwedt, Angermünde, Gransee, Wittenberge festgesetzt.
Der Angriff über die Oder am 20. April
Die 2. Weissrussische Front zählte 33 Schützendivisionen, drei Artilleriedivisionen und mehrere Artillerie- und Raketenwerferbrigaden. Rokossowskis Front besass 951 Panzer und Selbstfahrgeschütze sowie 8320 Artilleriegeschütze (davon 2770 Minenwerfer). Am Morgen des 20. April begann der Angriff der 49., 70. und 65. Armee zwischen Schwedt und Stettin über die Oder, als Reserve wurde die 2. Stossarmee bereitgestellt. Zu Beginn der Operation wurde die 4. Luftarmee unter General K. A. Werschinin eingesetzt. Die Trennlinie mit der 1. Weissrussischen Front war beim Vormarsch nach Westen an der Linie Arnswalde, Schwedt, Angermünde, Gransee, Wittenberge festgesetzt.
2. Weissrussische Front
- Armee (Generalleutnant Wladimir Sacharowitsch Romanowski)
- Garde-Schützenkorps – Generalleutnant Semjon Petrowitsch Mikulski
- Schützenkorps – Generalmajor Andrei G. Frolenkow
- Stossarmee (Generalleutnant Iwan Iwanowitsch Fedjuninski)
- Schützenkorps – Generalleutnant Vitali Polenow
- Schützenkorps – Generalleutnant Georgi Iwanowitsch Anisimow
- Schützenkorps – Generalmajor Fjodor Kusmitsch Fetisow
- Armee (Generaloberst Pawel Batow)
- Garde-Schützendivision
- Schützenkorps – Generalleutnant Dmitri Alexejew
- Schützenkorps – Generalleutnant Konstantin Maximowitsch Jerastow
- Schützenkorps – Generalleutnant Nikita Jemeljanowitsch Tschuwakow
- ab 22. April 1. Garde-Panzerkorps, Generalmajor Michail Fedorowitsch Panow mit 15., 16. und 17. Garde-Panzerbrigade sowie 30. Panzerbrigade
- Armee (Generaloberst Wassili Stepanowitsch Popow)
- Schützenkorps – Generalleutnant Jakub Jangirowitsch Tschanyshew
- Schützenkorps – Generalleutnant Michail Iwanowitsch Dratwin
- Schützenkorps – Generalleutnant Dmitri Iwanowitsch Rjabyshew
- Garde-Panzer Korps, Generalleutnant Alexei Pawlowitsch Panfilow mit 3., 18. und 19. Panzerbrigade sowie 2. Garde-Schützen-Brigade
- Garde-Kavalleriekorps, Generalleutnant Nikolai Sergejewitsch Oslikowski mit 5. und 6. Garde- sowie 32. Kavallerie-Division
- Armee (Generalleutnant Iwan Tichonowitsch Grischin)
- Schützenkorps – Generalleutnant Wassili Terentjew
- Schützenkorps – Generalleutnant Dmitri Iwanowitsch Smirnow
- Garde-mechanisches Korps, Generalmajor Alexander Firsowitsch mit 58., 59. und 60. Garde-mechanisierte Brigade sowie 116. Panzerbrigade
Die 65. Armee, war die erste, die einen Brückenkopf am Westufer des Flusses bilden konnte, wo mit Fähren sofort weitere Truppen nachgeführt wurden. Von 9 Uhr morgens an verbesserte sich das Wetter, die sowjetische Luftwaffe konnte Unterstützung leisten. Bis 13.00 Uhr hatten die Pioniere der 65. Armee im Raum Pritzlow zwei 16 Tonnen schwere Brücken fertiggestellt. Am ersten Tag der Schlacht errichteten Batows Truppen einen Brückenkopf von über 6 Kilometern Breite und 1,5 Kilometer Tiefe. Dorthin wurden zunächst vier Schützendivisionen des 46. und 18. Schützenkorps unter Generalleutnant K. M. Jerastow und N. J. Tschuwakow übergesetzt. Nach dem Durchbruch der Verteidigung des Feindes wurde jede Armee durch ein Panzer-Korps verstärkt. Das 3. Garde-Kavallerie-Korps verblieb vorerst hinter der linken Flanke der 49. Armee in Reserve. Die Truppen der 70. Armee, die im Raum Greifenhagen konzentriert waren, gelang es im Raum Gartz ebenfalls am westlichen Ufer Fuss zu fassen, südlich davon hatte auch die 49. Armee erste Erfolge. Ihre Pioniere konnten über den Kanälen im leeren Kampfraum Übergänge errichten, nachdem dieser Raum von der deutschen Verteidigung verlassen worden war. Nach Einschätzung der neuen Situation entschied Rokossowski eine der Übergangsbrücken zur Übersetzung der 2. Stossarmee einzusetzen, die Festung Stettin sollte aus dem Süden umgangen werden.
General Manteuffel warf alle deutschen Reserven in den Durchbruchsraum der 65. Armee. Mit Unterstützung der Artillerie der Festung Stettin (Generalmajor Ferdinand Brühl) wurden die Truppen der sowjetische 65. Armee auch an der nördlichen Flanke bedroht. Dem separat im Norden Berlins an der Frontlinie Spandau – Oranienburg – Finow-Kanal mit Front nach Süden eingesetzten III. SS-Panzerkorps wurde zur Verstärkung die 4. SS-Polizeidivision (General Walter Harzer) zugeteilt, um die sowjetische Umfassung Berlins aus dem Westen aufzuhalten. Gleichzeitig hatte sich das an der Oder geschlagene CI. Armeekorps (Generalleutnant Sixt) auf den Brückenkopf von Eberswalde zurückgezogen.
Am folgenden Tag rangen die Truppen Rokossowskis um den Ausbau der errichteten Brückenköpfe. Die sowjetische 49. Armee schaffte es, bei Fiddichow Gelände am Westufer der Oder zu sichern, der Ausbruch über Hohenleide zum Randow-Bruch konnte aber noch nicht erreicht werden. Es wurde beschlossen, hier möglichst viele deutsche Truppen zu binden, den nächsten Hauptschlag rechts davon, aus dem Brückenkopf der 65. Armee zu führen. Am 22. April gelang es der sowjetischen 70. Armee im Raum Gartz ein begrenzter Durchbruch in Richtung auf Petershagen, wo schwache Gegenstösse der 27. SS-Grenadier-Division abgeschlagen wurden. Am 23. April war es möglich, über die Kanäle eine Brücke mit einer Nutzlast von 60 Tonnen zu errichten, die sofort durch deutsches Artilleriefeuer eingedeckt wurde. Obwohl einige Pontons beschädigt wurden, wurde die Brücke repariert und die deutschen Batterien zerstört. Sowjetische Panzer begannen danach sofort die Oder zu überqueren. Die letzten 300 bis 400 Verteidiger von Schwedt hatten sich bereits am 24. April auf Fahrrädern in Richtung auf Parchim abgesetzt.
Am südlichen Abschnitt der 3. Panzerarmee war bereits die sowjetische 2. Garde-Panzerarmee (General Bogdanow) zur Havel vorgestossen, die durch den Spandauer Forst auf Dolgow vorgehenden Kräfte konnte die Strasse nach Havelberg abschneiden. Auf breiter Front erreichten das über Hennigsdorf durchgebrochene 9. Garde-Panzerkorps und das 8. Kavalleriekorps die Linie Ferch-Drewitz-Güterfelde. Die bereits dezimierte 25. Panzer-Grenadier-Division des CI. Armeekorps gab den Brückenkopf am Finow-Kanal bei Eberswalde auf und wurde dem III. SS-Panzerkorps zugeführt. Sie übernahm die Sicherung am Hohenzollernkanal und sollte bei Germersheim einen Entlastungsangriff nach Süden auf Spandau führen, um die jetzt im Raum Ketzin erreichte Verbindung der sowjetischen Fronten wieder aufzureisen.
Bis zum 25. April hatten im Norden Einheiten der 65. und 70. Armee den westlichen Brückenkopf an der Oder auf etwa 8 km Tiefe erweitert. Das 1. Garde-Panzerkorps (General Panow) vollendete den Durchbruch an der deutschen Verteidigungszone. An diesem Tag war der Vormarsch der südlicher stehenden 70. Armee bedeutungsvoller. Unter Ausnutzung der Tatsache, dass der Feind seine Reserven gegen die 65. Armee warf, konnten jetzt auch die Schützendivisionen der 70. Armee vorgehen und am Ende des Tages mehr als 15 km tief vordringen. Der Vormarsch wurde vorübergehend durch den Randow-Bruch aufgehalten, wo sich die zweite Verteidigungslinie der Deutschen befand. Die 49. Armee an der linken Flanke überwand die Oder, indem sie die Übergänge der Nachbararmee nutzte und am Abend 5–6 km vorrückte. Auf deutscher Seite wurden die Reste der 25. Panzer-Grenadier-Division (Generalmajor Arnold Burmeister) aus dem Brückenkopf südlich des Ruppiner Kanals nach Kremmen verlegt, um den sowjetischen Durchbruch bei Oranienburg zu verzögern.
Am 26. April stürmten Truppen der 65. Armee die Stadt Stettin, die gegnerische Verteidigung erreichte den Randow–Bruch und setzte den Vorstoss nach Nordwesten fort. Bis zum Abend waren die deutschen Verteidigungsanlagen insgesamt auf einer 20 Kilometer langen Front durchbrochen, nicht nur die verteidigenden Truppen waren geschlagen, auch die neu herangebrachten Reserven wurden jetzt zurückgedrängt. Nach der Eroberung von Schwedt/Oder durch das 70. Schützenkorps (Generalleutnant Terentjew) der 65. Armee zog sich die 3. Panzerarmme in der Nacht vom 26. auf den 27. April aus dem von Süd nach Nord verlaufenden Uecker-Abschnitt zurück und gab damit die letzte Chance auf eine geschlossene Verteidigung auf.
Verfolgung durch Mecklenburg und Vorpommern
Die Verfolgung der sowjetischen Armeen folgte den neuen Hauptstossrichtungen:
- Die verstärkte 19. Armee hatte entlang der Küste nach Swinemünde und dann nach Greifswald vorzurücken.
- Die 2. Stossarmee setzte nördlich Stettin zwei Korps zur Verfolgung in Richtung Anklam an, ihr Ziel war die Küste bei Stralsund und die Säuberung der Inseln Usedom und Rügen.
- Die 65. Armee mit dem 1. Garde-Panzerkorps voran, hatte in nordwestlicher Richtung nordöstlich von Stettin durch die mecklenburgische Seenplatte auf Rostock durchzustossen und das Meer zu erreichen.
- Die 70. Armee mit dem 3. Garde-Panzerkorps voran, sollte über Prenzlau und Neubrandenburg in Richtung Wismar und Schwerin vorstossen.
- Die südlich der Strelitzer Seenkette vorgehende 49. Armee, sollte das ihr neu zugeführte 8. mechanisierte Korps und das 3. Garde-Kavallerie-Korps über Templin-Wittstock-Pritzwalk westwärts nach Wittenberge, Lenzen und Ludwigslust zur Elde vorführen.
Am 27. April ging die sowjetische Offensive weiter, die 3. Panzerarmee wich durch die mecklenburgische Seenplatte zurück, der nördliche Armeeflügel war bereits in Auflösung begriffen. Die 19. Armee, die die Gristow-Halbinsel vom Feind gesäubert hatte, näherte sich mit ihrer rechten Flanke Swinemünde. Der rechte Flügel der 1. Marine-Division am Ueckersee wurde durchbrochen. Die Hauptkräfte der 2. Stossarmee, die entlang der Südküste des Stettiner Haffs agierte, rückten auf Anklam vor. Unterwegs wurden die Reste der ausgebrochenen Stettiner Garnison zerschlagen, die sich nach Norden zurückgezogen hatte, und die deutschen Truppenteile, die noch nördlich von Stettin verteidigten. Im Abschnitt der 70. Armee eingesetzt, brach das sowjetische 3. Garde-Panzerkorps (General Panfilow) im Zusammenwirken mit dem 47. Schützenkorps (Generalleutnant Dratwin) in Prenzlau ein.
Aus dem Brückenkopf Oranienburg kamen jetzt die 25. Panzer-Grenadierdivision als Verstärkung an, gleichzeitig traf die über Danzig zur See eingeschiffte 7. Panzerdivision am Kampffeld ein. Auf sowjetischer Seite wurde die 5. Garde-Division neu herangeführt und drängte die Reste des Korps der Verbände auf Templin und die Seen-Kette zwischen Lychen-Neubrandenburg zurück. Im Abschnitt westlich von Templin übernahm das aus Ostpreussen herangebrachte Generalkommando XXVII. Armeekorps (General Hörnlein) die Führung über die 547. Volksgrenadier-Division und Brigade 1001, beide Formationen gingen gegenüber der verfolgenden 49. Armee zurück.
Aus dem Raum Gransee-Löwenberg wurde die 1. RAD-Division Schlageter (Generalmajor Heun) zur Verstärkung in den Bereich des XXXXVI. Panzerkorps verlegt. Im Raum Neustrelitz versuchte die 7. Panzer-Division vergeblich gegen die bei Bergfeld und Goldenbaum durchgebrochenen sowjetischen Kräfte, eine Auffangstellung zu errichten. Die über Feldberg zugeführte 27. und 28. SS-Division musste sich über Neustrelitz auf Waren zurückziehen.
General Hoernlein übernahm am 28. April das Kommando über das XXVII. Armeekorps, das sich an der Linie Strasburg-Heinrichswald-Ferdinandshof-Ueckermünde auf Friedland abgesetzt hatte. Immer mehr deutsche Flüchtlinge und Verwundete strömten nach Anklam. Am Morgen des 28. April fanden bereits im nahe gelegenen Ducherow Kämpfe statt, der Kampfkommandant von Anklam, Oberst Rudolf Petershagen versuchte den Kampf zu vermeiden. Der linke Flügel der vorrückenden 65. Armee nahm am 29. April die Städte Friedland und Neubrandenburg ein, am gleichen Tag brach die 46. Schützen-Division des 108. Schützenkorps in Anklam ein. Am 30. April besetzte die 90. Schützendivision unter Generalmajor Ljaschchenko die Stadt Greifswald Der Kommandeur der 46. Schützen-Division, General Botschew nahm das Kapitulationsangebot der Greifswalder Parlamentäre an. Im Gegensatz zu den Nachbarstädten Anklam und Demmin wurde Greifswald vor der Zerstörung gerettet. Oberst Petershagen wurde wegen der kampflosen Übergabe zum Tode verurteilt. Deutsche Verbände, die sich durch das Peene-Tal zurückzogen, sahen Anklam in hellen Flammen. Die Stadt Stralsund wurde ebenfalls kampflos an Einheiten der 2. Stossarmee übergeben. Die Stadt Demmin wurde zum Fanal für die seelischen Gräuel des Krieges. In der Nacht zum 1. Mai plündern Rotarmisten die mit Flüchtlingen überfüllte Kleinstadt, besonders die Frauen mussten grosses Leid ertragen.
Kriegsende an der Elde und Elbe
Ende April lagen östlich der Demarkationslinie an der Elde und Elbe noch keine sowjetischen Verbände, sondern Einheiten der Wehrmacht und der SS. In Mecklenburg drängten sowjetische Truppen bis zur Linie Neuruppin-Müritzsee-Rostock vor. Ihre Jagd- und Schlachtflieger griffen unterstützend in die Kämpfe um Mecklenburg ein. An der mecklenburgischen Seenplatte erfolgen am 30. April sowjetische Panzerdurchbrüche von Penzlin auf Waren und von Neubrandenburg auf Malchin. Alt-Strelitz und Malchin wurden unter Feuer genommen, bei den Kämpfen gingen grosse Teile der Orte in Flammen auf. In Neustrelitz brannte das Schloss, das Theater und weitere Gebäude ab. Beim XXXXVI. Panzerkorps nahm die 281. Infanterie-Division (General Ortner) eine Zwischenstellung bei Demzin ein. Die 28. SS-Division nahm gegenüber der verfolgenden sowjetischen 70. Armee bei Waren eine letzte Abwehrstellung ein. Das XXVII. Armeekorps gab die Stellung zwischen Wesenberg und Fürstenberg auf, nachdem die sowjetische 49. Armee südlich des Plauer- und Müritzsees nach Westen durchgebrochen war. Mirow und Wesenburg wurden von der 547. Volksgrenadierdivision geräumt, der Rückzug erfolgte auf Röbel.
Im Süden begleitete die sowjetische 61. Armee (General Below) den Vormarsch aus dem Raum Fehrbellin über den Hohenzollern-Kanal nach Havelberg zum Elbe-Abschnitt, deren linke Flanke sicherte die Vorhut der polnischen 1. Armee, die in Richtung auf Sandau vorging. Die Reste des CI. Armeekorps (General Sixt) musste Zehdenick aufgeben. Im Raum Rheinsberg wurden die Reste der nach Norden abgedrängten 5. Jäger-Division (Generalmajor Blaurock) eingekesselt, südlich davon bei Lindow kämpfte sich die 3. Marine-Division über Alt-Ruppin nach Westen zurück. Die Brigade Schirmer und die Reste der 4. SS-Polizei-Division wurde auf die Ruppiner Seenkette abgedrängt. Die Reste des XXXII. Armeekorps befanden sich auf dem Rückzug nach Güstrow. Die Truppen der 71. Schützen-Division (Oberst Nikolai Beljaew) des 47. Schützenkorps besetzten Malchin. Die 7. Panzerdivision erkämpfte sich westlich von Waren den Rückzug über Jabel, die 281. Infanterie-Division wurde auf den Krakower See gedrängt, nördlich davon ging die 25. Panzer-Grenadier-Division zwischen den Malchiner-Seen nach Teterow zurück.
Bei Wolgast zogen sich die deutschen Verbände am 30. April unter Feuerschutz von auf dem Peene verkehrenden Schiffen der Kriegsmarine an das jenseitige Peene-Ufer zurück, um von dort aus die auf die Stadt vorgehenden Truppen der sowjetischen 2. Stossarmee unter Feuer zu nehmen. Deutsche Pioniereinheiten zündeten Sprengladungen an den Wolgaster Brücken, um den sowjetischen Truppen durch das Zerstören der Querungen den Weg auf die Insel Usedom abzuschneiden. Bis zum Morgen des 3. Mai wurde von sowjetischen Pionieren eine Behelfsbrücke über den Peene errichtet. Die 354. Schützen-Division (Generalmajor Wladimir Nikolajewitsch Janjgaw) des 105. Schützenkorps rückte in Grimmen ein. Die Kampfhandlungen endeten hier erst am 5. Mai, in Wolgast wurde eine russische Kommandantur eingerichtet.
Am 1. Mai erreichte die 70. Armee mit dem 3. Garde-Panzerkorps (Generalleutnant Panfilow) Rostock, am folgenden Tag besetzte die 3. Panzer-Brigade (Oberstleutnant Fedor Chrisanfowitsch Jegorow) die Küste säubernd auch Warnemünde. In den letzten Kriegstagen wurden noch mehr als 60.000 Flüchtlinge, Soldaten und Verwundete mit Kriegs- und Handelsschiffen über die Häfen Rostock und Wismar nach Westen evakuiert, um der sowjetischen Gefangenschaft zu entgehen.
Folgen
Obwohl Rokossowskis Operation keinen direkten Einfluss auf die Schlacht um Berlin hatte, band sie doch die Kräfte der 3. Panzerarmee und schloss so Kräfteverschiebungen an andere Frontabschnitte aus. Dadurch trug sie wesentlich zum schnellen Zusammenbruch der deutschen Oderfront bei. Der Rückzug gegenüber den sowjetischen Truppen an der Ostseeküste gab dem deutschen Oberkommando keine Möglichkeit mehr, evakuierte Truppen aus dem Kessel von Kurland zur Verteidigung Deutschlands an die Häfen Mecklenburgs auszulanden. Grosse Verbände der Wehrmacht zogen sich auf die Linie Ludwigslust, Grabow und Schwerin zurück, um in US-amerikanische Gefangenschaft zu gehen. Vor den Truppen der 1. Ukrainischen Front war das Oberkommando der Wehrmacht von Zossen nach Nordwesten geflüchtet. Die 2. Weissrussische Front Rokossowskis besetzte in den letzten Kriegstagen in Vorpommern (Stralsund – Rostock), in Mecklenburg (bis kurz vor Schwerin) und das nördliche Brandenburg an der Linie Wittstock – Wittenberge.
Am 3. Mai nahm das sowjetische 3. Garde-Panzer-Korps südwestlich von Wismar Kontakt zu den vorderen Einheiten der britischen 2. Armee auf. Am 4. Mai trafen die Truppen der 70., 49. Armee, 8. mechanisierten und 3. Garde-Kavalleriekorps an der Demarkationslinie mit den Truppen der britischen 21. Armeegruppe zusammen, die an einigen Stellen über die Elbe vorgedrungen waren. Teile der sowjetischen 19. Armee und Truppen der 2. Stossarmee kämpften einen weiteren Tag um die Insel Wollin, Usedom und Rügen von deutschen Truppen zu säubern. Am 5. Mai besetzen Einheiten der 2. Stossarmee Peenemünde; zwei Divisionen der 19. Armee landeten zur Säuberung auf der dänischen Insel Bornholm.
Bei Schwerin kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Roten Armee unter Marschall Konstantin Rokossowski und Soldaten der Westalliierten. Ein Treffen zwischen Feldmarschall Montgomery und Marschall Rokossowski fand am 7. Mai in Wismar statt. Die Demarkationslinie verlief zunächst östlich von Wismar–Schweriner See–Ludwigslust–Dömitz. Schwerin und Westmecklenburg wurden zuerst von Amerikanern und Briten besetzt, bevor am 1. Juli die Sowjets die Kontrolle übernehmen. Die Trennungslinie wurde gemäss den Beschlüssen der Konferenz von Jalta weiter nach Westen verlegt.
Schlacht um Bautzen (21.04.1945 – 26.04.1945)
Als Schlacht um Bautzen, die vom 21. April bis zum 26. April 1945 stattfand, werden die umfangreichen Kampfhandlungen zwischen der deutschen Wehrmacht auf der einen sowie polnischen und sowjetischen Einheiten auf der anderen Seite in und um die Stadt Bautzen im Zweiten Weltkrieg bezeichnet. Die Schlacht war in erster Linie gekennzeichnet von der letzten grösseren deutschen Panzeroffensive sowie einem tagelang geführten Häuserkampf, der zur vollständigen Zurückeroberung Bautzens führte, betraf darüber hinaus aber auch die nordöstlich der Stadt gelegenen Gebiete, vor allem auf der Linie Bautzen-Niesky. Insbesondere die 2. Polnische Armee verzeichnete im Verlauf der Kämpfe hohe Verluste.
Ablauf der Kampfhandlungen
Wie viele deutsche Städte, vor allem an der Ostfront, wurde auch Bautzen in der letzten Phase des Zweiten Weltkrieges zur Festungsstadt erklärt und als „Bollwerk“ gegen alliierte Truppen ausgebaut.
Der Kommandeur der „1. Ukrainischen Front“ der Roten Armee, Marschall Iwan Stepanowitsch Konew, eröffnete am 16. April 1945 mit seinem Grossangriff den Vorstoss nach Westen und damit die Schlacht um Berlin. Die 2. Polnische Armee der Polnischen Volksarmee unter General Karol Świerczewski (auch bekannt als „General Walter“) sollte dabei im Rahmen der Operation Lausitz die linke südliche Flanke des geplanten Vorstosses etwa auf der Linie Dresden-Bautzen-Niesky sichern.
Die deutschen Einheiten verfügten im Raum Bautzen und Oberlausitz über etwa 50.000 Mann, darunter die „Fallschirm-Panzer-Division 1 Hermann Göring“ (Anmerkung: der Schwesterverband „Fallschirm-Panzergrenadier-Division 2 Hermann Göring“ befand sich entgegen den Angaben in Teilen der Literatur zum fraglichen Zeitpunkt noch nicht im Kampfgebiet), die 20. und 21. Panzer-Division sowie die 17. und 72. Infanterie-Division. Teilweise waren diese Einheiten kampferfahren, aber zum Teil auch mit Rekruten aufgefüllt. Sie verfügten über bis zu 300 Panzer (vorwiegend Pz.Kpfw. IV und wenige Pz.Kpfw. V Panther), etwa 450 gepanzerte Kampffahrzeuge (Sd.Kfz. 234, Sturmgeschütze III und IV, Jagdpanzer IV, Jagdpanzer 38(t) und diverse andere) sowie 600 Artilleriegeschütze.
Die 2. Polnische Armee bestand aus etwa 90.000 Mann und einer grossen Anzahl an von der Sowjetunion gelieferten Panzern (hauptsächlich T-34/85), gepanzerten Fahrzeugen (inklusive Jagdpanzer SU-85, einige Sturmpanzer SU-152) und Geschützen diverser Art. Ein Grossteil der Soldaten hatte nur wenig Kampferfahrung. Zunächst lief die polnische Offensive gegen die deutschen Verteidigungsstellungen in und um Bautzen erfolgreich an. An einigen Stellen konnten die deutschen Verteidigungslinien durchbrochen und die deutschen Truppen voneinander abgeschnitten werden. Bautzen wurde völlig eingekesselt und teilweise besetzt. Besonders auf der Ortenburg verschanzten sich allerdings Angehörige der Wehrmacht, der Hitlerjugend sowie des Volkssturms. Zeitweise waren über 1200 deutsche Soldaten in der Festung Bautzen eingeschlossen.
Text
Ab dem 21. April 1945 begann die letzte grössere und erfolgreiche deutsche Panzeroffensive des Zweiten Weltkrieges auf der Linie Bautzen-Weissenberg, zwischen Spree und Schwarzem Schöps in Richtung Nord-Nordwest und erreichte am 26. April ihren Höhepunkt. Das Panzerkorps „Grossdeutschland“ unter General der Panzertruppe Jauer, bestehend aus der 20. und 21. Panzer-Division unter Generalmajor Hermann von Oppeln-Bronikowski (seit November 1944 Kommandeur der 20. Pz.Div.), konnte infolgedessen mit der 17. und 72. Infanterie-Division trotz weniger modernerer „Panther“-Panzer und später fehlenden Treibstoff-Nachschubs aus den Hydrierwerken (i.v.F. Benzin) die in Bautzen eingeschlossenen Truppenteile befreien. Die 1. Fallschirm-Panzer-Division „Hermann Göring“ griff das teilweise besetzte Bautzen von Südwesten her an und ging gleichzeitig westlich der Stadt entlang der Spree zum Angriff über. Der deutsche Panzerangriff mit Infanterie-Unterstützung kam vor allem östlich der Stadt rasch voran, spaltete die polnische Armee in zwei Gruppen auf und schnitt deren Versorgungswege teilweise ab. Bei Förstgen wurden die Reste der 16. Polnischen Panzerbrigade aufgerieben. Dabei wurde ein Grossteil der polnischen Panzer sowjetischer Bauart (über einhundert) vernichtet. Zahlreiche Fahrzeuge konnten erbeutet werden. Der 1. Fallschirm-Panzer-Division gelang es nördlich von Bautzen, die Reste der 5. Polnischen Infanteriedivision zu zerschlagen und weiter nordöstlich einen Teil der 9. Polnischen Infanteriedivision bei ihrer Absetzbewegung einzukesseln. Der im Kampf verwundete Kommandeur der 5. Polnischen Infanteriedivision, General Aleksander Waszkiewicz, wurde von deutschen Panzertruppen gefangen genommen, nach polnischen Quellen während des Verhörs gefoltert und anschliessend standrechtlich erschossen. Die Führung der 2. Polnischen Armee verlor den Überblick und erteilte mehrmals widersprüchliche Befehle. Den deutschen Einheiten gelang es unterdessen nach mehrtägigen und verlustreichen Häuserkämpfen, ihre Gegner wieder aus Bautzen zu vertreiben. Nur die Tatsache, dass Konew sowjetische Einheiten von seinem Vorstoss nach Westen zurückzog und den polnischen Einheiten zur Unterstützung sandte, verhinderte deren völlige Vernichtung. Aber auch die sowjetischen Truppen, die mit einem entschlossenen Angriff der Wehrmacht durchaus rechneten, erlitten bei den folgenden Kämpfen schwere Verluste. In den folgenden zwei Tagen wurde die 1. Polnische Division von der 1. Fallschirm-Panzer-Division in der Nähe von Königsbrück vernichtet. Verbliebene polnische und sowjetische Soldaten, sofern nicht gefangen genommen oder umgekommen, zogen sich eilig in nordöstlicher Richtung zurück, woraufhin die Kämpfe abebbten und sich die Situation langsam wieder beruhigte.
Nahe Bautzen kam es bis zum 30. April zu vereinzelten Zusammenstössen, in der Zeit bis zum Kriegsende gab es jedoch nur noch wenige einzelne Scharmützel. Im Zuge der Kampfhandlungen kam es auf beiden Seiten zu einer Reihe von Kriegsverbrechen. Am 22. April 1945 wurde im heutigen Bautzener Ortsteil Niederkaina eine Scheune, in der sich etwa 200 Volkssturmleute befanden, von sowjetischen und/oder polnischen Soldaten niedergebrannt. Am gleichen Tag brachten deutsche Truppen in Guttau, nordöstlich von Bautzen, das gesamte Personal sowie alle Verwundeten und Kranken eines polnischen Feldlazaretts um. Bautzen selbst wurde durch die Panzeroffensive zurückerobert und blieb bis Kriegsende in deutscher Hand. Die Stadt wurde erst nach der Gesamtkapitulation der deutschen Streitkräfte vom 8. Mai 1945 an sowjetische und polnische Soldaten übergeben.
Bilanz
Besonders die 2. Polnische Armee erlitt während der Kämpfe bei der „Operation Lausitz“ um Bautzen sehr schwere Verluste. Insgesamt verzeichnete sie – nach offiziellen Angaben – 4.902 Tote, 2.798 Vermisste und 10.532 Verwundete. In einer relativ kurzen Zeit verlor die polnische Armee damit über 22 Prozent ihrer Soldaten und 57 Prozent ihrer Panzer und gepanzerten Fahrzeuge. 27 Prozent der gesamten polnischen Militärverluste in den 20 Monaten vom Oktober 1943 bis zum Mai 1945 sind nach eigenen Angaben auf die Schlacht, um Bautzen zurückzuführen. Ausser dem Warschauer Aufstand vom Herbst 1944 soll es keine einzelne Militäroperation gegeben haben, bei der mehr Polen ums Leben kamen. Die Verluste der sowjetischen und der deutschen Armee waren ebenfalls beträchtlich. Direkt in und um die Stadt Bautzen selbst sind auf beiden Seiten jeweils circa 6.500 Soldaten gefallen und – nach teilweise widersprüchlichen Angaben – etwa 350 deutsche Zivilpersonen getötet worden. Bei den Kampfhandlungen wurden etwa 10 Prozent der Wohnhäuser mit circa 33 Prozent des Wohnungsbestandes der Stadt zerstört. 18 Brücken, 46 Kleinbetriebe, 23 grössere Betriebe und 35 öffentliche Gebäude wurden völlig zerstört. Trotz der starken Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg zeichnet sich Bautzen auch heute noch durch eine besonders reichhaltige historische Bausubstanz aus.
Trotz des militärischen Debakels wurde General Świerczewski nach der Schlacht um Bautzen zum Armeegeneral befördert. Die polnische Propaganda verschwieg auch die unrühmliche Rolle des polnischen Stabes während der Kämpfe. Die Schlacht wurde zwar als äusserst blutig beschrieben, aber niemals als Niederlage für die Polnische Volksarmee bezeichnet. Um Świerczewski wurde der Mythos des unbesiegten Feldherrn aufgebaut. Im heutigen Polen wird er wegen seiner zweifelhaften politischen und militärischen Rolle deutlich kritischer gesehen.
Folgen
Der letzte grössere Erfolg der Wehrmacht hatte keine wesentlichen Auswirkungen auf den Kriegsverlauf und die nahe Kapitulation der deutschen Truppen.
Kesselschlacht von Halbe (25.04.1945 – 28.04.1945)
Die Kesselschlacht von Halbe bezeichnet die Einkesselung deutscher Truppen und folgende Kämpfe mit der Roten Armee gegen Ende des Zweiten Weltkrieges im Gebiet der Ortschaft Halbe, 60 km südlich von Berlin. Nach dieser Schlacht erfolgte der Kampf um Berlin.
Verlauf
Nach dem Zusammenbruch der 9. Armee (zu diesem Zeitpunkt bestehend aus dem CI. Armeekorps, V. SS-Freiwilligen-Gebirgskorps und XI. SS-Panzerkorps) unter dem Oberbefehl von General der Infanterie Theodor Busse im Raum Frankfurt (Oder) und bei Cottbus wurden die kaum noch kampffähigen Reste in einem kleinen Waldgebiet zwischen Märkisch Buchholz und Halbe, südöstlich von Berlin, durch Truppen der Roten Armee eingeschlossen. Entscheidend für die Schliessung des Kessels waren Befehle aus dem Führerhauptquartier, die einen rechtzeitigen Rückzug nicht erlaubten. Dies ermöglichte es der sowjetischen Armee unter Marschall Iwan Konew, den Kessel zu schliessen.
Die letzten gepanzerten deutschen Truppen brachen auf Befehl Busses, der zuvor ein Kapitulationsangebot abgelehnt hatte, unter grossen Verlusten zwischen dem 25. und 28. April 1945 aus dem Kessel aus.
In der Schlacht von Halbe standen sich gegenüber:
- Rote Armee mit 45 Schützendivisionen, 13 Panzer-/mechanisierte Brigaden (etwa 700 Panzer), eine Artilleriedivision (300 Geschütze/Werfer). Darunter waren die 3. und 4. Panzerarmee der 1. Ukrainischen Front der Roten Armee.
- Wehrmacht und Waffen-SS mit 11 Infanteriedivisionen, 2 motorisierten Divisionen, einer Panzerdivision.
Die deutsche Ausbruchsgruppierung führten am 28. April 1945 die Panzergrenadier-Division „Kurmark“ und die schwere SS-Panzer-Abteilung 502 an, unterstützt von Artillerie und Granatwerfern. Der nördliche Stosskeil, der die Abschirmung des Ausbruchs nach Norden zur Aufgabe hatte, wurde dabei von der Panzer-Abteilung der Panzergrenadier-Division „Kurmark“ sowie Resten der SS-Panzeraufklärungs-Abteilung 10 gebildet. Der südliche Stosskeil wurde dabei von der schweren SS-Panzer-Abteilung 502 mit einer Werfer-Batterie, einer Schützenpanzerwagen-Kompanie und dem Grenadier-Regiment der Panzergrenadier-Division „Kurmark“ gebildet. Diesen Einheiten folgten der Divisionsstab der „Kurmark“, der Stab des XI. SS-Panzerkorps, der Stab 9. Armee und Einheiten des V. SS-Gebirgskorps sowie des V. Armeekorps. Die Nachhut der deutschen Ausbruchsgruppierung bildeten Korpseinheiten des XI. SS-Panzerkorps und Reste der Panzerjagd-Abteilung 32.
Verluste und Folgen
Während der Kesselschlacht von Halbe starben 30.000 deutsche Soldaten, dazu geschätzte 10.000 deutsche Zivilisten sowie viele sowjetische Zwangsarbeiter. Die Verluste der Roten Armee betrugen 20.000 Tote. Die sowjetischen Toten sind überwiegend auf dem Sowjetischen Ehrenfriedhof in Baruth/Mark bestattet, die deutschen Toten überwiegend auf dem Waldfriedhof Halbe. Auf dem Waldfriedhof Halbe wurden etwa 22.000 Kriegstote (20.000 Soldaten sowie 2.000 Zivilisten, die zusammen in dem grossen Dreieck Königs Wusterhausen – Beeskow – Lübben in der zweiten Aprilhälfte 1945 zu Tode kamen) begraben.
Etwa 25.000 deutsche Soldaten und etwa 5.000 Zivilpersonen gelangten am 29. April 1945 bei Beelitz (Elsholz) südlich von Potsdam zur deutschen 12. Armee unter dem Oberbefehl von General der Panzertruppe Walther Wenck. Die 12. Armee bestand zu diesem Zeitpunkt einerseits aus Hitlerjungen und Männern des Reichsarbeitsdienstes, andererseits aus fronterfahrenen Soldaten und schweren Waffen, welche aus den Ausbildungsstätten der Wehrmacht herangezogen wurden. Unter den Soldaten der 12. Armee war damals auch der spätere Bundesaussenminister Hans-Dietrich Genscher, der in seinen Memoiren berichtet, dass die ersten Soldaten der deutschen 9. Armee, die ihm entgegenkamen, Stabsoffiziere mit umgehängten Maschinenpistolen waren. Wenck führte die 12. Armee sowie die aus dem Kessel von Halbe entkommenen Soldaten über die Reste der zerstörten Elbbrücke in Tangermünde, ehe sie sich in westliche Gefangenschaft begaben.
Etwa 120.000 deutsche Soldaten gerieten nach der Kesselschlacht von Halbe in sowjetische Gefangenschaft. Der Kommandeur des V. SS-Freiwilligen-Gebirgskorps, SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln, geriet ebenfalls in sowjetische Gefangenschaft, während der Kommandeur des XI. SS-Panzerkorps, SS-Obergruppenführer Matthias Kleinheisterkamp, am 2. Mai 1945 bei Halbe Selbstmord beging.
Befreiung KZ Dachau
Die Befreiung des Konzentrationslagers Dachau gelang alliierten Truppen Ende April 1945. Eintreffende und abmarschierende Häftlingsgruppen frequentierten zu dieser Zeit das Konzentrationslager Dachau und seine Aussenlager. Viele der Aussenlager des KZ Dachau waren zuvor durch die SS geräumt worden. Das Hauptlager befreite die US-Armee am 29. April 1945, dabei kam es – nach dem Anblick der Schrecklichen Zustände – auch zu einer Racheaktion gegen eine 39–50 Personen umfassende Gruppe von noch im Lager befindlichen letzten SS-Soldaten durch die Befreier.
Vorgeschichte
Am 14. April 1945 hatte der Reichsführer SS Heinrich Himmler die „Totalevakuierung“ befohlen, die er später auf Reichsdeutsche, Russen, Polen und Juden eingrenzte. Die Dachauer SS zwang die KZ-Häftlinge, sich zu Fuss auf Evakuierungs- und Todesmärsche zu begeben.
Das Hauptlager Dachau befand sich im Räumungsprozess. Ein Grossteil des ursprünglichen Dachauer KZ-Personals bereitete seine Flucht vor, oder war längst auf der Flucht. Am 23. April verliessen die Arbeitskommandos erstmals nicht mehr das Hauptlager, d. h. sie wurden nun nicht mehr zu Arbeitseinsätzen (z. B. Bombenräumungs-Kommando) eingesetzt.
Befreiung der Aussenlager
Am 26. April rückte sowohl die US-amerikanische als auch die französische Armee ins westlich von Dachau liegende Allgäu ein. Am 27. April nahmen sie das fast leerstehende KZ-Aussenlager Kottern-Weidach ein.
Ebenfalls westlich von Dachau lag das Aussenlager Kaufering. Angehörige der SS-Wachmannschaft zündeten das Lager Kaufering IV am Morgen des 27. April an, obwohl sich nicht mehr gehfähige KZ-Häftlinge darin befanden. Die Alliierten trafen nur wenige Stunden zu spät ein.
Am 27. April traf nachts der Eisenbahnzug mit Häftlingen aus Buchenwald ein, von denen viele verhungert und verdurstet waren. Die Leichen verblieben teilweise in den Waggons. Unter anderem sollte dieser schreckliche Anblick zwei Tage später – beim Eintreffen der US-Armee – zu Schock, Entsetzen und zu amerikanischen Vergeltungsaktionen führen, später auch Dachau-Massaker genannt.
Am darauffolgenden Tag, 28. April zur Mittagszeit, traf der KZ-Häftling Karl Riemer, dem zwei Tage zuvor die Flucht aus dem Lager gelungen war, auf näherrückende US-Truppen. Er schilderte dem US-Befehlshaber die Situation im Lager und bat um sofortige Hilfe. Riemer, der zwölf Jahre im Lager inhaftiert war, konnte nicht wissen, dass der US-Befehl zur Einnahme des Hauptlagers wenige Stunden zuvor erfolgt war.
Befreiung des Hauptlagers Dachau
Es war ein Samstag, 28. April, als Generalmajor Max Ulich die deutsche 212. Volksgrenadier-Division vom Lagergelände abzog. Er wollte unnötige Verluste der Wehrmacht vermeiden. In der Stadt Dachau fand währenddessen der Dachauer Aufstand statt. Die Häftlinge hörten bereits nachts Gefechtslärm in ihren Baracken und Aufregung entstand. Es bildete sich daher das Häftlingskomitee, das sich zur Aufgabe machte, die aufkeimende Erregung im Lager für die kommenden Stunden zu mässigen. Das Häftlingskomitee wollte erreichen, dass die Öffnung des Lagers mit 32.000 Häftlingen einigermassen geregelt ablaufen könne.
Morgens traten Häftlinge auf den Appellplatz und stellten von dort aus fest, dass auf einem SS-Wachturm die weisse Fahne gehisst war. Dennoch hatte die letzte Wachtruppe die Besatzung der acht Wachtürme verstärkt und 16 Maschinengewehre aufs Lager gerichtet, um die Flucht der Häftlinge in umliegende Dörfer sowie Plünderungen und Racheaktionen zu vermeiden. Victor Maurer, Delegierter des Roten Kreuzes, hatte dies befürchtet. Auch hätte sich die grassierende Fleckfieber-Epidemie durch fliehende Häftlinge noch weiter ausgebreitet. SS-Lagerführer Heinrich Wicker, der in den letzten Tagen dieses Amt nur provisorisch übertragen bekommen hatte, kündigte an, seine Truppen aus dem Lager abzuziehen. Maurer, der in einem Gebäude der SS untergebracht war, verhandelte mit Wicker. Letztendlich konnten sie sich einigen, dass die Wachtürme besetzt bleiben sollten. Restliche SS-Wachmannschaften verliessen das Lager.
Am Sonntag, den 29. April 1945, marschierte Colonel Sparks mit dem 3. Bataillon des 157. Infanterie-Regiments der 45. Infanterie-Division der 7. US-Armee und die 42. Infanterie-Division in das Lager ein, von dem sie einige Zeit nicht gewusst hatten, wo es genau liegt. Bei ihnen war die Kriegsberichterstatterin Marguerite Higgins. Zahlreiche „Evakuierungsmärsche“ waren längst aus dem Lager aufgebrochen. In der Nähe der Plantage kreiste ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug. Nur wenige SS-Männer, unter ihnen neu eingezogene Burschen, befanden sich noch im Lager. Die ursprüngliche Lager-SS hatte sich grösstenteils abgesetzt. Die Zurückgebliebenen boten kaum Widerstand und ergaben sich. Im Tumult und Jubel der Befreiung kam es auch vereinzelt zu tragischen Todesfällen, als Häftlinge die Lagerabzäunung überklettern wollten, die zunächst noch unter Strom stand.
Die US-Truppen kamen von Westen, jedoch der einzige Zugang zum Häftlingsbereich, das sogenannte Jourhaus, lag östlich. Die US-Truppen marschierten über den Lagerbereich der SS. Dort trafen sie ohne jede Vorwarnung oder Ahnung auf den Eisenbahnzug mit unzähligen erschossenen und verhungerten Häftlingen (etwa 2.300 Tote). Den ersten Eindruck dieses Eisenbahnzuges beschrieben einige US-Soldaten später als extrem schockierend und verstörend. Voller Entsetzen und Wut über die schrecklichen Zustände kam bei US-Soldaten die Flüsterparole „Hier machen wir keine Gefangenen!“ auf. Aufgrund der schrecklichen Zustände im Lager kam es seitens US-Soldaten und ehemaligen Häftlingen zu Übergriffen und zur Ermordung von SS-Männern. Das Kriegsverbrechen wurde später als Dachau-Massaker bezeichnet.
Zeitzeugen berichten, dass die Befreiung ein ergreifendes Ereignis war. In den darauffolgenden Tagen veranstalteten jene Häftlinge, die körperlich nicht vollends geschwächt waren, schlichte Feierlichkeiten und Zusammenkünfte mit Musik.
Befreiung restlicher Aussenlager
Am 29. April konnten die Aussenlager in der Nähe Landsberg-Kaufering befreit werden. An diesem Aussenlagerkomplex wurde nach Kriegsende die Europäische Holocaustgedenkstätte errichtet.
Nach der Befreiung des KZ Dachau marschierten US-Truppen am 30. April in München ein, wo zuvor die Freiheitsaktion Bayern stattgefunden hatte. Der Tag, an dem die Truppen die Hauptstadt der Bewegung einnahmen, war auch der Tag, an dem Adolf Hitler in Berlin Suizid begangen hatte, was jedoch nicht umgehend bekannt wurde.
In der Münchner Umgebung trafen sie an diesem Tag auf weitere Häftlingstransporte, beispielsweise auf einen Zug aus dem Aussenkommando Mühldorf, in dem sich auch Max Mannheimer befand.
Am 30. April stoppten die Alliierten einen Eisenbahnzug, der am 25. April mit 3.000 Häftlingen gestartet war, von Emmering über München, Wolfratshausen und Kochel am See nach Seeshaupt am Starnberger See. Der Evakuierungstransport vom 26. April über Emmering–München–Wolfratshausen–Penzberg–Staltach mit 1.759 Juden konnte ebenfalls am 30. April befreit werden. Ebenso der Marsch mit etwa 7.000 Häftlingen, der am 26. April begonnen hatte und über Pasing, Wolfratshausen und Bad Tölz zum Tegernsee führte.
Die Befreiung der Mühldorfer Lager, die östlich von München lagen, vollzogen die Siegermächte am 1. und 2. Mai. Ein Evakuierungstransport war mit der Reichsbahn über Emmering–München–Wolfratshausen–Mittenwald nach Seefeld in Tirol unterwegs. Diese 2.000 Häftlinge waren am 4. Mai frei.
Während Hitlers Berghof, der mehr als 100 km südlich von Dachau lag, bereits am 4. Mai eingenommen wurde, kamen andere US-Truppen am 5. Mai ins Sudelfeld, wo sich das Aussenlager SS-Berghaus Sudelfeld und das Aussenlager Sudelfeld – Luftwaffe befand.

Am 8. Mai, dem V-E-Day, trat die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht in Kraft.
Heute
Jährlich findet gegen Ende April ein Gedenktag statt, mit dem die heutige Gedenkstätte an die Jahre im Lager und die Tage der Befreiung erinnern will. Zum 65. Jahrestag der Befreiung fand in der KZ-Gedenkstätte Dachau eine Gedenkfeier statt, an der erstmals ein amtierender Bundespräsident (Horst Köhler) teilnahm.
Das Dachau-Massaker
Als Dachau-Massaker wird ein Kriegsverbrechen bezeichnet, das zum Ende des Zweiten Weltkriegs bei der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau am 29. April 1945 durch US-Soldaten an Angehörigen der SS verübt wurde. Der Hintergrund dazu ist, dass die erobernde alliierte US-Armee kurz vor der Befreiung des KZ Dachau auf den Todeszug aus Buchenwald traf, mit Tausenden darin vorgefundenen Leichen, was heftige Empörung unter den Soldaten und Offizieren auslöste.
Kritiker des Begriffes weisen darauf hin, dass in deutschen rechtsextremen Kreisen oft der Eindruck erweckt wird, es hätte sich um eine systematische Exekution sämtlicher deutscher Kriegsgefangenen gehandelt. Diese Auffassung stützt sich auf ein Buch des ehemaligen amerikanischen Militärarztes Col. Howard A. Buechner, in dem die Hinrichtung von 560 Personen des SS-Wachpersonals behauptet wird. Es ist jedoch nicht erkenntlich, dass diese Zahl wissenschaftlich belegt wäre. Unabhängige Quellen kommen dagegen übereinstimmend zu dem Schluss, dass es sich um voneinander unabhängige, spontane Racheakte handelte. Bei diesen wurden 39 (gesichert) bis vermutlich 50 Angehörige des Wachpersonals der SS völkerrechtswidrig erschossen.
Tod von Adolf Hitler (30.04.1945)

„Der Chef brennt! Willst du mal gucken?“
Am 30. April 1945 zwischen 15.15 und 15.50 Uhr entzog sich Hitler seiner Verantwortung durch Suizid. Seine Frau Eva Braun nahm er mit sich. Sein letzter Gedanke galt einmal mehr ihm selbst.
Am siebten Tag der Woche soll man ruhen. Doch in Berlin dachte am 29. April 1945 wirklich niemand daran, die Sonntagsruhe einzuhalten. Noch immer donnerte es in den Straßen, schoss sowjetische Artillerie letzte Widerstandsnester der Wehrmacht und der Waffen-SS zusammen.
Bis auf ein paar Viertel in den Bezirken Mitte, Prenzlauer Berg und Charlottenburg war die Reichshauptstadt von der Roten Armee erobert. In den schon seit knapp einer Woche besetzten Vororten machten sich einige wenige Menschen auf zu Gottesdiensten, die mutige Pfarrer anboten – doch in den meisten Kirchen fanden sich noch keine Gläubigen ein.
Irgendwann an diesem Tag erreichte eine letzte, wichtige Meldung den Führerbunker im Garten der Reichskanzlei. Hitlers früheres Vorbild und späterer Partner Benito Mussolini, der sich ab 1938 zum Klotz am Bein entwickelt hatte, war auf der Flucht in Norditalien von Partisanen aufgegriffen worden. In einem Dorf bei Como wurde er erschossen und an einer Tankstelle in Mailand an den Füßen aufgehängt.
Darauf reagierte der Führer in inzwischen gewohnter Art: Er kündigte seinen Selbstmord an: „Ich will dem Feind weder tot noch lebendig in die Hand fallen. Nach meinem Ende soll mein Körper verbrannt werden und so für immer unentdeckt bleiben“. Doch diesmal meinte er es ernst, anders als etwa 1923 nach seinem gescheiterten Putsch oder 1932, als das Auseinanderbrechen der NSDAP bevorzustehen schien.
Am späten Nachmittag des 29. April 1945 begannen tatsächlich die letzten Vorbereitungen im Bunker. Zuerst diktierte Hitler einer der beiden verbliebenen Sekretärinnen ein politisches und ein privates Testament. Traudl Junge erinnerte sich an ihre Gefühle unmittelbar vor dem Diktat: „Jetzt kommt endlich das, worauf wir seit Tagen warten: die Erklärung für das, was geschah, ein Bekenntnis, ein Schuldbekenntnis sogar, vielleicht eine Rechtfertigung“. In diesem letzten Dokument des Dritten Reiches musste doch die Wahrheit stehen, bekannt von einem Menschen, der nichts mehr zu verlieren hatte.
Aber die Erwartung der Sekretärin wurde enttäuscht: „Teilnahmslos, fast mechanisch spricht der Führer Erklärungen, Anklagen und Forderungen aus, die ich, die das deutsche Volk und die ganze Welt kennen“. Tatsächlich enthielten die beiden Testamente wenig mehr als eine Zusammenfassung all seines Hasses, seiner von der Wirklichkeit komplett gelösten Weltanschauung.
Hitler im Urteil der Historiker
Vor seinem Tod legalisierte Hitler noch seine Beziehung zu Eva Braun. Allerdings tat er das wohl nicht aus eigenem Antrieb: „Diese Todeshochzeit ist auf ihr Drängen, auf ihre Bemühungen zurückgegangen. Hitler war ja gar nicht mehr in der Lage dazu“, erinnerte sich ein langjähriger Hausangestellter der Alpenresidenz Berghof. Er kannte Eva Braun sehr gut: „Sie wollte das haben“.
An diesem Sonntagabend gegen 23.00 Uhr schickte Hitler einen letzten Funkspruch an die Wehrmachtsführung im längst eingekesselten Hauptquartier südlich Berlins. Noch einmal erkundigte er sich, wann die Entsatztruppen kämen. Knapp vier Stunden später antwortete Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, dass mit einer Besserung der Situation nicht mehr zu rechnen sei.
Inzwischen standen die Angriffsspitzen der Roten Armee nur noch knapp hundert Meter südlich der Reichskanzlei. Zwischen Leipziger und Vossstrasse wurde bereits Mann gegen Mann gekämpft. SS-Brigadeführer Wilhelm Mohnke, der Kampfkommandant der Reichskanzlei, teilte Hitler mit, dass man die Stellung noch einen, höchstens zwei Tage halten könnte.
Daraufhin legte der „Führer und Reichskanzler“ als Zeitpunkt seines Todes den 30. April 1945 um 15 Uhr fest. Als letzte Befehle gab er Mohnke und dem Befehlshaber in Berlin, General Helmuth Weidling, die Erlaubnis, in aussichtsloser Lage auszubrechen. Von Kapitulation wollte der Diktator noch immer nichts wissen. Das letzte Kapitel war nun beinahe zu Ende.
Ungefähr zu dieser Zeit zogen sich Eva Braun und Adolf Hitler in das winzige Wohnzimmer der Bunkerwohnung zurück und schlossen die Stahltüren. Zuvor hatte der Diktator sich noch von seiner engsten Umgebung verabschiedet und seinem persönlichen Diener Anweisungen über den Umgang mit seiner Leiche gemacht. Am Ende seines Krieges, der 50 Millionen Menschen das Leben gekostet hatte, war Adolf Hitlers größte Sorge, sein Leichnam könnte in die Hände der Roten Armee fallen und wie in einem Panoptikum ausgestellt werden.
Seine engsten Mitarbeiter führten den letzten Befehl ihres Chefs genau aus: Sie blockierten für die entscheidenden Minuten die Tür zum Wohnzimmerchen im Bunker. Nach einiger Zeit schnupperten sie nach Pulvergeruch. Durch die massiven Wände und geschlossenen Stahltüren waren beim permanenten Geräuschpegel im Bunker durch den Artilleriebeschuss und die laufende Dieselmaschine ein einzelner Pistolenschuss nicht zu hören.
Kurz vor 16 Uhr betraten Kammerdiener Heinz Linge und der persönliche SS-Adjutant Otto Günsche den Sterberaum des deutschen Diktators. Sie fanden beide Leichen in der Sitzgruppe vor, erinnerten sich später aber immer wieder unterschiedlich, wie sie gesessen hatten.
Linge und Günsche nahmen die Leichen, trugen sie durch den Gartenausgang aus dem Führerbunker und legten sie in eine Grube – entweder in einen Granattrichter oder einen nicht mehr geschlossenen Kanalgraben. Die Körper wurden mit viel Benzin überschüttet und dann angesteckt. Ein SS-Wachmann schaute zu und rannte in den Bunker hinab. „Der Chef brennt!“, rief er und fragte seinen Kameraden Rochus Misch, den Telefonisten des Führerbegleitkommandos: „Willst du mal gucken?“
Wie genau waren Adolf und Eva Hitler gestorben? Darüber gibt es Dutzende unterschiedlicher Darstellungen. Nahezu alle Menschen aus der Umgebung des Führers, die das Jahr 1945 lebend überstanden, äußerten sich später mehrfach dazu und oft widersprüchlich.
Erschossen sie sich beide? Nahmen beide Gift? Erschoss sich Hitler, entweder in den Mund oder in die rechte Schläfe, während Eva Braun sich vergiftete? Ging der Führer gar auf Nummer sicher: mit Zyankali und einem Kopfschuss? Da es keinerlei Untersuchung zwischen Tod und Einäscherung gab, lassen sich diese Fragen nicht beantworten. Sie sind auch nicht wichtig, denn entscheidend ist allein: Adolf Hitler starb am 30. April 1945 zwischen 15.15 und 15.50 Uhr.
Tod von Joseph Goebbels
Anne Frank war ein Kind. Maria Rolnikaite, die im Warschauer Getto eingekerkert war und nicht weniger erschütternde Notizen hinterließ, war ebenfalls erst vierzehn Jahre alt. Auch unter den Opfern von Babij Jar, unter den Opfern von Lidice gab es viele Kinder. Und wie viele sind in Dresden umgekommen?
Diese paar Hinweise mögen einen Maßstab setzen, wenn wir uns nun dem Mord an den sechs Kindern der Familie Goebbels zuwenden. Gewiß, sechs sind nicht sechshunderttausend. Aber Mord bleibt Mord. Und sogar jene Historiker, die sich mit dem Leben des ehemaligen Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda voreingenommen auseinandersetzen, wagen nicht zu behaupten, dass Helga (geb. am 1. 9. 1932), Hilde (13. 4. 1934), Helmut (2. 10. 1935), Holde (19. 2. 1937), Hedda (5. 5. 1938) und Heide (29. 10. 1940) freiwillig in den Tod gegangen seien.
Im Durcheinander der Ereignisse um den 1. Mai 1945 wurde das Schicksal dieser Kinder kaum beachtet. Aber am Beispiel der Familie Goebbels wird erschreckend deutlich, in welche Abgründe eine „Greuelpropaganda“ sogar ihre Urheber führen kann. Glaubten Goebbels und seine Frau etwa im Ernst, daß die Alliierten ihren Zorn an den sechs Kindern auslassen könnten? Die Nachkriegszeit hat solche Vermutungen widerlegt. Den Kindern von Bormann, Himmler und vielen anderen Bonzen des Dritten Reiches ist kein Haar gekrümmt worden.
Schwerlich läßt sich alles mit dem Fanatismus erklären, der vor nichts zurückschreckt. Aber ein Regime, das den Mord als Mittel der Selbstbehauptung gutheißt, muß auf die Dauer Schaden an seiner eigenen Seele nehmen. Wer andere nicht als Menschen respektiert, hört früher oder später selbst auf, ein Mensch zu sein.
Wie wurden die Kinder von Goebbels ermordet? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Einige, zum Beispiel Gobbels’ einstiger Staatssekretär Werner Naumann, behaupten, Magda Goebbels selbst habe Hand angelegt. Eine andere Version besagt, die Mutter habe sich draußen aufgehalten, als die Ärzte ihren Kindern das Gift einflößten. Und wieder andere meinen, man werde den genauen Ablauf des Geschehens nie erfahren.
Ich möchte nicht behaupten, daß die folgenden Dokumente ein volles Licht auf die Vorgänge werfen. Aber sie haben einen Vorzug: sie wurden unmittelbar nach den Ereignissen abgefaßt. Der Leser wird bemerken, daß Tatzeuge Dr. Helmut Kunz nicht gleich die ganze Wahrheit gesagt hat. Aber die sowjetischen Untersuchungsrichter unterzogen ihn nochmals einem sehr sorgfältigen Kreuzverhör.
Vernehmungsprotokoll
Den 7. Mai 1945. Der Chef der 4. Abteilung der Abwehrverwaltung „Smersch“ der 1. Weißrussischen Front, Oberstleutnant Wassiljew, hat den Kriegsgefangenen der deutschen Wehrmacht, Helmut Kunz, vernommen, wobei Untersuchungsrichter Oberleutnant Wlassow die Übersetzung ins Deutsche und aus dem Deutschen besorgte.
Zur Person: Kunz, Helmut Gustavowitsch, geb. 1910 in Ettlingen/Baden, Zahnarzt, zuletzt als Adjutant des Chefarztes in der Sanitätsverwaltung der SS in der Reichskanzlei. Am 21. 4. 45 wurde seine Sanitätsabteilung aufgelöst, und er wurde von einem Lazarett übernommen. Als das Lazarett am 23. April aus Berlin wegzog, wurde er zur Reichskanzlei abkommandiert. Um diese Zeit gab es dort keinen Zahnarzt.
Frage: Hatten Sie bis zum 23. April d. J. irgend etwas mit der Reichskanzlei zu tun?
Antwort: Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich nichts mit der Reichskanzlei zu tun.
Frage: Was ist Ihr Dienstgrad?
Antwort: SS-Sturmbannführer.
Frage: Wen haben Sie während Ihrer Tätigkeit in der Reichskanzlei persönlich betreut?
Antwort: Ich betreute Frau Goebbels persönlich und behandelte später auch die Soldaten, die der Reichskanzlei zugeteilt waren.
Frage: Wie lange kennen Sie Goebbels und seine Familie?
Antwort: Goebbels habe ich am 1. Mai d. J. durch die Vermittlung seiner Frau kennengelernt. Bis dahin kannte ich ihn nur aus seinen Reden bei den Kundgebungen.
Frage: Wie ist es denn gekommen, daß Sie, ohne vorher Zugang zur Reichskanzlei gehabt zu haben, am 1. Mai d. J. mit Goebbels bekannt gemacht wurden und sofort ohne weiteres seine Wohnung betreten durften?
Antwort: Wahrscheinlich, weil ich Frau Goebbels behandelt hatte.
Frage: Waren Sie in der Wohnung von Goebbels?
Antwort: Ich war im Bunker, in der Reichskanzlei, wo auch seine Familie wohnte – seine Frau und seine Kinder.
Frage: Welche körperlichen Fehler an Goebbels, seiner Frau und seinen Kindern kennen Sie?
Antwort: Seine Frau und Kinder waren völlig normal, und Goebbels hinkte mit dem rechten Fuß.
Frage: Erzählen Sie etwas eingehender, was mit Goebbels und seiner Familie passiert ist.
Antwort: Am 27. April d. J. traf ich vor dem Abendessen Frau Goebbels zwischen acht und neun Uhr im Korridor am Eingang zu Hitlers Bunker. Sie sagte mir, daß sie mich in einer sehr wichtigen Angelegenheit sprechen möchte, und fügte gleich hinzu, die Situation sei jetzt so, daß wir wahrscheinlich sterben müßten. Deshalb bat sie mich, ihre Kinder töten zu helfen. Ich gab mein Einverständnis.
Nach diesem Gespräch führte mich Frau Goebbels in das Kinderschlafzimmer und zeigte mir all ihre Kinder. Die Kinder machten gerade Anstalten, zu Bett zu gehen, und ich sprach mit keinem von ihnen.
In dem Augenblick, als die Kinder zu Bett gingen, kam Goebbels herein, wünschte den Kindern eine gute Nacht und verschwand wieder.
Ich hielt mich etwa 10 bis 15 Minuten im Zimmer auf, dann wurde ich von Frau Goebbels verabschiedet, und ich ging zurück zu meinen Praxisräumen, die in einem der Bunker lagen, ungefähr 500 Meter von dem Bunker entfernt, wo sich Hitler, Goebbels und die anderen Personen des Führerhauptquartiers aufhielten.
Am 1. Mai d. J. gegen 4 bis 5 Uhr nachmittags wurde ich in der Praxis von Frau Goebbels angerufen; sie sagte, es sei schon viel Zeit verstrichen und bat mich, sofort zu ihrem Bunker zu kommen. Dann ging ich zu ihr, nahm aber keine Medikamente mit. Als ich Goebbels’ Wohnräume betrat, sah ich ihn selbst, seine Frau und den Staatssekretär des Propagandaministeriums, Naumann, im Arbeitszimmer, wo sie sich über irgend etwas unterhielten.
Ich wartete etwa zehn Minuten vor der Tür des Arbeitszimmers, bis Goebbels und Naumann weggingen. Dann bat mich Frau Goebbels hinein und teilte mir mit, die Entscheidung sei nun gefallen (sie meinte den Entschluß zur Tötung der Kinder), denn der Führer sei schon gestorben, und die Truppen würden ungefähr um 8 bis 9 Uhr einen Durchbruch versuchen. Deshalb müßten wir sterben, wir hätten keinen anderen Ausweg. Etwa nach 20 Minuten, als wir noch miteinander sprachen, kam Goebbels in sein Arbeitszimmer zurück und wandte, sich an mich mit den Worten: „Doktor, ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie meiner Frau helfen würden, die Kinder einzuschläfern“.
Ebenso wie seiner Frau bot ich auch Goebbels an, die Kinder im Lazarett unterzubringen und unter den Schutz des Roten Kreuzes zu stellen. Er erwiderte aber: „Das geht nicht; es sind doch die Kinder von Goebbels!“
Danach ging Goebbels, und ich blieb bei seiner Frau, die sich etwa eine Stunde lang mit Kartenlegen beschäftigte.
Nach etwa einer Stunde kam Goebbels wieder zu uns, zusammen mit dem stellvertretenden Gauleiter von Berlin, Schach. Wie ich aus ihrer Unterhaltung entnehmen konnte, sollte Schach mit den Soldaten auszubrechen versuchen. Er nahm jetzt von Goebbels Abschied. Goebbels schenkte ihm eine Brille mit einer dunklen Hornfassung und sagte: „Nehmen Sie das als Andenken, diese Brille hat immer der Führer getragen“. Dann verabschiedete sich Schach von Frau Goebbels und von mir und ging.
Als Schach gegangen war, sagte Frau Goebbels: „Unsere Truppen ziehen nun weg, die Russen können jede Minute hier sein und uns stören. Deshalb müssen wir uns beeilen“.
Als wir, d. h. ich und Frau Goebbels, das Arbeitszimmer verließen, saßen zwei mir unbekannte Personen in Uniform im Vorzimmer, einer von ihnen hatte die Hitlerjugenduniform an; wie der andere gekleidet war, kann ich mich nicht mehr erinnern. Goebbels und seine Frau verabschiedeten sich von den beiden, wobei diese Unbekannten fragten: „Und wie haben Sie sich entschieden, Herr Minister?“ Goebbels erwiderte nichts, und seine Frau erklärte: „Der Gauleiter von Berlin und seine Familie bleiben in Berlin und werden hier sterben“.
Nach dem Abschied von den genannten Personen kam Goebbels in sein Arbeitszimmer zurück, und ich ging mit seiner Frau zu ihrer Bunkerwohnung. Im Vorzimmer nahm Frau Goebbels eine mit Morphium gefüllte Spritze aus dem Schrank und gab sie mir. Dann betraten wir das Kinderzimmer, die Kinder lagen schon im Bett, schliefen aber noch nicht.
Frau Goebbels sagte zu den Kindern: „Kinder, habt keine Angst, der Doktor gibt euch jetzt eine Spritze, die jetzt alle Kinder und Soldaten bekommen“. Mit diesen Worten verließ sie das Zimmer. Ich blieb dort allein und spritzte das Morphium ein – zunächst den beiden älteren Mädchen, dann dem Jungen und den übrigen Mädchen.
Ich spritzte am Unterarm unter dem Ellenbogen je 0,5 cm hoch 3 ein, um die Kinder schläfrig zu machen. Das Spritzen dauerte ungefähr 8 bis 10 Minuten, dann ging ich wieder ins Vorzimmer, wo ich Frau Goebbels antraf. Ich sagte zu ihr, man müsse etwa 10 Minuten warten, bis die Kinder eingeschlafen seien. Gleichzeitig sah ich auf die Uhr. Es war 20 Uhr 40 (am 1. Mai). Nach 10 Minuten ging Frau Goebbels in meiner Begleitung ins Kinderzimmer hinein, wo sie sich etwa fünf Minuten aufhielt und jedem Kind eine zerdrückte Ampulle mit Zyankali in den Mund legte. (jede Glasampulle enthielt 1,5 cm hoch 3 Zyankali.) Als wir in das Vorzimmer zurückkamen, sagte sie: „Jetzt ist Schluß mit allem“.
Dann ging ich mit ihr zum Arbeitszimmer von Goebbels hinunter, wo wir ihn in einem sehr nervösen Zustand, im Zimmer auf- und abgehend, antrafen. Beim Betreten des Arbeitszimmers sagte Frau Goebbels: „Mit den Kinder ist es vorbei, jetzt müssen wir an uns selber denken“. Goebbels erwiderte: „Wir müssen uns beeilen, denn wir haben sehr wenig Zeit“. Dann sagte Frau Goebbels: „Hier im Bunker wollen wir nicht sterben“, und Goebbels fügte hinzu: „Es ist klar, wir gehen in den Garten hinaus“. Seine Frau erwiderte: „Nicht in den Garten, sondern zum Wilhelmsplatz, wo du dein ganzes Leben lang gearbeitet hast“. (Der Wilhelmsplatz liegt zwischen dem Gebäude des Reichspropagandaministeriums und der Reichskanzlei.)
Im Laufe des Gesprächs dankte mir Goebbels dafür, daß ich ihr Schicksal erleichtert habe, dann verabschiedete er sich von mir, wünschte mir Erfolg im Leben und glückliches Heimkommen. Danach begab ich mich zu meiner Praxis (es war ungefähr 15 oder 20 Minuten nach 10 Uhr abends).
Frage: Wo konnte Frau Goebbels Giftstoffe (Zyankali) bekommen?
Antwort: Frau Goebbels selbst teilte mir mit, daß sie das Morphium und die Spritze von Stumpfegger, dem zweiten Arzt Hitlers bekommen habe. Woher sie die Ampullen mit Zyankali hatte, weiß ich nicht…
Frage: Haben Sie allein an der Tötung der Kinder von Goebbels teilgenommen?
Antwort: Ja, ich war allein.
Kunz wurde bald noch einmal vernommen. Hier sind die Auszüge aus dem Protokoll, das Untersuchungsrichter Wlassow am 19. Mai aufgenommen hat:
Frage: … die Untersuchungsrichter haben Angaben vorliegen, daß Ihnen Dr. Stumpfegger bei der Tötung der Kinder von Goebbels geholfen hat. Können Sie das bestätigen?
Antwort: Ja, ich gebe zu, daß ich während der Untersuchung falsche Aussagen über die Umstände der Tötung der Kinder von Goebbels gemacht habe. Es ist wahr, daß Dr. Stumpfegger mir dabei geholfen hat. Die genauen Umstände der Tötung der Kinder von Goebbels waren so:
Nachdem ich allen Kindern Morphium eingespritzt hatte, ging ich aus dem Kinderschlafzimmer in den benachbarten Raum hinaus und wartete dort zusammen mit Frau Goebbels ab, bis die Kinder eingeschlafen waren. Sie bat mich, ihr in helfen, den Kindern das Gift zu geben. Das lehnte ich ab und sagte, daß ich dazu nicht genug seelische Kraft hätte. Dann forderte mich Frau Goebbels auf, Dr. Stumpfegger, den ersten Begleitarzt von Hitler, zu holen. Nach drei bis vier Minuten fand ich Stumpfegger, der im Bunker Hitlers im Speisezimmer saß, und sagte zu ihm: „Doktor, Frau Goebbels bittet Sie, zu ihr zu kommen“. Als ich mit Stumpfegger in den Vorraum zum Kinderschlafzimmer kam, wo ich Frau Goebbels zurückgelassen hatte, war sie nicht mehr dort, und Stumpfegger ging gleich in das Schlafzimmer. Ich aber wartete im Nebenzimmer. Nach vier bis fünf Minuten kam Stumpfegger mit Frau Goebbels aus dem Kinderzimmer heraus, er ging gleich weg, ohne mir auch nur ein Wort zu sagen. Frau Goebbels sagte auch nichts und weinte nur.
Ich stieg mit ihr zum unteren Bunkergeschoß hinunter und kam zum Arbeitszimmer von Goebbels, wo ich mich von den beiden verabschiedete und dann zu meiner Praxis ging.
Frage: Warum haben Sie sich bei vorherigen Verhören über die Beteiligung Dr. Stumpfeggers an der Tötung der Kinder von Goebbels ausgeschwiegen?
Antwort: Die Ereignisse in den letzten Tagen vor der Kapitulation der deutschen Truppen in Berlin haben mich sehr mitgenommen, und ich habe diesen Umstand einfach ohne jede Absicht aus dem Blick verloren.
Soweit die Aussage von Dr. Kunz. Da Stumpfegger umgekommen sein soll, ist es schwer, diese Angaben zu prüfen. Das Ergebnis aber ist bekannt. Dr. Schkarawskij hat es in den Protokollen Nr. 1–2 und 8–11 über die Untersuchung der Kinderleichen festgehalten. Die Akten, die am 7. und 8. Mai 1945 in Buch abgefaßt wurden, ähneln sich, so daß es hier genügt, das Resümee der „Akte Nr. 1 über die gerichtsmedizinische Untersuchung der Leiche eines unbekannten Mädchens“ wiederzugeben. (Es handelt sich um die 12jährige Helga Goebbels.)
Schlußfolgerung:
Auf Grund der gerichtsmedizinischen Obduktion der Leiche eines etwa 15jährigen Mädchens (1) und der gerichtsmedizinischen Untersuchung seiner inneren Organe kommt die Kommission zu folgenden Schlüssen:
- Bei der Obduktion wurden keine Verletzungen oder krankhaften Veränderungen festgestellt, die den Tod der Verstorbenen verursacht haben könnten.
- Im Mund wurden Splitter einer zerdrückten Glasampulle gefunden; bei der Sektion der Leiche spürte man einen ausgeprägten bitteren Mandelgeruch, und bei der chemischen Untersuchung der inneren Organe wurde darin das Vorhandensein von Zyanverbindungen festgestellt.
Deshalb muß die Schlußfolgerung gezogen werden, daß der Tod des etwa 15jährigen Mädchens infolge Vergiftung durch eine Zyanverbindung eingetreten ist.
Protokoll über die Entdeckung der Familie Goebbels (Auszug)
Berlin, 3. Mai 1954
Am 2. Mai 1945 wurden im Zentrum von Berlin im Gelände des Bunkers der deutschen Reichskanzlei einige Meter von der Eingangstür entfernt von Oberstleutnant Klimenko und den Majoren Bystrow und Chasin in Anwesenheit von Berliner Einwohnern – den Deutschen Lange, Wilhelm, Koch der Reichskanzlei, und Schneider, Karl, Garagenmeister der Reichskanzlei – um 17.00 einer die angekohlten Leiche eines Mannes und einer Frau entdeckt; die Leiche des rechten war von niedrigem Wuchs, der Fuß des rechten Beines steckte in halbgekrümmter Stellung (Klumpfuß) in einer angekohlten Metallprothese; darauf lagen die Überreste einer verkohlten Parteiuniform der NSDAP und ein angesengtes Goldenes Parteiabzeichen; bei der Leiche der Frau wurde ein angesengtes goldenes Zigarettenetui entdeckt, auf der Leiche ein Goldenes Parteiabzeichen der NSDAP und eine angesengte goldene Brosche.
Zu Häupten der beiden Leichen lagen zwei Walther-Pistolen Nr. 1 (durch Feuer beschädigt).
Am 3. Mai d. J. wurden vom Zugführer der Abwehrabteilung „Smersch“ der 207. Schützendivision, Oberleutnant Iljin, im Bunker der Reichskanzlei in einem separaten Zimmer auf Betten liegend Kinderleichen im Alter von drei bis vierzehn Jahren aufgefunden. Sie waren mit leichten Nachthemden bekleidet und zeigten Vergiftungserscheinungen …
Zur Identifikation der Leichen an Ort und Stelle wurden die Kriegsgefangenen – der persönliche Vertreter von Großadmiral Dönitz im Führerhauptquartier, Vizeadmiral Voß, Hans-Erich, geb. 1897, der Garagenmeister der Reichskanzlei, Schneider, Karl Friedrich Wilhelm und der Koch der Reichskanzlei, Lange, Wilhelm – hinzugezogen, die Goebbels, dessen Ehefrau und Kinder persönlich gut gekannt haben.
Vizeadmiral Voß, Lange und Schneider identifizierten eindeutig die Leichen – beim Verhör und bei der Vorführung der Leichen – als Goebbels, dessen Ehefrau und Kinder… Am 1. Mai d. J. sah Voß Goebbels zum letztenmal um 20.30 Uhr im Luftschutzbunker, wo Hitlers Hauptquartier untergebracht war. Dabei erklärte Goebbels im Gespräch mit Voß, daß er dem Beispiel Hitlers folgen, d. h. seinem Leben durch Selbstmord ein Ende setzen werde.
Voß erkannte in der angekohlten weiblichen Leiche die Ehefrau Goebbels’ und begründete seine Aussage mit den Angaben, daß die Frauenleiche dem Wuchs nach (etwas über mittelgroß) und wegen des Goldenen Parteiabzeichens der NSDAP die Leiche der Ehefrau Goebbels’ sei. (Sie war die einzige deutsche Frau, die dieses Abzeichen trug; es war ihr von Hitler drei Tage vor seinem Selbstmord überreicht worden.)
Außerdem entdeckte man bei der Untersuchung des bei der Frauenleiche aufgefundenen Zigarettenetuis auf der Innenseite eines der Deckel das Monogramm „Adolf Hitler – 29. X. 34“ in deutscher Sprache; das Etui sei, wie Voß erklärte, in den letzten drei Wochen von der Ehefrau Goebbels’ benützt worden.
Bei der Besichtigung der Kinderleichen identifizierte Voß alle ausnahmslos als die Kinder von Goebbels, da er sie mehrmals gesehen hatte; eines der Mädchen, die etwa dreijährige Goebbels-Tochter Heide, sei zu wiederholten Malen in der Wohnung von Voß gewesen …
1) Die Sachverständigen schätzten das Alter nach dem Aussehen. Eine Verrechnung um ein bis zwei Jahre ist in solchen Fällen zulässig.
Schlacht um Schloss Itter (05.05.1945)
Die Schlacht um Schloss Itter wurde am 5. Mai 1945 um das Schloss im Tiroler Dorf Itter in Österreich ausgetragen. Es war die einzige Schlacht des Zweiten Weltkrieges, bei der Soldaten der United States Army und der Wehrmacht gemeinsam kämpften, und zwar mit befreiten prominenten französischen Kriegsgefangenen gegen Einheiten der 17. SS-Panzergrenadier-Division „Götz von Berlichingen“.
Vorgeschichte
Schloss Itter wurde Ende 1940 offiziell durch die deutsche Regierung vom Besitzer Franz Grüner gepachtet und am 7. Februar 1943 von SS-Generalleutnant Oswald Pohl auf Befehl Heinrich Himmlers in Besitz genommen. Am 25. April 1943 wurde das Schloss als Aussenlager des Konzentrationslagers Dachau eröffnet, um hier für das Deutsche Reich wichtige, in der Mehrzahl französische Kriegsgefangene unterzubringen. Gefangen gehalten wurden hier unter anderem der Tennisspieler Jean Borotra, die ehemaligen Premierminister Édouard Daladier und Paul Reynaud, die ehemaligen Hauptbefehlshaber Maxime Weygand und Maurice Gamelin, Charles de Gaulles ältere Schwester Marie-Agnès Cailliau, das Mitglied der Résistance François de La Rocque sowie der Gewerkschaftsführer Léon Jouhaux. Daneben befanden sich hier einige Gefangene aus osteuropäischen Ländern, die überwiegend für Unterhaltsarbeiten eingesetzt wurden.
Die Schlacht
Der letzte Kommandeur des Konzentrationslagers Dachau, Eduard Weiter, beging am 2. Mai 1945 nach seiner Flucht von Schloss Itter Selbstmord. Am 3. Mai 1945 verliess Zvonimir Čučković, ein Mitglied des jugoslawischen kommunistischen Widerstands, der im Schloss als Gehilfe arbeiten musste, das Gebäude unter dem Vorwand, für den Kommandeur des Schlosses, SS-Sturmbannführer Sebastian Wimmer, Hilfe zu holen. Er hatte einen Brief in englischer Sprache bei sich, den er dem ersten von ihm gefundenen Amerikaner geben sollte und in dem zu alliierter Hilfe aufgerufen wurde.
Das nur 5 km talabwärts gelegene Wörgl war noch in deutscher Hand, weshalb sich Čučković das Inntal aufwärts in Richtung des 70 km Fussweg entfernten Innsbruck begab. Am späten Abend erreichte er den Stadtrand von Innsbruck, wo er die Vorhut des 409. Infanterieregiments der amerikanischen 103. Infanteriedivision des VI. Corps antraf und über die Gefangenen im Schloss informierte. Die amerikanischen Soldaten wollten eine Rettungsaktion nicht auf eigene Faust starten, sagten aber Čučković eine Antwort ihres Kommandeurs bis zum Morgen des 4. Mai zu. Am Morgen stiess eine amerikanische Einheit in Richtung Schloss Itter vor, wurde jedoch auf halbem Wege kurz hinter Jenbach durch heftiges Artilleriefeuer zum Halten gebracht.
Als Čučković am 3. Mai nicht zurückkehrte, verliess Sebastian Wimmer seinen Posten, und die Wachmannschaften der SS-Totenkopfverbände folgten ihm bald danach. Daraufhin bewaffneten sich die Gefangenen mit dem zurückgelassenen Kriegsmaterial und übernahmen die Kontrolle über das Schloss.
Da Čučković auch am 4. Mai nicht zurückkam, entschloss sich am Mittag der tschechische Koch Andreas Krobot, mit dem Fahrrad nach Wörgl zu fahren und Hilfe zu suchen. Die Stadt war von der Wehrmacht geräumt, anschliessend aber von Einheiten der Waffen-SS besetzt worden. Hier fand er Angehörige des Österreichischen Widerstandes, die ihn zu Major Josef Gangl brachten. Dieser kommandierte die Reste einer Wehrmachtseinheit, die dem Räumungsbefehl nicht gefolgt war und sich dem Widerstand vor Ort angeschlossen hatte.
Gangl hatte bereits vor, die Gefangenen im Schloss zu befreien, wollte jedoch seine wenigen Soldaten nicht in einem Himmelfahrtskommando, gegen das von schwer bewaffneter SS bemannte Schloss opfern. Stattdessen hielt er seine Männer bereit, um Bewohner der Stadt vor Repressalien der SS zu schützen, bis die Amerikaner in der Stadt eintreffen würden. Nun sah sich Gangl aber gezwungen, den Amerikanern unter weisser Flagge entgegenzueilen, um sie um Hilfe zu bitten. Im 8 km entfernten Kufstein traf er auf eine Aufklärungseinheit der Amerikaner mit vier Panzern M4 Sherman des 23. Panzer-Battalions der 12. Panzer-Division des XXI. Corps der US Army unter dem Kommando von Hauptmann John C. „Jack“ Lee. Dieser zögerte nicht, die erbetene Rettungsaktion einzuleiten, wofür er auch sofort Erlaubnis seines Kommandeurs erhielt.
Nachdem Lee und Gangl von Gangls Kübelwagen aus das Schloss beobachtet hatten, liess Lee zwei seiner Panzer zurück, übernahm aber fünf weitere sowie unterstützende Infanterie vom soeben eingetroffenen 142. US-Infanterieregiment der 36. Infanterie-Division. Lee sah sich jedoch an einer zu unsicher erscheinenden Brücke gezwungen, die Verstärkung zurückzuschicken und mit nur 14 US-Soldaten, Gangl sowie einem Lastwagen mit einem Fahrer und zehn ehemaligen Artilleristen der Wehrmacht zum Schloss vorzustossen, wobei er einen Panzer an der Brücke zurückliess. Der Vorstoss zum Schloss wurde gegen eine Einheit der Waffen-SS erzwungen, die vergeblich versuchte, den Weg zu blockieren.
Währenddessen baten die französischen Gefangenen den SS-Offizier Kurt-Siegfried Schrader, der sich zur Genesung von einer Verwundung in Itter befand, um Schutz. Als Lee das Schloss erreichte, wurde er freudig begrüsst, doch waren die ehemaligen Gefangenen angesichts der geringen Anzahl von Amerikanern enttäuscht. Während Lees Männer Verteidigungsstellungen um das Schloss herum einnahmen, wurde der Panzer (Besotten Jenny) am Haupttor aufgestellt. Obwohl Lee die befreiten Franzosen angewiesen hatte, sich zu verstecken, kämpften sie an der Seite der US- und Wehrmachtssoldaten. Gangl gelang es, Alois Mayr von der österreichischen Widerstandsgruppe in Wörgl anzurufen und um Hilfe zu bitten, woraufhin zwei weitere Wehrmachtssoldaten und der jugendliche Widerstandskämpfer Hans Waltl zum Schloss fuhren. Nachdem in der Nacht Spähtrupps das Schloss beobachtet hatten, griffen am Morgen des 5. Mai etwa 100 bis 150 Mann der Waffen-SS an. Gangl wurde beim Versuch, den ehemaligen französischen Premierminister Reynaud aus der Schusslinie zu bringen, von der Kugel eines Scharfschützen tödlich getroffen. Er starb als einziger der Verteidiger des Schlosses. Der Sherman-Panzer wurde durch eine 8,8-cm-FlaK 18/36/37 zerstört, doch gelang es dem amerikanischen MG-Schützen, sich in Sicherheit zu bringen.
Am frühen Nachmittag wurde schliesslich eine Entsatzeinheit des 142. Infanterieregiments in Marsch gesetzt. Der Tennisspieler Borotra meldete sich freiwillig, um sich durch die Linien der SS zu schlagen, und erreichte die US-Truppen, die er nun über die Lage im Schloss informieren konnte.
Die Entsatztruppen erreichten gegen 16 Uhr das Schloss und besiegten die Belagerer, wobei etwa 100 SS-Leute gefangen genommen wurden. Die befreiten französischen Gefangenen wurden am selben Abend nach Frankreich geschickt und erreichten Paris am 10. Mai 1945.
Historische Bewertung
Lee wurde für seinen Einsatz mit dem Distinguished Service Cross ausgezeichnet. Gangl wurde als Held des österreichischen Widerstands geehrt, und in Wörgl wurde eine Strasse nach ihm benannt.
Die Schlacht um Schloss Itter, geschlagen nur zwei Tage vor Kriegsende und fünf Tage nach Hitlers Tod, wird als die „seltsamste Schlacht des Zweiten Weltkrieges“ bezeichnet und gilt als einzige Schlacht dieses Krieges, bei der Amerikaner und Deutsche auf einer Seite kämpften.
Fronten in Auflösung
(Bericht der Süddeutschen Zeitung)
Die Fronten in Auflösung, Berlin vor dem Fall, der Diktator am Ende: Im Frühjahr war der Zweite Weltkrieg längst entschieden. Doch weil die Wehrmacht nicht kapitulierte, gehören die letzten Tage zu den blutigsten des Krieges.
Im April 1945 stand Hitlers „Tausendjähriges Reich“ nach sechs Jahren beispiellosen Vernichtungskrieges am Abgrund. Die Westfront befand sich nach der alliierten Rheinüberquerung in Auflösung, im Osten stand die Rote Armee vor den Toren Berlins. Doch Hitler und die Spitze der NSDAP dachten selbst in dieser ausweglosen Situation nicht daran, zu kapitulieren. Sie waren gewillt, die Bühne der Weltgeschichte mit einem letzten Paukenschlag zu verlassen und weitere Millionen deutsche Soldaten zu opfern. Von der Ostsee bis zur Steiermark bereitete sich das letzte Aufgebot der Wehrmacht auf den letzten Schlag der Roten Armee vor.
Insgesamt drei Stellungssysteme an Oder und Neiße bildeten die sogenannte „Nibelungenstellung“, die Berlin verteidigen sollte. Der Befehl dazu kam spät. Erst am 9. März 1945 begannen die verzweifelten Maßnahmen, um noch Befestigungsanlagen vor Berlin ins Erdreich zu treiben. Tag und Nacht wurde die Bevölkerung dazu angetrieben, Schützengräben und Unterstände auszuheben, die anschließend mit den letzten noch verfügbaren Männern besetzt wurden. Reserven zur Abriegelung sowjetischer Durchbrüche gab es längst nicht mehr.
Dabei verfügte das täglich schrumpfende Reich noch über eine nicht unerhebliche Menge kampfstarker Truppen – allerdings außerhalb Deutschlands. Selbst im Angesicht der totalen Niederlage konnte sich Hitler nicht dazu durchringen, die letzten verbliebenen Eroberungen in Europa zu räumen. So waren Anfang April 1945 immer noch gut zwei Millionen Deutsche Soldaten in Kurland, Norwegen, Italien, Jugoslawien, den Niederlanden, Ungarn und auf tschechoslowakischen Boden stationiert. Sollte die feindliche Koalition doch noch auseinanderbrechen – so Hitlers illusionäres Kalkül -, könnte man diese Gebiete als Faustpfand für Verhandlungen einsetzen.
Hitler selbst gab sich trotz allem siegesgewiss und forderte zum unbedingten Durchhalten auf. Am 16. April erinnerte er seine Soldaten in einem Tagesbefehl daran, dass es nur den Sieg über den „jüdisch-bolschewistischen Todfeind“ oder Untergang und „Marsch nach Sibirien“ geben könne. Viele Deutsche nahmen den Mann, dem sie jahrelang als „Führer“ gefolgt waren, auch jetzt noch beim Wort.
Wie der deutsche Befehlshaber an der Oder, General Heinrici, korrekt vorausgesagt hatte, stieß die Rote Armee entlang der Reichsstraße 1, die von Ostpreußen nach Berlin führte, auf die Hauptstadt vor. Anstatt die Ufer der Oder zu befestigen, die in Reichweite der russischen Artillerie lagen, wurden daher die Seelower Höhen zum letzten Wellenbrecher vor Berlin erklärt. 120 000 deutsche Soldaten besetzten das ausgeklügelte Stellungssystem, deren letzte Linie, die „Wotanstellung“, bis kurz vor Berlin reichte. Um den sowjetischen Vormarsch zusätzlich zu erschweren, wurde der Oderbruch von deutschen Pionieren geflutet und in einen gigantischen Sumpf verwandelt – kaum passierbar für die schweren russischen T-34 Panzer.
Georgi Schukow, der Mann, der Berlin erobern sollte, war zu diesem Zeitpunkt bereits ein Veteran ungezählter Schlachten. 1939 hatte er gegen die Japaner in der Mandschurei gekämpft, 1941 Moskau gegen die deutschen Truppen verteidigt und zuletzt die Reste der deutschen Ostfront in der Weichsel-Oder-Operation zerschlagen. Die Einnahme Berlins als Kommandeur der 1. Weißrussischen Front wollte sich Schukow nicht nehmen lassen. Doch Iwan Konew, Kommandeur der 1. Ukrainischen Front, hatte seine Truppen ebenfalls gegen Berlin gerichtet. Die Oder bildete nun die Startlinie des Rennens um die deutsche Hauptstadt. Zehntausende russische Soldaten sollten die Egomanie ihrer Kommandeure in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges mit dem Leben bezahlen.
Der Kampf um die Seelower Höhen begann mit einem Trommelfeuer, gegen das selbst die Artillerieschlachten des Ersten Weltkrieges verblassten. 42 000 sowjetische Geschütze eröffneten in den frühen Morgenstunden des 16. April das Feuer auf die vordersten deutschen Stellungen, die allerdings größtenteils verlassen waren. Um der eigenen Infanterie ein besseres Sichtfeld zu verschaffen, ließ Schukow gigantische Scheinwerfer auf die Verteidiger richten – ein fataler Fehler. Erbarmungslos mähten die deutschen Maschinengewehre die sich im Gegenlicht deutlich abzeichnenden russischen Soldaten nieder. Der Angriff entwickelte sich zu einem Desaster. Schukow warf nun seine Panzer in die Schlacht, die reihenweise von deutschen Panzerfaustschützen abgeschossen wurden. Doch den Verteidigern ging bald die Munition aus. Am 19. April brachen die Russen schließlich durch. 30 000 Rotarmisten und 12 000 Deutsche hatten die Schlacht nicht überlebt.
Weiter südlich überrollten die sowjetischen Truppen der 1. Ukrainischen Front unter Marschall Konew die schwachen deutschen Stellungen entlang der Lausitzer Neiße. Für Gegenangriffe hatte die Wehrmacht keine Kräfte mehr. Die 9. Armee, die mittlerweile südlich von Berlin stand, wurde eingekesselt und im berüchtigten „Kessel von Halbe“ vernichtet. Rund 40 000 deutsche Soldaten und Zivilisten verloren dabei ihr Leben.
Am 20. April, Hitlers letztem Geburtstag, fiel Nürnberg und südlich von Berlin tauchten die ersten russischen Panzer auf der Autobahn auf. Fünf Tage später trafen sich die sowjetischen Angriffsspitzen nordwestlich von Potsdam. Die Hauptstadt war damit eingeschlossen. Zu einem großangelegten Entlastungsangriff kam es nicht mehr. Die dazu vorgesehene 4. Panzerarmee zog sich stattdessen kämpfend von Dresden nach Böhmen zurück. Auch die SS-Truppen der „Armeegruppe Steiner“, auf die Hitler seine letzte Hoffnung gesetzt hatte, existierten nur noch auf dem Papier- Berlin würde auf sich alleine gestellt kämpfen müssen.
Trommelfeuer aus unzähligen Rohren und pausenlose Angriffe sowjetischer Schlachtflieger kündigten den Sturm auf Hitlers letzte Bastion an. Rund 100 000 Verteidiger, mehr als die Hälfte davon Volkssturm und Hitlerjungen, sollten den Ansturm von rund 2,5 Millionen Rotarmisten stoppen. Verstärkt wurden sie von 250 unglücklichen Marinesoldaten, die auf Geheiß von Großadmiral Karl Dönitz noch am 25. April in die belagerte Hauptstadt geflogen wurden. Die meisten von ihnen starben bei der der Verteidigung der Reichskanzlei. Hitler selbst harrte im „Führerbunker“ tief unter der Erde dem Ende entgegen.
Im Angesicht des Untergangs wurde es um den Diktator zusehends einsamer. Hermann Göring telegrafierte am 23. April aus Berchtesgaden, dass er Hitlers Nachfolge antreten werde, sofern dieser in Berlin verweile. Noch am selben Tag erfuhr Hitler zudem von Heinrich Himmlers Versuchen, mit den Alliierten einen Separatfrieden zu schließen. Hitler ließ daraufhin Himmlers Verbindungsoffizier Hermann Fegelein erschießen.
Hitler verließ Berlin nicht mehr. Nachdem ihm General Weidling am 29. April erklärte, dass die Verteidigung in den nächsten 24 Stunden zusammenbrechen würde, setzte der Diktator sein Testament auf. Tatsächlich begann bereits am nächsten Tag kurz nach 14 Uhr der finale Sturm auf den Reichstag. Gegen 15.30 Uhr beging Hitler gemeinsam mit Eva Braun Selbstmord – der europäische Alptraum näherte sich endgültig seinem Ende. Im Reichstag hielten die letzten Verteidiger noch bis in die Abendstunden weiter aus, vor allem dank des Unterstützungsfeuers des Flakturmes im Berliner Zoo. Kurz nach 22 Uhr wehte auch vom Dach des Reichstages die sowjetische Fahne.
In den Ruinen Berlins endete auch für tausende Nazi-Sympathisanten aus ganz Europa der Traum von der „Neuen Ordnung“. Da ihnen in ihrer Heimat der Galgen drohte, blieb den Resten der „europäischen SS“ nur noch der gemeinsame Untergang mit dem Mann, dem sie die Treue geschworen hatten. Neben den Norwegern, Belgiern, Dänen, Schweden und Niederländern der SS-Division „Nordland“ waren es vor allem die Franzosen der SS-Division „Charlemagne“, die bis zur letzten Minute verzweifelt weiterkämpften. Auch die lettische Waffen-SS, deren Veteranen bis heute jährlich durch Riga marschieren, befand sich bis zum Ende im Kessel.
Die kleine Gruppe Franzosen, die aus dem Berliner Inferno entkommen war, wurde im Westen ausgerechnet von den freifranzösischen Streitkräften unter General LeClerc aufgegriffen. Das Bild vom Zusammentreffen französischer Soldaten in deutscher und amerikanischer Uniform zeigt wohl besser als jedes andere die Zerrissenheit Frankreichs nach fünf Jahren Krieg, Besatzung und Kollaboration. Kurz nach dieser Aufnahme wurden die SS-Männer auf Befehl LeClercs (Mitte mit Stock) ohne weitere Verhandlung erschossen.
Zeitgleich mit der Schlacht um Berlin endete auch in Österreich nach sieben Jahren die Herrschaft des Nationalsozialismus. Die dort stationierten Wehrmachtsverbände waren in den vergangenen Kämpfen um Ungarn weitestgehend aufgerieben worden. Nur mehr 22 000 Soldaten und 52 Panzer verblieben den Deutschen zur Verteidigung Wiens, allerdings war der Anteil an fanatischen Waffen-SS Männern hoch. So zog sich der Kampf um Wien und den Wienerwald trotz zehnfacher Überlegenheit der Sowjets wochenlang hin und forderte hohe Opfer auf beiden Seiten. Erst am 23. April kapitulierten die letzten Verteidiger.
Im Gegensatz zu anderen Städten, die in der Endphase des Krieges sinnlos verteidigt und zerstört wurden, gab es in Wien ernsthafte Bestrebungen zur kampflosen Übergabe. Österreichische Wehrmachtsoffiziere unter Major Carl Szokoll nahmen mit den Sowjets Kontakt auf und boten ihre Zusammenarbeit an. Die Operation mit dem Decknahmen „Radetzky“ wurde allerdings frühzeitig von der Gestapo aufgedeckt und die Verschwörer anschließend öffentlich an Laternenmasten aufgehängt. Szokoll selbst wurde rechtzeitig gewarnt und konnte sich retten. Unser Bild zeigt die Leichen ermordeter Widerstandskämpfer am Wiener Floridsdorfer Spitz.
An der Verteidigung Österreichs war auch eine der der obskursten Schöpfungen der Wehrmacht beteiligt: die 1. Division der „Ukrainischen Nationalarmee“, ehemals „14. Waffen-Grenadier-Division der SS (galizische Nr. 1)“. Aufgestellt im April 1945 und offiziell auf die Ukraine vereidigt, zeigte diese Formation, wie die NS-Kriegsmaschinerie vollkommen unbeirrt durch die Realität weiterlief. Im Gegensatz zu den Soldaten ihres russischen Äquivalentes, General Wlassows „Russischer Befreiungsarmee“, hatten die Ukrainer das Glück, nicht an die Sowjets ausgeliefert zu werden. Wegen des Namenszusatzes „galizisch“ wurden sie von den Briten als polnische Einheit eingestuft. Das rettete den Männern das Leben.
Das letzte große Drama des Zweiten Weltkrieges spielte sich im immer noch von den Deutschen besetzten Prag ab. Ermuntert vom Fall Berlins erhoben sich die Tschechen am 5. Mai zum offenen Aufstand. Doch solange ihnen kein freies Geleit nach Westen zugesichert wurde, dachten die rund 900 000 verbliebenen deutschen Soldaten der Heeresgruppen „Mitte“ und „Ostmark“ nicht daran, den Kampf einzustellen. Militärisch standen die Aufständischen damit auf verlorenem Posten. Rund 3000 Tschechen wurden in Prag zusammengetrieben und von der SS ermordet. Als schließlich die Rote Armee eingriff, kam es zu schweren Gefechten mit bis zu 11 000 Toten auf russischer Seite – fast zwei Wochen nach Hitlers Tod. Erst am 11. Mai, dem Ende der „Prager Operation“, herrschte wirklich Waffenstillstand in Europa.
In Berlin kam es noch bis zum 4. Mai zu vereinzelten Gefechten mit Fanatikern, die sich weigerten zu kapitulieren. Danach war die Wehrmacht auf deutschem Boden endgültig geschlagen. Inklusive der Gefechte um die Seelower Höhen war der Kampf um Berlin einer der blutigsten des gesamten Weltkrieges. Mindestens 80 000 Russen starben dabei, Hundertausende wurden verwundet. Die Zahl der deutschen Todesopfer ist nicht mehr genau festzustellen, doch wird sie auf etwa 100 000 Soldaten und ebenso viele Zivilisten geschätzt. Das einzige was der Wehrmacht noch blieb, war die bedingungslose Kapitulation.
Rückblick auf die letzten Gefechte im zweiten Weltkrieg 1945
(Aus „TRUPPENDIENST“ Magazin des Österreichischen Bundesheeres)
Am 29. März 1945 überschritten Soldaten der Roten Armee die österreichische Grenze im Burgenland. Es war eines von vielen Ereignissen, das die Niederlage des Dritten Reiches ankündigte. Für Österreich markierte es das baldige Ende der deutschen Herrschaft. Zwei Wochen später fiel Wien und am 28. April überschritten die ersten US-Soldaten die Grenze zu Tirol. Der Zweite Weltkrieg war militärisch, politisch und symbolisch entschieden. Er war aber noch nicht beendet, und weite Teile Österreichs standen noch unter NS-Herrschaft.
Nach dem Ende der Schlacht um Wien am 13. April 1945 drangen die Truppen der Roten Armee im Zuge der Wiener Operation Richtung Westen vor. Am 15. April wurde St. Pölten erobert und am 23. April die Front entlang der nördlichen Ausläufer der Alpen sowie im Triestingtal bezogen. Zur gleichen Zeit stiess die US-Armee aus dem Raum Regensburg in Richtung Österreich vor.
Die, in den damaligen Alpen- und Donaureichsgauen operierende Heeresgruppe Süd, die seit Anfang April 1945 in Heeresgruppe Ostmark umbenannt wurde, musste sich auf einen Zweifrontenkrieg einstellen. Dabei sollten die amerikanischen Truppen jedoch nicht an der Grenze zu Bayern, sondern erst an der Enns aufgehalten werden. Der Kommandant dieser Heeresgruppe, Generaloberst Dr. Lothar Rendulic, gruppierte deshalb seine Kräfte um. Die Voraussetzung dazu war die Begradigung der Ostfront, da nur so Kräfte für den Einsatz im Westen zur Verfügung standen.
Am 26. April 1945 war die Front im Osten begradigt, und die deutschen Truppen hatten ihre letzte stabile Verteidigungslinie in Österreich bezogen. Diese befand sich in Anlehnung an die Traisen entlang der Linie Hollenburg – Statzendorf – Obergrafendorf – Rabenstein – Lilienfeld – Gutenstein – Semmering. Teile der Heeresgruppe Süd richteten sich hier auf die Abwehr des letzten grossen und entscheidenden Angriffes der Roten Armee im Alpenvorland ein. Dieser fand jedoch nicht statt. Ab dem 27. April kam die Ostfront zum Stillstand, und die Sowjets gruben sich ein.
6. SS-Panzerarmee
Die deutschen Truppen, die im Alpenvorland südlich der Donau eingesetzt waren, gehörten zur 6. SS-Panzerarmee. Ihr Kommandant, SS-Oberst-Gruppenführer und Generaloberst der Waffen-SS, Sepp Dietrich, war kein unbeschriebenes Blatt. Seit dem Putsch von München 1923 war er ein „Kampfgefährte“, enger Vertrauter und Duzfreund von Adolf Hitler. Er war Kommandeur der Leibwache Hitlers, aus der die 1. SS-Panzerdivision „Leibstandarte SS Adolf Hitler“ hervorging, deren erster Kommandant ebenfalls Dietrich war. Die Divisionen dieser Armee zählten zu den erfahrensten, entschlossensten, aber auch berüchtigtsten der deutschen Streitkräfte. Ein Blick auf ihre Nummern und Namen zeigt, dass es sich dabei um die „Elite“ des deutschen Heeres handelte.
Für ihre Gegner war es ein Schock, wenn sie erfuhren, dass sie diesen Verbänden gegenüberstanden. Jedoch nicht nur wegen ihrer Kampfkraft. Die meisten Divisionen der 6. SS-Panzerarmee gehörten zur Waffen-SS, dem militärischen Arm der Schutzstaffel. Diese war ein Teil der Organisationsstruktur der NSDAP. Die Waffen-SS war zwar grundsätzlich eigenständig organisiert, im Zweiten Weltkrieg jedoch der Wehrmacht unterstellt. Den Oberbefehl über sie hatte dennoch Heinrich Himmler, der Reichsführer der SS. Eine damalige Werbeschrift für die Waffen-SS bringt es auf den Punkt wenn sie beschreibt, dass der SS-Mann „nicht alleine Soldat (…)“, sondern „Träger der Idee Adolf Hitlers“ sei.
Die Männer der Waffen-SS waren demzufolge „politische Soldaten“. Manche von ihnen waren nicht nur an Kampfhandlungen an der Front eingesetzt, sondern auch am Holocaust und an zahlreichen Kriegsverbrechen beteiligt. „Vom März 1942 bis April 1945 [haben] ungefähr 45 000 Mann der Waffen-SS zur einen oder anderen Zeit in den Konzentrationslagern gedient“. 1946 wurde die gesamte SS und mit ihr die Waffen-SS vom Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg zur verbrecherischen Organisation erklärt. In der Endphase des Zweiten Weltkrieges kämpften Teile von ihr im Verbund der Heeresgruppe Süd bzw. Ostmark in Österreich.
Gliederung der 6. Panzerarmee
SS-Panzerkorps:
- SS-Panzerdivision „Leibstandarte SS Adolf Hitler“
- Infanteriedivision
- SS-Panzerdivision: „Hitlerjugend“
SS-Panzerkorps:
- SS-Panzerdivision „Das Reich“
- SS-Panzerdivision „Totenkopf“
- Reichsgrenadierdivision „Hoch- und Deutschmeister“
Korps Bünau (bis 16. April 1945 Korps Schultz)
- Infanteriedivision
- Panzerdivision
- Jägerdivision
- Teile der 2. und 9. Panzerdivision
Anmerkung: Die Gliederung der 6. Panzerarmee wurde in den letzten Kriegswochen mehrere Male geändert. Sie gibt jedoch einen Überblick über die wichtigsten Verbände, die Teil dieses Grossverbandes waren. Dieses Korps wurde nach dem Kommandanten benannt.
Die 6. SS-Panzerarmee wurde durch diverse Artillerie-, Fliegerabwehr-, Panzerabwehr- und Infanterieverbände verstärkt. Nach der gescheiterten Plattenseeoffensive im März 1945 verfügte sie jedoch nicht mehr über ihre bisherige Stärke. Bei dem letzten deutschen Grossangriff und dem darauffolgenden Rückzug aus Ungarn wäre die 6. SS-Panzerarmee beinahe vernichtet worden. Sie erlitt schwere Verluste an Personal und Material.
Die Divisionen dieses Grossverbandes waren deutlich geschwächt und hatten massiv an Kampfkraft eingebüsst. In Österreich wurden der Armee zwar neue Panzer zugewiesen und es wurde versucht, die personellen Lücken zu schliessen, ihre einstige militärische Stärke konnte sie jedoch nicht mehr erreichen. Trotz dieser Einschränkungen stellte sie für ihre Gegner noch eine ernsthafte Bedrohung dar. Die 6. SS-Panzerarmee wurde nicht zur Verteidigung von Berlin, Nürnberg oder anderen, für das NS-Regime bedeutenden Orten eingesetzt, sondern in Österreich. Das Mostviertel und mit ihm die heutigen Bezirke Amstetten, Melk, Scheibbs und Waidhofen/Ybbs wurden somit zum entscheidenden Gelände in den letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges.
Der letzte Akt
Am 27. April 1945 rief der provisorische Bundeskanzler Karl Renner in Wien die Zweite Republik aus. Am nächsten Tag überschritten die ersten amerikanischen Truppen die Grenze in Tirol. Innerhalb von 24 Stunden fanden somit zwei für das Ende des Dritten Reiches in Österreich wesentliche Ereignisse statt. Niemand konnte nach diesem Tag noch mit einem deutschen Sieg rechnen.
Das war auch Generaloberst Rendulic bewusst. Ihm unterstanden die deutschen Truppenteile, die auf österreichischem Boden kämpften. Dem General war klar, dass nach einem Verlust des Versorgungsraumes der Heeresgruppe Ostmark, das Ende seines Grossverbandes nicht mehr abzuwenden war. Dieser Raum befand sich mit Masse in Oberösterreich, wo nun die Offensive der US-Armee begonnen hatte. Die Direktive für den Kampf der deutschen Truppe gegen die Amerikaner lautete, symbolischen Widerstand zu leisten. Den Sowjets wollte man jedoch noch mit aller Härte entgegentreten. Das war zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht notwendig, da die Rote Armee im Wesentlichen ihre Waffen ruhen liess. Es kam zwar zu kleineren Kampfhandlungen, diese waren jedoch für den Verlauf des Krieges unbedeutend. An der Front im Osten war der Winter zurückgekehrt, und die Moral der Truppe war am Tiefpunkt, wie den Schilderungen eines ehemaligen Soldaten zu entnehmen ist: „Oftmals hatten wir den Eindruck, dass sich die Abwehrkämpfe in Einzelaktionen auflösten und jeder um das nackte Überleben kämpfte, um nicht in sowjetische Gefangenschaft zu geraten.
Es war ein langsames Vergehen der Kräfte. (…) Kameradschaft, Vertrauen, Gehorsam und Treue galten nur noch dort etwas, wo man sich kannte und wusste, dass einer für den anderen da war. Wenn auch keiner mehr an den Endsieg glauben konnte, so fühlte sich jeder nur in seinem „Haufen“ zu Hause. (…)“
Einer der Soldaten, die so fühlten war Konrad Radner. 1943 wurde er nach der Musterung zur Waffen-SS eingezogen. „Aussuchen konnten wir uns das nicht, wir wurden der Waffen-SS zugeteilt, ob wir wollten oder nicht“. Er versah seinen Dienst bei einem Fernschreibtrupp im Kommando der 1. SS-Panzerdivision. Im Vergleich zu vielen seiner Kameraden hatte er eine privilegierte Position mit deutlich höheren Überlebenschancen, als direkt an der Front. Nach zwei Jahren an verschiedenen Frontabschnitten hatte ihn der Krieg schliesslich in die Nähe seiner Heimat im Mostviertel gebracht.
Selbstmord
Als die Front in Niederösterreich zum Stehen kam, befahl die Oberste Heeresleitung in Berlin eine Umgliederung der Truppen an der Ostfront. Auch die Heeresgruppe Süd, die sich kurz zuvor neu formiert hatte, musste wesentliche Kräfte für die Verteidigung ihres Frontabschnittes abgeben. Diese wurden in den Raum Brünn (Brno, im heutigen Tschechien) verlegt, um dort eine sowjetische Offensive Richtung Prag abzuwehren.
Am 30. April 1945 verübte Adolf Hitler Selbstmord im Bunker der Berliner Reichskanzlei. Die Soldaten an der Front erfuhren davon am nächsten Tag. Viele von ihnen waren erleichtert, denn „allen ist klar geworden, dass der Krieg sein Ende gefunden hat. Zu Ende ist die ständige Angst im Nacken vor der nächsten Schlacht am nächsten Tag und das Sterben“. Mit diesem Tag beendete die Oberste Heeresleitung in Berlin die Truppenverschiebungen in Österreich. Die Gliederung der Heeresgruppe Ostmark blieb von diesem Zeitpunkt bis zum Kriegsende im Wesentlichen unverändert.
„Bis an die Front war nun auch das Gerücht durchgesickert, dass die Enns die Demarkationslinie zwischen den Amerikanern und den Sowjets werden sollte“. Darüber hinaus gab es schon Informationen über deutsche Kommandanten, die mit den Amerikanern verhandeln würden, damit möglichst grosse deutsche Truppenteile in amerikanische Gefangenschaft kommen. „Nun zum Schluss nicht noch den Sowjets in die Hände fallen“, war die Devise der meisten Soldaten.
Die Hoffnungen vieler Soldaten lagen vor allem bei Grossadmiral Karl Dönitz, der nach dem Selbstmord Hitlers die Nachfolge als Staatsoberhaupt und Oberbefehlshaber der Deutschen Wehrmacht übernahm. Er sollte den deutschen Soldaten die sowjetische Gefangenschaft ersparen. Die Situation der Soldaten an der Front änderte sich dadurch jedoch nicht. An der Hauptkampflinie an der Traisen gab es zwar ständig kleinere Kämpfe, im Grossen und Ganzen war die Lage dort jedoch stabil. „Wir haben (…) den Befehl erhalten, (…) so lange zu verteidigen bis alle rückwärtigen Einheiten – Verbandsplätze, Lazarette, die zum Teil fliehende Bevölkerung eingeschlossen – vor den angreifenden Russen in Sicherheit sind“. Die letzte Phase des verlorenen Krieges hatte begonnen.
Amerikanischer Vorstoss
Seit Ende April 1945 befanden sich amerikanische Truppen im bayerisch/österreichischen Grenzgebiet. Am 26. April begann der Angriff der US-Armee nördlich der Donau über den Bayrischen Wald in das westliche Mühlviertel. Die ersten Aktionen der 11. US-Panzerdivision konnten die deutschen Truppen im Grenzbereich von Kollerschlag im Mühlviertel noch abwehren. Am 30. April überschritten US-Soldaten schliesslich die Grenze zu Österreich. Drei Tage später waren sie etwa 20 km bis Neufelden und Haslach vorgestossen. Das Vorgehen der amerikanischen Kräfte im Mühlviertel erfolgte wesentlich langsamer als in Bayern. Schwere Regenfälle und ein Gelände, das schwierig zu passieren war, verzögerten den Vormarsch.
Ab dem 2. Mai begann die US-Offensive auf breiter Front auch südlich der Donau. Dort griffen die 65., 71. und 80. Division zügig Richtung Osten an. Aufgrund einer Weisung von Admiral Dönitz, sollte den US-Truppen nur so lange Widerstand entgegengesetzt werden „bis die Rückführung der deutschen Armeen aus dem Osten hinter die Linien der Westalliierten gelungen sei“. Bereits am 4. Mai standen die Amerikaner bei der Linie Eferding – Wels – Lambach – Vöcklabruck.
Hartnäckiger Widerstand wurde nur noch bei Eferding geleistet. Hier waren weissrussische Einheiten der Waffen-SS eingesetzt. Sie wussten, dass sie bei einer Gefangennahme an die Sowjets ausgeliefert werden würden, was ihren sicheren Tod bedeutet hätte. Das wollten sie auf jeden Fall verhindern. In ihrem Kampf wurden sie ein letztes Mal von deutschen Jagdflugzeugen des Typs Me-109 aus der Luft unterstützt.
Nördlich der Donau stand die 11. US-Panzerdivision nur noch wenige Kilometer von Linz entfernt. Dort befand sich die letzte Verteidigungslinie vor der Stadt. Noch am 4. Mai konnten die Angriffe der Amerikaner dort abgewehrt werden. Für eine Verteidigung von Linz gab es jedoch nicht mehr genügend deutsche Truppen, weshalb sich die dort eingesetzten Einheiten in der folgenden Nacht Richtung Westen absetzten. Am 5. Mai rückte die US-Armee von Norden und Westen Richtung Linz vor. Der Vorstoss auf die Stadt wurde nur noch von einigen Fliegerabwehrbatterien verzögert. Diese hatten den Auftrag, durch Steilfeuer auf die amerikanischen Truppen das Absetzen der zurückweichenden Verteidiger zu ermöglichen. Kurz nach 1100 Uhr trafen die ersten amerikanischen Panzer am Linzer Hauptplatz ein. Die Stadt war gefallen.
Am Abend des 5. Mai 1945 standen die amerikanischen Truppen südlich der Donau an der Enns. Nördlich der Donau stiessen sie nach Zell, etwa 30 km nordöstlich von Linz vor. Der Versorgungsraum der Heeresgruppe Ostmark war nicht mehr in deutscher Hand. Der Grossverband verfügte zwar noch über eine relativ gute Versorgungslage mit ausreichend Waffen, Gerät und Munition, womit er noch ernsthaft Widerstand hätte leisten können. Diese Vorräte wären jedoch nach wenigen Kampftagen aufgebraucht und nicht mehr zu ersetzen gewesen. Die Kapitulation der Heeresgruppe war unausweichlich.
Bevor Konrad Radner mit seiner Division an die Ostfront verlegt worden war, war er an der Westfront eingesetzt. Dort stand er schon einmal den Amerikanern gegenüber, in deren Gefangenschaft er sich nun begeben sollte. Nach der Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944 kämpfte er bis zum Jänner 1945 gegen amerikanische Truppen. Diese waren am 5. Mai 1945 nur noch 80 km von ihm entfernt. An der Westfront 1944 erlebte er im Kessel von Falaise seine gefährlichsten Momente während des Krieges: „Als wir durch die Hecken rannten, wurden wir von allen Seiten beschossen. Vor mir und neben mir wurden Kameraden von Kugeln getroffen und blieben liegen. Plötzlich fuhr ein Panzer vorbei, der auch eine Kanone transportierte. Ich nutzte die Gelegenheit und sprang auf das Geschütz. Kurz darauf sassen links und rechts von mir noch weitere Soldaten. Ich dachte, bevor ich getroffen werde, erwischt es die. Nicht alle fanden einen Platz auf der Kanone. Ein Soldat, der auf den Panzer springen wollte landete in dessen Ketten. Ich kann noch heute seine Schreie hören“.
Widerstand nördlich der Donau
Der Vormarsch der amerikanischen Truppen nördlich der Donau gestaltete sich schwieriger als südlich. Entlang der Linie Grein – Königswiesen leistete die 3. SS-Panzerdivision hartnäckigen Widerstand. Die Chronik des Gendarmeriepostens von Königswiesen gibt einen Einblick in die Kampfhandlungen: „Am 5. Mai um 1100 Uhr kamen amerikanische Parlamentäre und forderten den Bürgermeister auf, den Markt kampflos zu übergeben. Der Bürgermeister sagte dies auch zu und liess die weisse Fahne hissen“. Der Ortsgruppenleiter der NSDAP wollte den Ort jedoch unbedingt verteidigen und rief eine Einheit der Waffen-SS herbei, „die um 1530 Uhr eintraf und sogleich in Stellung ging“.
Der Bürgermeister, einige Bürger und der Postenkommandant der Gendarmerie versuchten, mit den Amerikanern Verbindung aufzunehmen. Dabei wurden sie von Soldaten der Waffen-SS beschossen und mussten umkehren. „Um 1800 Uhr kam es zu einem kurzen Feuergefecht mit der amerikanischen Vorhut (…). Das Gefecht wurde abgebrochen und die Amerikaner bezogen mit sieben Panzern den Höhenrücken von Kastendorf. In der Nacht zum 6. Mai kam laufend SS-Verstärkung an, welche die umliegenden Höhen besetzten“.
Am 6. Mai war Königswiesen voller Soldaten. Viele Bewohner versuchten, sich in den Gehöften der Umgebung oder in den Wäldern zu verstecken. „Um ungefähr 1330 Uhr begann der Kampf etwa zwei Kilometer ausserhalb des Ortes. (…) Von Mönchdorf feuerte der Amerikaner. (…) Das Ziel war der MG-Stand auf dem Kirchturm. Am 7. Mai setzte der Amerikaner Flieger ein, welche den Markt und die Umgebung umkreisten. Sie beschossen die SS-Stellungen mit Bordwaffen. (…) Die SS stellte hierauf den Kampf ein, aber der Amerikaner stiess nicht mehr vor“.
Ähnlich war die Situation bei Grein, wo auch schweres Artilleriefeuer die dort eingesetzten Soldaten nicht aus ihren Stellungen werfen konnte. Am 7. Mai griffen die amerikanischen Truppen mit Unterstützung von Jagdbombern an, die Verteidiger konnten die Frontlinie jedoch nach wie vor behaupten. Der hartnäckige Widerstand der 3. SS-Panzerdivision diente dazu, den Abzug ihres Korps zu decken. Sie standen dennoch im Gegensatz zum Verhalten der restlichen Teile der Heeresgruppe Ostmark. Der Grund könnte darin liegen, dass sich die 6. SS-Panzerarmee unter Sepp Dietrich dem Befehl von Generaloberst Rendulic vom 6. Mai widersetzte. Rendulic befahl, dass am 7. Mai ab 0900 Uhr die Kämpfe gegen die US-Armee einzustellen sind.
Bei allen Anordnungen und Befehlen, die zu Kriegsende an deutsche Truppen erteilt wurden, gab es einen wesentlichen Unsicherheitsfaktor: Die im deutschen Heeresverband kämpfenden Teile der Waffen-SS. Als militärischer Arm der SS waren sie vor allem Adolf Hitler, der Partei bzw. dem NS-Staat verpflichtet und deshalb für die Heeresführung unberechenbar. Wie weit sie nach dem Tod Hitlers dem ebenfalls wankenden NS-Regime noch treu sein würden, war fraglich und von Verband zu Verband unterschiedlich. Den meisten Angehörigen der Waffen-SS war bewusst, dass der Krieg verloren war und sie hatten nur noch den Wunsch, in amerikanische und nicht in sowjetische Gefangenschaft zu gelangen.
Auch wenn sie Teilkapitulationen wie jene der Heeresgruppe Ostmark nicht akzeptierten – die Gesamtkapitulation sahen sie dann doch als verbindlich an. Wie gross die Bedenken des Oberkommandos der Wehrmacht waren, zeigt ein Telegramm an Sepp Dietrich. Noch am frühen Nachmittag des 9. Mai, also bereits nach dem offiziellen Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa, wurde er dazu gemahnt, die bedingungslose Kapitulation zu respektieren.
Die letzte Umgruppierung
Durch den Vorstoss der amerikanischen Truppen an die Enns am 5. Mai verstärkte die Heeresgruppe Ostmark noch ein letztes Mal ihre Positionen entlang der Enns. Damit sollte ein Durchbrechen der US-Armee solange verhindert werden, bis die Masse der Soldaten der Ostfront in amerikanischer Gefangenschaft wären. Ausserdem wollte man verhindern, dass im Rücken der gegen die Sowjets kämpfenden Truppen, plötzlich US-Soldaten auftauchten. Die Truppenverschiebung war nur möglich, da es an der Ostfront nach wie vor relativ ruhig war. Rendulic setzte mit der Verstärkung der Verteidigungslinie entlang der Enns auch einen Befehl seines Vorgesetzten um. Dieser lautete, den Westmächten nur noch hinhaltenden Widerstand zu leisten, den Sowjets jedoch nach wie vor entschlossen entgegenzutreten und das Absetzen Richtung Westen zu intensivieren.
Die Heeresgruppe Ostmark wurde dabei auch von Kräften unterstützt, die zwar Uniform trugen, aber sonst wenig mit soldatischen Tugenden verband. Es waren die SS-Wachmannschaften des Konzentrationslagers Mauthausen, die dieses am 3. Mai verlassen hatten. Nun besetzten sie das Gebiet östlich des Lagers. „Die Auffangstellung befand sich auf einem Hügelgebiet und zog sich etwa entlang des Bahngleises Mauthausen in Richtung Norden. (…) Ein kleiner Teil der SS-Formationen wurde über die Donaubrücke dirigiert, um in den Auen und entlang des Flusses Enns Stellung zu beziehen“. Diese Einheiten waren bereit bis zur letzten Patrone zu kämpfen. Aufgrund ihrer Tätigkeit in der Terror- und Tötungsmaschinerie des Dritten Reiches wollten sie keineswegs in Gefangenschaft geraten – egal auf welcher Seite.
Die Ostfront im Alpenvorland bröckelt
Vom 2. bis zum 6. Mai 1945 wurden alle nicht mehr voll einsatzbereiten schweren Waffen sowie Nachschub-, Transport- und Instandsetzungseinheiten von der Front im Osten des Alpenvorlandes abgezogen. Nachdem die US-Truppen die Enns erreicht hatten, kamen die Operationen der Alliierten zum Stillstand. Obwohl erste amerikanische Aufklärungseinheiten über die Enns vorstiessen, bestand keine unmittelbare Gefahr eines grossen Angriffes. Der Oberste Befehlshaber der Deutschen Wehrmacht, Admiral Dönitz, befahl deshalb, die Absetzbewegungen im Osten zu beschleunigen. An der Niederlage gab es keine Zweifel mehr.
Die Hauptkampflinie an der Ostfront im Alpenvorland war ab dem 6. Mai 1945 nur noch stützpunktartig besetzt. Die deutschen Einheiten setzten sich Richtung Westen in Bewegung, wobei sie sich auf ein gut ausgebautes und leistungsfähiges Strassennetz abstützen konnten. Motorisierte Einheiten, die noch an der Frontlinie ausharrten, sollten die Absetzbewegungen verschleiern. Zu diesem Zeitpunkt mischten sich die Soldaten, auch jene der Waffen-SS, unter den Strom der Flüchtlinge in den Westen. „In den drei Tagen vor der Besetzung [hier der 9. Mai; Anm.] bewegte sich auf der Strasse nach Oberösterreich ein breiter Strom von Soldaten und Zivilisten mit und ohne Fahrzeug. Die abgehetzten, verwildert aussehenden Soldaten (…) boten ein Bild der Trostlosigkeit und des Jammers“.
Die letzten Tage des Krieges zu überleben, hatte oberste Priorität bei den Soldaten an der Front. Konrad Radner hatte bereits zahlreiche gefährliche Situationen überlebt. Neben dem Glück war es vor allem wichtig, Gefahren zu erkennen und keiner „Versuchung“ zu erliegen. Von diesen gab es viele. Eine davon blieb ihm besonders in Erinnerung: „Im Krieg wurden Freiwillige gesucht, die den Führerschein machen sollten. Auch ich wurde gefragt. Die Ausbildung hätte drei Wochen gedauert, und ein paar Tage Heimaturlaub wären auch dabei herausgesprungen. Ich habe abgelehnt“.
Die Kraftfahrer bei den Fernmeldeeinheiten waren dem Tode geweiht. Die Funksprüche, die in den Fahrzeugen abgegeben wurden, konnten von den amerikanischen Truppen geortet werden. Kurz nachdem ein Funkspruch abgesetzt war, wurden sie zur Zielscheibe der Artillerie. Im Gegensatz zur Mannschaft, die absass und eine Deckung aufsuchte, mussten die Fahrer im Fahrzeug bleiben. „Die Aussicht auf ein paar Tage weg von der Front war für viele Kameraden jedoch zu verlockend. Keiner von ihnen hat den Krieg überlebt – alle starben in ihren Fahrzeugen“.
Die Amerikaner kommen
Am 6. Mai 1945 trafen amerikanische Soldaten in Waidhofen/Ybbs ein. „Es wurde bekannt, dass der Abschluss der Kampfhandlungen unmittelbar bevorstehe und die Amerikaner an der niederösterreichischen Grenze stehen. (…) Sie werden auch zu uns kommen, hofften viele. (…)“ Die Sorge der Bewohner war nicht unberechtigt. Viele Soldaten berichteten von ihren Erlebnissen an der Front, aber auch von den Gräueltaten an der Bevölkerung in den besetzten Gebieten. Davon erzählte auch so mancher Fremdarbeiter, von denen damals viele in der Stadt und ihrer Umgebung waren. Die deutsche Propaganda tat ihr übriges, indem sie die Ostvölker, speziell die Russen, als Barbaren darstellte und vor der Roten Armee warnte.
Neben der Angst vor der Rache der Sowjets gab es bei der Bevölkerung die Sorge, dass es zwischen Amerikanern und SS-Einheiten zu Kämpfen kommen könnte, und sie dazwischen stehen würden. „Am Sonntag, dem 6. Mai 1945 fuhren am Nachmittag plötzlich amerikanische Panzer (…) nach Waidhofen“. Die Befürchtungen der Bewohner sind nachvollziehbar, trafen jedoch nicht ein. „Wir standen auf der Fussgängerbrücke (…) und konnten die Jeeps sehen. (…) Auf der Brücke, auf der wir uns befanden, patrouillierten deutsche Soldaten mit Gewehren. (…) Wir dachten uns, dass es jetzt gleich zu einem Gefecht zwischen Deutschen und Amerikanern kommen würde. Aber es geschah nichts. Beide taten so, als ob sie einander nicht wahrgenommen hätten. (…)“.
Vorhuten der US-Army
Amerikanische Truppen drangen am 6. Mai auch an anderen Orten in die zukünftige sowjetische Zone ein. Nicht überall verlief das so friedlich wie in Waidhofen/Ybbs. In Ernsthofen bei St. Valentin trafen die US-Soldaten auf erheblichen Widerstand. Am Vorabend hatten sie Kronstorf, an der gegenüberliegende Seite der Enns erreicht. Ab etwa 0800 Uhr in der Früh versuchten sie, den Fluss bei der Baustelle des Kraftwerkes zu überqueren, um nach Ernsthofen zu gelangen.
Einheiten der Waffen-SS, die sich auf den Hügeln hinter dem Fluss verschanzt hatten, nahmen sie unter Feuer. Dabei setzten die Verteidiger Fliegerabwehrkanonen im Erdeinsatz zur Abwehr des amerikanischen Angriffes aus dem Westen ein. Die US-Truppen mussten den Angriff abbrechen. Kurz darauf griffen sie erneut, dieses Mal jedoch mit Unterstützung von Tieffliegern an. Um etwa 15 Uhr gelang es ihnen schliesslich, die Enns mit Schlauchbooten zu übersetzen. 36 amerikanische und neun deutsche Soldaten starben bei dem Gefecht. „In Ernsthofen befindet sich das letzte Widerstandsnest Deutscher Truppen”, meldete damals ein britischer Radiosender. Er sollte sich irren.
Nachdem sie Ernsthofen eingenommen hatten, marschierten die amerikanischen Soldaten weiter nach St. Valentin, wo sie auf keine Gegenwehr mehr stiessen und vom Bürgermeister begrüsst wurden. Nach einigen Stunden vor Ort setzten sie sich wieder ab und gingen hinter die Enns zurück. Der Vorstoss galt vermutlich dem Nibelungenwerk in St. Valentin, einem der grössten deutschen Panzerwerke.
Mehr als die Hälfte der etwa 8.500 Panzer IV, der meistgebaute deutsche Panzerkampfwagen des Krieges, wurden dort hergestellt. Das Werk war seit einem Bombenangriff am 23. März 1945 so stark zerstört, dass keine Panzer mehr produziert werden konnten. Die US-Soldaten wollten sich davon vermutlich selbst vor Ort überzeugen. Der Krieg in St. Valentin war dadurch jedoch noch nicht beendet. Am 7. Mai 1945 lag die Stadt unter dem Feuer alliierter Artillerie. Am gleichen Tag wurde auch bereits der erste Besatzungsbefehl durch die Gemeinde vorbereitet. Darin wurde, noch bevor die Besatzungstruppen vor Ort waren, die Abgabe von Waffen befohlen. Am 9. Mai marschierten schliesslich die sowjetischen Truppen in St. Valentin ein und übernahmen dort die Kontrolle.
US-Patrouille in Waidhofen/Ybbs
Bei ihrem Vorstoss auf Waidhofen/Ybbs am 6. Mai 1945 ging einem amerikanischen Spähtrupp das Benzin aus. Die US-Soldaten hielten daraufhin einen deutschen Kradmelder auf und baten ihn um Treibstoff. Der Kradmelder liess einen amerikanischen Soldaten, der ursprünglich aus Österreich stammte, aufsitzen, und fuhr mit ihm in das Schloss nach Waidhofen/Ybbs. Als er dort ankam, musste er vor einer Tür warten. „Er konnte ein lautes Streitgespräch hinter dieser Türe vernehmen. Als die Stimmen lauter wurden hörte er, wie jemand vorschlug, ihn zu erschiessen. (…) Er riss die Tür auf und ging auf den Tisch zu, an dem einige hohe deutsche Offiziere sassen und schlug mit der Faust auf den Tisch. Er sagte auf Deutsch, dass er hier wäre, um die Kapitulation in die Wege zu leiten“.
Es war eine List, mit welcher der junge US-Soldat sein Leben retten wollte. Was er nicht wusste: Er befand sich im Hauptquartier der Heeresgruppe Ostmark. Diese hatte erst vor wenigen Stunden ihren neuen Gefechtsstand im Schloss bezogen. Das alte Hauptquartier befand sich in Erla, nur wenige Kilometer von Enns entfernt, das bereits in amerikanischer Hand war.
Der Kommandant der Heeresgruppe Ostmark, Generaloberst Lothar Rendulic, stand schon lange bei seinen Vorgesetzten im Verdacht, mit den Amerikanern über eine mögliche Kapitulation verhandeln zu wollen. Erst vor wenigen Stunden hatte er seinen Truppen befohlen, die amerikanischen Einheiten westlich der Ybbs nicht mehr zu bekämpfen. Den SS-Einheiten wurden sogar Verbindungsoffiziere zugeteilt, die sicherstellen sollten, dass dieser Befehl eingehalten wird.
Kurze Zeit später war auch der Zugskommandant des jungen amerikanischen Soldaten in das Schloss gekommen. Er teilte dem General mit, „dass er beauftragt war, die Sowjets zu finden und die Deutschen zur Kapitulation zu zwingen“. Er bat den Generaloberst darum, seinen Zug in das Schloss nachholen und dort unterbringen zu dürfen. Da die Führung der Heeresgruppe Ostmark die Absicht hatte zu kapitulieren, willigte er ein. Am Abend des 6. Mai befand sich ein Zug amerikanischer Soldaten in Waidhofen/Ybbs. Rendulic befahl der Heeresgruppe Ostmark, ab 0800 Uhr des nächsten Tages die Kämpfe gegen die Amerikaner endgültig einzustellen. Die Teile des Grossverbandes, die im Osten gegen die Sowjets kämpften, bekamen den Befehl sich abzusetzen.
Widerstand
Als die amerikanischen Truppen am 5. Mai die Enns erreichten, erhielt die in Amstetten und Hollenstein stationierte Artillerie-Ersatz- und Ausbildungsabteilung 109 den Befehl, Stellungen im Raum Erlauf zu beziehen. Innerhalb der Abteilung hatte sich jedoch eine Widerstandsgruppe gebildet, der auch ihr Kommandant angehörte. Um den Befehl nicht ausführen zu müssen, fuhr dieser mit den Teilen der Amstettener Garnison nach Hollenstein. Dort wollte er mit seinen Männern das Kriegsende abwarten. Um diesen Plan zu verwirklichen, nahm er in der Früh des 6. Mai die örtliche NS-Führung fest und setzte Sicherungen am Ortseingang von Hollenstein ein.
Hollenstein lag auf einer der Rückzugsstrassen der bereits zurückflutenden deutschen Kräfte, viele davon kriegserfahrene Soldaten der Waffen-SS. Diesen verstellten die Widerstandskämpfer der Ersatzabteilung nun den Weg in die rettende US-Zone. „Auf eine Kriegsaktion, dass wir schiessen müssen, darauf waren wir eigentlich gar nicht gefasst. Wir haben nur geglaubt, wir machen einen Überfall und aus“. Als die Einheiten der Waffen-SS angriffen, zersplitterte sich die Abteilung und zog sich in die
Berge der Umgebung zurück. Mehrere Widerstandskämpfer kamen bei den Kampfhandlungen ums Leben oder wurden kurz darauf hingerichtet.
Als die Rote Armee einige Tage später in Hollenstein eintraf, kamen ihnen die Angehörigen der Ersatzabteilung mit rot-weiss-roten Armschleifen entgegen. Die Sowjets nahmen jedoch keine Rücksicht auf die Widerstandstätigkeit der Abteilung. Im Gegensatz zu den Soldaten der Waffen-SS, die schon hinter der amerikanischen Linie waren, traten sie nun den Fussmarsch in die sowjetische Kriegsgefangenschaft an.
In den letzten Wochen des Krieges ereigneten sich im Alpenvorland mehrere „Endphaseverbrechen“. Dabei wurden vor allem Juden Opfer des NS-Regimes. Die Spur des Terrors zog sich in der Region von Hofamt Priel nördlich der Donau über Amstetten und Randegg bis nach Göstling und Gresten. Hunderte ungarische Juden wurden dabei noch zu Opfern von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die von anarchisch agierenden Einheiten der SS ohne konkreten Befehl verübt wurden.
Patrouillen der Waffen-SS griffen auch immer wieder Deserteure auf. „Im Bezirk Amstetten wurden 37 Personen wegen Hochverrat, Wehrkraftzersetzung, Fahnenflucht usw. zu Freiheitsstrafen und zum Tod verurteilt. 15 Todesurteile wurden vollstreckt“. Darüber hinaus wurden etwa 250 Deserteure vom März 1945 bis zum Kriegsende aufgegriffen. Fast alle wurden exekutiert, und „als abschreckendes Beispiel wurde der Grossteil der erschossenen Soldaten (…) öffentlich zur Schau gestellt“. Sie wurden häufig an Laternen aufgehängt oder auf offener Strasse erschossen und dort liegen gelassen.
Kapitulation
Die amerikanischen Soldaten in Waidhofen/Ybbs konnten ihren Auftrag, mit den Sowjets Verbindung aufzunehmen nicht erfüllen. Sie konnten jedoch eine andere wichtige Mission ausführen: Den Kommandanten der Heeresgruppe Ostmark zu ihrem Vorgesetzten eskortieren, um die Verhandlungen über die Kapitulation seines Grossverbandes in die Wege zu leiten. Das war auch deshalb wichtig, weil damit ein für alle Mal das Gespenst der Alpenfestung gebannt war. Die Errichtung dieser Verteidigungsanlage war zwar immer illusorisch, dennoch hätten die deutschen Truppen über genug Soldaten, Waffen und Nachschubmittel verfügt, um den Krieg noch zu verlängern. In den Mittagsstunden des 7. Mai 1945 verliess Generaloberst Rendulic mit den amerikanischen Soldaten Waidhofen/Ybbs.
Am 7. Mai 1945 unterschrieb General Jodl im Hauptquartier des westalliierten Oberbefehlshabers General Eisenhower in Reims die bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reiches. Das Ziel der Verhandlungen war ein Frieden mit den Westalliierten, aber ein Weiterführen des Krieges gegen die Sowjetunion. Dieser Plan ging nicht auf. Die Westalliierten wollten die Gesamtkapitulation. Aufgrund der aussichtlosen Lage blieb der deutschen Delegation nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren. Jodl konnte jedoch erreichen, dass den Deutschen die Rückführung ihrer Truppen von der Ostfront in den amerikanischen Machtbereich innerhalb einer Frist von zwei Tagen zugestanden wurde.
Noch in der gleichen Nacht befahl Grossadmiral Karl Dönitz das Absetzen aller an der Ostfront kämpfenden Teile nach Westen zu den Amerikanern. Bereits am 4. Mai meinte er, dass der weitere Verlauf des Krieges vor allem den Sinn habe, möglichst grosse Teile der deutschen Bevölkerung vor den sowjetischen Truppen in Sicherheit zu bringen. Im Wesentlichen ging es jedoch darum, möglichst vielen deutschen Soldaten die sowjetische Gefangenschaft zu ersparen.
Die Heeresgruppe Ostmark war über die allgemeine Lage der deutschen Truppen an den restlichen Kriegsschauplätzen schlecht informiert. „Das Oberkommando der Wehrmacht war nicht mehr zu erreichen. Es war mir auch unbekannt, dass Verhandlungen des Oberkommandos mit dem Gegner stattfanden“. Die Fahrt mit den amerikanischen Soldaten, am Nachmittag des 7. Mai, führte Generaloberst Rendulic nach St. Martin/Innkreis (ca. 10 km nördlich von Ried im Innkreis). Dort unterschrieb er um 1800 Uhr die bedingungslose Kapitulation seines Grossverbandes.
Am Abend des 7. Mai war die Verbindung zum Oberkommando der Wehrmacht wieder hergestellt. Die Heeresgruppe Ostmark erhielt den Befehl, sich möglichst unauffällig von den Sowjets zu lösen. Der Grossverband sollte nun mit möglichst viel Verpflegung und nur mit Handfeuerwaffen im Gepäck bis 9. Mai 0001 Uhr die Enns überschreiten. Rendulic und Dönitz hatten unabhängig voneinander das gleiche entschieden – aufgrund der aussichtslosen militärischen Situation blieb ihnen jedoch auch keine andere Wahl.
Innerhalb von etwa 30 Stunden musste die gesamte Heeresgruppe Ostmark mit ihren Armeen, Korps und Divisionen, das Gefecht abbrechen und sich bis zu 80 km weit Richtung Westen absetzen. Die Front der Heeresgruppe löste sich daraufhin auf. Es gab keinen Zusammenhalt mehr an der Frontlinie, und jeder Verband versuchte selbstständig, die Demarkationslinie zu erreichen. Den Kräften im Alpenvorland standen dazu neben der Bundesstrasse 1, das Donautal sowie die Bundesstrasse über Scheibbs nach Waidhofen/Ybbs und von dort weiter bis nach Weyer, Ternberg und Steyr zur Verfügung. Daneben gab es noch einige kleinere Strassen, die ebenfalls von den zurückflutenden Truppen genutzt wurden.
Der letzte Marsch
Am Nachmittag des 7. Mai übermittelt Konrad Radner einen seiner letzten Befehle im Divisionsgefechtsstand. Der Inhalt: Alle Teile der 1. SS-Panzerdivision sammeln im Raum Scheibbs – Puchenstuben zur Bereitstellung für den Marsch an die Enns. Für den Fernschreiber war der Krieg und damit der Dienst am Divisionsgefechtsstand, der ihm unzählige schlaflose Nächte bescherte, fast beendet. „Wenn ich einen Angriffsbefehl übermittelte, konnte ich solange nicht einschlafen, bis die Kanonen donnerten. Das war der Beginn eines Angriffes. Für mich war es das Zeichen, dass ich die Meldung korrekt abgesetzt hatte. Erst dann konnte ich ruhig einschlafen“. Die Anspannung des täglichen Kampfeinsatzes und die unmittelbare Angst vor dem Tod liessen bei den Soldaten nach. Umso grösser wurden jedoch die Ungewissheit und das Gefühl der Unsicherheit vor der Zeit nach dem Krieg.
In der Nacht vom 7. auf den 8. Mai bezog das, nördlich der 1. SS-Panzerdivision eingesetzte, Korps Bünau eine Verteidigungslinie zwischen Melk und Mank. Die Enge zwischen dem Donautal und dem Alpenvorland sollte genutzt werden, um den drohenden sowjetischen Angriff, der bald folgen müsste, entgegenzutreten. In den Morgenstunden erhielt nun auch das Korps Bünau den Befehl, den Weg in die amerikanische Gefangenschaft anzutreten. Da dieser Verband schon in Bewegung war, musste nur noch der Marschweg und das Marschziel verändert werden. Dieser Teil der 6. SS-Panzerarmee konnte den Weg entlang der Bundesstrasse 1 Richtung Westen in die amerikanische Kriegsgefangenschaft relativ einfach antreten.
Sowjetische Einheiten stiessen den deutschen Truppen nach. Den Vorstoss der Roten Armee zu verzögern, war die wichtigste Aufgabe für die Nachhuten der zurückströmenden Teile der Wehrmacht. Nur so konnte das Absetzen in die US-Zone gelingen. Um das zu erreichen, sprengten die zurückweichenden Soldaten mehrere Brücken entlang ihres Weges. Bei Melk wurde nicht nur die Brücke, sondern auch das Fährschiff über die Donau vernichtet. Weiter westlich kam es sowohl in Kemmelbach als auch in Neumarkt/Ybbs zu Kämpfen, wobei auf beiden Seiten auch Panzer eingesetzt wurden. Immer dann, wenn die Spitzen der Roten Armee den zurückweichenden deutschen Soldaten zu nahe gekommen waren, wurden sie angeschossen und ihr Vormarsch verzögert.
Der Rückzug der deutschen Truppen bzw. der Vorstoss der Roten Armee verlief nicht immer entlang der Bundesstrasse oder einer ihrer Parallelverbindungen. Wenn die Sowjets auf deutschen Widerstand stiessen, wichen sie Richtung Norden oder Süden aus. Dann konnte es vorkommen, dass Nachzügler, versprengte oder „vergessene“ Teile der deutschen Armee hinter die sowjetische Linie gerieten. „Plötzlich bremst der Fahrer scharf und hält. (…) Er blickt starr geradeaus, um schliesslich nach vorne zu zeigen. Als ich ebenfalls nach vorne blicke, will mir das Herz still stehen!“ Ein Teil einer Panzerjägerabteilung der 12. SS-Panzerdivision war östlich von Blindenmarkt auf sowjetische T-34-Panzer aufgelaufen. „Zwei Panzer schwenken den Turm in unsere Richtung, und ich sehe in das schwarze Loch ihrer Kanonenmündung“. Die sowjetische Einheit war aus Scheibbs angerückt, da es dem dortigen Rückzugsgefecht vermutlich Richtung Norden ausgewichen war. Solche Szenen waren jedoch die Ausnahme. Im Grossen und Ganzen vollzog sich der Rückzug hinter die amerikanische Linie geordnet und geschlossen.
Das letzte Gefecht entlang der Bundesstrasse 1 am 8. Mai 1945 fand in St. Georgen/Ybbsfeld, einige Kilometer östlich von Amstetten statt. Dort hielten die deutschen Nachhuten noch einmal sowjetische Panzer auf. Um die Verteidigung zu brechen, setzte die Rote Armee Tiefflieger ein, wobei mehrere Gebäude in dem Dorf teilweise schwer beschädigt wurden. In Amstetten trafen die Sowjets nicht mehr auf Widerstand. Kurz davor wurde die Stadt jedoch noch ein letztes Mal bombardiert. Dabei griffen sowjetische Jagdbomber den Hauptplatz an, auf dem sich neben deutschen Truppen auch eine amerikanische Vorhut befand.
Weiter südlich begannen die vorgeschobenen Teile der 1. SS-Panzerdivision ihren Rückzug im Alpenvorland südlich von Lilienfeld. Auch hier stiessen die sowjetischen Verbände den deutschen Truppen nach, wobei sie sowohl Artillerie als auch Jagdflieger einsetzten. Noch am letzten Tag des Krieges gab es zahlreiche Tote und Verwundete unter der Zivilbevölkerung in der Region. Die Soldaten der Waffen-SS sprengten mehrere Brücken, konnten damit das Vorgehen der Roten Armee jedoch nur geringfügig verzögern. Das reichte aber aus, um mit geringen eigenen Verlusten zurückzuweichen. Die Masse der 1. SS-Panzerdivision befand sich am Morgen des 8. Mai bereits im Verfügungsraum Scheibbs – Puchenstuben. Dort erhielten ihre Verbände und Einheiten den letzten Marschbefehl: Alle Kräfte im Verfügungsraum hatten unverzüglich antretend in den Raum westlich von Steyr zu verlegen. Nach fünf Jahren und acht Monaten im Krieg traten die Soldaten der Division ihren Weg in die Gefangenschaft an.
Vorstoss entlang der Donau
Auf der Bundesstrasse entlang des nördlichen Donauufers stiessen amerikanische Spitzen Richtung Osten vor. Bei ihrem Vormarsch am 8. Mai 1945 hatten sie bei Emmersdorf bereits deutsche Soldaten vom Korps Bünau am südlichen Ufer der Donau mit Granatwerfern bekämpft. In Aggsbach Markt gerieten die US-Soldaten am Vormittag sogar irrtümlich in ein Feuergefecht mit den bereits vor Ort befindlichen Sowjets. Daraufhin zogen sie sich wieder Richtung Westen zurück. Es war die erste Begegnung von amerikanischen und sowjetischen Soldaten während des Zweiten Weltkrieges in Österreich.
Deutsche Soldaten sprengten bei ihrem Rückzug beide Kremser Donaubrücken und die Donaufähren von Spitz und Weissenkirchen. Damit wollte man vor allem Zeit gewinnen und den sowjetischen Vormarsch verzögern, um sich absetzen zu können. Die Rote Armee liess sich davon nicht aufhalten und stiess entlang der Donau weiter vor. In Aggsbach Dorf kam es zu einem Gefecht zwischen den Sowjets und den noch vor Ort befindlichen deutschen Einheiten. Einige Soldaten starben bei dem Feuergefecht, andere versuchten sich über die Donau zu retten. In Melk trafen die entlang der Donau operierenden sowjetischen Kräfte mit jenen Teilen zusammen, die entlang der Bundesstrasse 1 vorstiessen.
Marsch nach Weyer
Ein Teil der vorrückenden Roten Armee marschierte südlich der Bundesstrasse 1 in Richtung Scheibbs. Dabei kam es bei St. Georgen/Leys zu einem Gefecht mit einer Nachhut der 1. SS-Panzerdivision. Kurz darauf kamen die sowjetischen Angriffsspitzen in Scheibbs dem Absetzweg der Leibstandarte gefährlich nahe. Um das Absetzen dieser Division zu ermöglichen, wurden die Spitzen der Roten Armee angeschossen. Das Gefecht, das sich daraus entwickelte und bei dem auch Panzer eingesetzt wurden, dauerte etwa vier Stunden. Nachdem alle Soldaten der Waffen-SS Scheibbs passiert hatten, wurde das Gefecht abgebrochen. Die Kolonne der deutschen Soldaten marschierte weiter entlang der Strecke Gresten – Ybbsitz – Waidhofen/Ybbs. Sie waren nicht die Einzigen, die an diesem Tag auf den Strassen waren. „Während des Rückzuges waren viele Zivilisten mit auf der Flucht. Sie störten oft, doch halfen wir, wo wir konnten. Sie hinderten sehr, doch wir wussten, was ihnen blühen würde. Das hatten wir in Ungarn erlebt“, schildert ein Soldat die Situation der Flüchtlinge.
Als die Soldaten des Divisionsgefechtsstandes, denen Konrad Radner angehörte, am 8. Mai Waidhofen/Ybbs erreichten, ging er zu seinem Vorgesetzten. „Ich habe meinem Kompaniechef gesagt, dass ich nach Hause gehe. Mein Heimatort Zeillern ist nur etwa 20 Kilometer von Waidhofen entfernt. Er sagte zu mir: Ist in Ordnung. Wenn wir mit dem Amerikaner gemeinsam den Russen angreifen, holen wir dich ab. Wir wissen ja wo du wohnst“. In Waidhofen/Ybbs trafen mehrere Wege von der Front zusammen. Neben der Hauptroute über Gresten strömten auch über die Strasse von St. Leonhard Truppen herein, die über Wieselburg und Steinakirchen dorthin gelangten. Auch sie waren auf ihrem Weg in die Stadt in Rückzugskämpfe verwickelt gewesen, um die Sowjets auf Distanz zu halten. In Steinakirchen fielen dabei noch einige Soldaten bei einem Feuergefecht. In Waidhofen/Ybbs trafen die Wege jedoch nicht nur zusammen. Der Marschweg der 1. SS-Panzerdivision teilte sich hier. Ein Teil setzte den Marsch entlang der Strecke Böhlerwerk – Seitenstetten – St. Peter/Au fort, um im Raum Steyr die amerikanische Zone zu erreichen. Eine andere Route führte über Maria Neustift nach Grossraming an die Enns. Die Masse bog jedoch Richtung Süden nach Weyer ab.
Weyer war an diesem Tag das Nadelöhr der zurückweichenden deutschen Truppen und schon von amerikanischen Soldat besetzt, wie ein Soldat berichtet: „Am Ortseingang (…) hatten die Amis einen Vorposten mit einer Kanone aufgestellt. Jedes einzelne Fahrzeug der ewig langen Kolonne musste halten (…)“. Nach dem Ortsausgang von Weyer teilte sich die 1. SS-Panzerdivision noch einmal. Die Masse marschierte entlang des Ennstales nach Norden, um bei Ternberg in die US-Zone zu gelangen. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit auf den völlig überfüllten und verstopften Strassen. Die Angst es gerade nicht mehr über die Demarkationslinie zu schaffen und in sowjetische Gefangenschaft zu geraten, war allgegenwärtig. Viele Soldaten liessen ihre Fahrzeuge stehen und versuchten zu Fuss weiterzukommen. Die Division, die bis dahin einigermassen geschlossen blieb, drohte nun auseinanderzufallen. Als der 8. Mai zu Ende ging, standen viele deutsche Soldaten noch immer in der Kolonne östlich der Enns.
„Wir erreichten im Laufe des 9. Mai die Enns bei Weyer. Hier stürzten wir unsere restlichen vier Panzer IV in die Enns und marschierten nur noch mit unseren Räderteilen weiter. Da der Iwan [die Rote Armee] bereits auf Steyr vorgerückt sein sollte, drehten wir ostwärts der Enns nach Süden ab, um nach etwa 40 bis 50 km in Altenmarkt in amerikanische Gefangenschaft zu gehen“. Beschreibt ein Soldat seinen Weg in die US-Zone. Bereits davor hatten deutsche Soldaten diesen Weg eingeschlagen. Was die meisten von ihnen nicht wussten: die US-Armee nahm die Vereinbarung mit den Sowjets, die Demarkationslinie zu schliessen nicht überall gleich ernst.
Das letzte Gefecht zwischen Amerikanern und Deutschen
Nicht nur die Sowjets stiessen am letzten Kriegstag vor. Auch amerikanische Truppen begannen ihren Vormarsch mit Aufklärungskräften – jedoch in die andere Richtung. Das verlief nicht immer friedlich. In Ennsdorf kam es zu den letzten Gefechten zwischen deutschen und amerikanischen Truppen. Seit dem 6. Mai waren bereits alle Stützpunkte in und um Ennsdorf von der Waffen-SS besetzt. Diese traf Vorbereitungen zur Verteidigung, baute Unterstände aus und brachte Feldgeschütze sowie Fliegerabwehrkanonen-Batterien in Stellung. Diese Stellungen konnten vom Ennser Schlossberg aus eingesehen werden und lagen deshalb am 7. Mai ab 0800 Uhr morgens unter dem Feuer amerikanischer Artillerie. „Amerikanische Beobachter befinden sich in Flugzeugen über Ennsdorf. Das Gefecht dauert auch tagsüber an und es gibt Granateneinschläge im Ort. Um 1500 Uhr treffen sich SS- und Ami-Offiziere in der Mitte der Ennsbrücke. Die Verhandlungen werden aber nach wenigen Minuten ohne Ergebnis abgebrochen“. Ab 1900 Uhr wird der Ort bis Mitternacht mit Granatwerfern beschossen. Als das Steilfeuer verstummte, versuchten US-Soldaten über die Ennsbrücke zu stossen, was ein deutsches Maschinengewehrverhinderte. Die Angreifer gingen daraufhin zurück und setzten erneut Granatwerfer ein, die bis etwa 0200 Uhr feuerten.
„Die deutschen Truppen hatten sich in der Zwischenzeit in die Wälder östlich von Ennsdorf zurückgezogen. Um etwa 0300 Uhr dringen amerikanische Soldaten in den Ort ein. Sie werden dabei von den Soldaten am Waldrand bekämpft“. Die Verteidiger setzten sich daraufhin ab. Die US-Soldaten blieben bis zum Eintreffen der Roten Armee am 9. Mai im Ort. Erst dann zogen sie sich über die Brücke zurück, die später zu einem Symbol der Besatzungszeit werden sollte.
Konrad Radner trat seinen letzten Marsch im Krieg an. Nur wenige Soldaten aus seiner Division hatten das Glück, in der Nähe der zusammenbrechenden Front zu wohnen. Er nutzte die Chance und versuchte, sich entlang der Ybbs in seinen Heimatort durchzuschlagen. In Sonntagberg tauschte er die Uniform mit einem Knecht, den er zufällig traf, gegen Zivilgewand. Er sah damit aus wie jemand, der gerade von der Feldarbeit zurückkam. Viele Soldaten taten es so wie er. Manche trugen Rechen, Heugabeln oder ähnlichem Geräte, um so unauffällig wie möglich zu wirken. Dieser Trick funktionierte fast immer: Falls die nun ehemaligen Soldaten auf Sowjets trafen, wurden sie von diesen meistens ignoriert. In den Morgenstunden des 8. Mai 1945, nach der Einnahme von Ennsdorf durch die US-Armee, begann sich der Ort mit Flüchtlingen und endlosen Kolonnen der Deutschen Wehrmacht zu füllen. An ihnen vorbei fuhr ein verminderter Aufklärungszug des 261. Regimentes der 65. US-Division die Bundesstrasse 1 entlang nach Osten. Der Zug hatte den Auftrag, Kontakt mit der Roten Armee herzustellen. In den Mittagstunden erreichten sie Amstetten, wo sie auf dem Hauptplatz, zwischen den Soldaten der Wehrmacht, auf die Sowjets warteten. Dort wurden sie versehentlich das Ziel eines russischen Angriffes mit Jagdbombern, aufgrund dessen sie ihre Mission abbrachen.
Ihr Auftrag war schon hinfällig geworden. Südlich von Melk war bereits ein Aufklärungsflugzeug mit zwei Offizieren gelandet, die denselben Auftrag hatten: Verbindungsaufnahme mit der sowjetischen 7. Gardeluftlandedivision; jener Division, die entlang der Bundesstrasse Richtung Westen vorstiess. Am späten Nachmittag trafen ihre Spitzen in Strengberg mit amerikanischen Vorhuten des 261. Regimentes der 65. Division zusammen.
Am 8. Mai waren mehrere amerikanische Aufklärungselemente im heutigen Bezirk Amstetten unterwegs. Auch in Stadt Haag, Haidershofen, Kürnberg, St. Pantaleon, St. Peter/Au oder Stephanshart trafen US-Soldaten noch vor der Roten Armee ein. Behamberg bei Steyr war in der Früh noch in deutscher Hand und wurde dann von amerikanischen Soldaten besetzt, die zuvor noch in einem Feuergefecht einen deutschen Panzer abgeschossen hatten. Als die US-Soldaten wenig später wieder hinter die Enns zurückgingen, übernahmen deutsche Truppen noch einmal die Kontrolle im Ort. Erst kurz bevor die Rote Armee eintraf, verliessen sie Behamberg, um sich den amerikanischen Truppen, gegen die sie noch am Vormittag gekämpft hatten, zu ergeben.
Das letzte Gefecht zwischen Sowjets und Deutschen
„Die Truppenmassen, die unseren Raum durchfluteten, müssen bis um Mitternacht des 8. Mai die Enns passiert haben. Dass sich dieser Rückzug zu einer Flucht auf Leben und Tod verwandelte war verständlich. (…) Viele Soldaten, die bisher heil durchgekommen waren, fanden kurz vor dem Ende den Tod“, erinnert sich ein Zeitzeuge. Einen Einblick in die Stimmung am letzten Tag des Krieges gibt die Situation in Göstling, etwa 20 km südöstlich von Waidhofen/Ybbs: „In den letzten Tagen vor dem Zusammenbruch waren die Strassen von zurückflutendem Militär belagert und verstopft. Am 8. Mai war nicht einmal ein Gehen auf der Strasse möglich. Erst in der Nacht (…) flaute allmählich der Rückzug der deutschen Truppen ab, und am 9. Mai herrschte eine unheimliche Stille“. In den Morgenstunden des 9. Mai war es auch in Waidhofen/Ybbs still geworden. Um 0915 Uhr fuhr der erste sowjetischen Panzer in die Stadt. „Wir sind zu dritt am Strassenrand hinter einer Mauer gelegen. Um etwa 9 Uhr (…) sind die ersten Russen aufgetaucht. Sie sind von der Ybbsitzerstrasse (…) gekommen. (…) Dann sind wir heruntergegangen [nach Hause] und haben gesagt: ‚Sie sind da!’”. Die Masse der sowjetischen Streitmacht erreicht die Stadt ab etwa 1030 Uhr. Es waren berittene Kräfte, denen gepanzerte Fahrzeuge und Nachschubelemente folgten.
Die Stille in der Stadt währte nicht lange. Bei der Ortsausfahrt Richtung Weyer fielen Schüsse. Dort war die schwere Panzerabteilung 501 der 1. SS-Panzerdivision in Stellung gegangen. Sie hatte den Befehl, den Rückzug der Division gegen die Sowjets zu decken. „Gegen Mittag kamen die letzten Soldaten und Zivilisten (…) und berichteten uns, dass hinter ihnen bereits der Iwan [die Sowjets] mit Panzern und aufgesessener Infanterie Waidhofen erreicht habe“. Die Soldaten der Abteilung stellten ihre Panzer auf die Strasse und die Wiese, sprengten sie und sperrten so die Bewegungslinie nach Weyer.
Als die Sowjetsoldaten die Strassenenge neben der Pfingstmannmauer erreichten, kam es zu dem Gefecht, das etwa zwei Stunden dauerte. Die Nachspitze der deutschen Truppen kämpfte gegen die sowjetische Soldaten, die erst kurz davor in der scheinbar friedlichen Stadt angekommen waren. „Ich war damals ein Kind und bin im Haus gesessen. Ich kann mich daran erinnern, dass an dem Tag geschossen wurde“, erinnert sich ein Zeitzeuge. Was er und die restlichen Bewohner des Hauses neben der Pfingstmannmauer hörten, waren die letzten Schüsse des Zweiten Weltkrieges auf österreichischem Boden. Die Frist für das Überschreiten der Enns war abgelaufen und dennoch kämpften die Soldaten der Waffen-SS, um die Rote Armee auf Distanz zu halten. Ein Gespräch, das zwischen einem Offizier der US-Armee und einem Parlamentär der 1. SS-Panzerdivision, das am 8. Mai hinter der Frontlinie stattfand, erklärt warum.
Die vergessene Brücke
„Ich fragte ihn, mit der Karte in der Hand, wann die Brücken über die Enns gesperrt würden. Der Oberst fuhr mit seinem Zeigefinger über die Karte (…)“. Bei der Brücke nördlich von Ternberg blieb der Finger des Offiziers der US-Armee stehen und er sah den deutschen Offizier starr an. „Ich deutete noch einmal auf die Brücke, um mich zu vergewissern (…), dass es die von Ternberg sei. Er sah mich wieder an. Ich hatte endgültig verstanden“. Die Brücke bei Ternberg blieb einen Tag länger offen, als es das eigentliche Abkommen vorsah. Sie wurde „vergessen“, damit sich die Soldaten der 1. SS-Panzerdivision auf diesem Weg in die US-Zone absetzen konnten. Diese Information dürfte auch die Marschroute der Division bestimmt haben. Die Brücke in Ternberg war aber nicht die einzige Möglichkeit, um noch nach dem Ablauf der Frist über die Enns zu gelangen. Auch bei Altenmarkt konnte die amerikanische Linie überschritten werden.
Am Morgen des 9. Mai ergaben sich auch die Soldaten der 3. SS-Panzerdivision, die bei Königswiesen und Grein kämpften, den amerikanischen Truppen. Hier nahm es die US-Armee jedoch genauer. Sie nahmen die Soldaten der Waffen-SS zwar gefangen, lieferten sie aber den Sowjets aus. Die Verteidigung in dem Raum nahm nicht nur den Soldaten dieser Division die Chance, in amerikanische Kriegsgefangenschaft zu gelangen. Auch allen anderen, östlich dieser Verteidigungslinie eingesetzten deutschen Truppen war der Weg dorthin versperrt.
Konrad Radner ging einen anderen Weg. Als am 9. Mai in Waidhofen/Ybbs die letzten Schüsse fielen, hatte er bereits die erste Nacht bei seiner Familie verbracht. Er war seit den Abendstunden des Vortages daheim. Nur wenige Kilometer, bevor er zu Hause ankam, traf er auf Soldaten der kurz zuvor eingetroffenen Roten Armee. Sie sahen ihn aus der Ferne und eröffneten das Feuer auf den ehemaligen Soldaten. Ein letztes Mal in diesem Krieg musste er sich vor gegnerischen Geschossen in den Strassengraben werfen und hoffen, zu überleben. Er hatte auch dieses Mal Glück. Die Soldaten der Roten Armee kümmerten sich nicht weiter um ihn und fuhren davon. Nur noch zwei Kilometer trennten ihn von seinem Geburtshaus. Eine halbe Stunde später war der Krieg für ihn vorbei.
Vogelscheuchen
Die letzte militärische Aktion der Heeresgruppe Ostmark führte den Grossverband in die amerikanische Kriegsgefangenschaft. Etwa 600’000 der insgesamt 800’000 Mann dieses Grossverbandes kamen in der US-Zone an. Die restlichen 200’000 Soldaten konnten sich auf unterschiedlichste Weise der Gefangenschaft entziehen, nur wenige gelangten in die Hände der Roten Armee.
„Die Soldaten warfen ihre Uniformen weg. Fast jeder hatte Zivilgewand im Gepäck. Wer nichts hatte, zog die Vogelscheuchen aus. Dementsprechend schäbig sahen viele der ehemaligen ‚Elitesoldaten’ dann aus. Auf der einen Seite des Hügels kamen sie als Soldaten an, auf der anderen Seite gingen sie als Zivilisten hinunter“. Die Bauern, bei denen sich die Soldaten der Waffen-SS ihrer Uniformen und Ausrüstungsgegenstände entledigten, hatten Angst, dass die Rote Armee diese bei ihnen finden würde. „Mein Grossvater hat mehrere Schubkarren mit Uniformen und Waffen in einen Teich beim Haus geschüttet“. Noch Jahre später wurden in verlassenen Hütten im Alpenvorland die Reste von deutschen Uniformen gefunden.
Die Sowjets behaupteten „praktisch keine Gefangenen gemacht zu haben. Sie forderten die Auslieferung aller Angehörigen der Heeresgruppe (…) und behaupteten, dass ihnen dies nach den Übergabebestimmungen zustünde“. Die Amerikaner lehnten das grossteils ab. Gemäss dem Übergabeabkommen zwischen den Sowjets und des Westalliierten hätte sich jede Truppe in die Gefangenschaft jenes Gegners begeben müssen, gegen den sie zuletzt gekämpft hat.
Fazit
Das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa zwischen der Enns und St. Pölten zeigt die strategische Bedeutung dieses Raumes. Im Kalten Krieg zwischen den kommunistischen Staaten im Osten und den demokratischen im Westen erlangte er neuerlich eine besondere Rolle. Hier befindet sich die einzige leistungsfähige Ost-West-Verbindung zwischen den Alpen und dem böhmischen Massiv. Es ist kein Zufall, dass die österreichische Raumverteidigungsstrategie die Region um Amstetten als das Entscheidende Gelände beurteilte, um einen möglichen Angriff des Warschauer Paktes abzuwehren. Die Engstelle der einzigen leistungsstarken Verkehrsverbindung zwischen dem böhmischen Massiv und dem Südrand der Alpen hätte dort so lange wie möglich verteidigt werden sollen.
Weitergekämpft bis fünf nach zwölf
(Der Autor: Felix Römer, Jahrgang 1978, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut London)
Der Krieg verloren, der Glaube an den „Führer“ dahin: Warum wehrte sich Deutschland 1945 so blindwütig gegen eine unabwendbare Niederlage? Die Antwort muss man in der Wehrmacht selbst suchen.
An diesem Freitag vor 70 Jahren und fünf Tagen kam mein Grossvater um: In den frühen Morgenstunden des 3. Mai 1945 verblutete der 36 Jahre alte Obergefreite Erwin Römer in der Nähe einer kleinen bayerischen Ortschaft am Waginger See, die einen Tag später kampflos von der US-Armee besetzt wurde. Er war einer von mehr als 95 000 deutschen Soldaten, die noch in den letzten acht Tagen des Zweiten Weltkriegs den Tod fanden – ein Sinnbild für den irrwitzigen Kampf der Wehrmacht im Frühjahr 1945.
Bis heute scheint dies schwer verständlich zu sein: Warum verteidigten die Deutschen das untergehende NS-Regime noch so lange und nahmen dafür so viel Tod und Zerstörung in Kauf? Die historische Forschung sieht den entscheidenden Faktor nicht mehr in der NS-Ideologie, stützt aber auch kein neues Opfernarrativ.
Kein Staat wehrte sich jemals so blindwütig gegen eine unabwendbare Niederlage wie das NS-Regime im Frühjahr 1945. Der Krieg war längst entschieden, dennoch starben in keiner Phase so viele Soldaten wie in diesen letzten Monaten. Der Januar 1945 wurde mit 450 000 Toten zum verlustreichsten Monat des gesamten Zweiten Weltkriegs, und bis zu dessen Ende fiel eine weitere Million. Hinzu kam der Tod aus der Luft, der seit September 1944 neue Dimensionen annahm: In den letzten acht Monaten fielen etwa drei Viertel aller Bomben des ganzen Krieges.
Die Endphase des Krieges liess für die Deutschen alles andere verblassen
Ausser immer grösseren Verwüstungen erlebten die Deutschen den Terror des NS-Regimes, Hunger und Not, Flucht und Vertreibung. Die letzten Kriegsmonate waren eine solch einschneidende Erfahrung, dass in der Erinnerung der Deutschen nach 1945 zunächst alles andere verblasste – einschliesslich der Gewalt, die zuvor von ihnen selbst ausgegangen war. Die überragende Rolle der Endphase im Gedächtnis der Nachkriegszeit sprach noch aus Richard von Weizsäckers wegweisender Rede von 1985.
Die Katastrophe war absehbar, denn die Ausgangslage zum Jahresbeginn 1945 war hoffnungslos. Die Wehrmacht war nur noch auf dem Papier stark. An Truppen, Waffen und Material waren ihr die Gegner um ein Vielfaches überlegen. In Ostpreussen standen die deutschen Einheiten teilweise einer zwanzigfachen Übermacht der Roten Armee gegenüber. Gleichzeitig kompensierte die Wehrmacht ihre Verluste mit hastig aufgestellten Verbänden aus überwiegend unerfahrenen und schlecht ausgebildeten Rekruten. Für eine moderne Kriegführung fehlten fast alle Voraussetzungen: Die alliierte Luftoffensive gegen die deutsche Treibstoffproduktion legte seit Frühjahr 1944 nicht nur die Luftwaffe, sondern zunehmend auch das Heer lahm. Seit Frühsommer 1944 besassen die Alliierten die absolute Luftüberlegenheit.
An der Ostfront kämpften Wehrmacht, SS und Volkssturm deutlich aufopferungsvoller als im Westen. Nur ein Beispiel: Bei der Auflösung des Ruhrkessels im April 1945 etwa ergaben sich die meisten der mehr als 300’000 eingeschlossenen Wehrmachtssoldaten der US-Armee. Fast um dieselbe Zeit lieferten sich die bei Halbe südlich von Berlin eingekesselten Truppen erbitterte Kämpfe mit der Roten Armee – bei den verzweifelten Ausbruchsversuchen kamen wohl 60 000 von ihnen ums Leben.
Nicht alle Soldaten marschierten wie Lemminge in den Untergang
Der andere Kriegsstil war letztlich eine Folge der deutschen Vernichtungspolitik in der Sowjetunion und der wechselseitigen Eskalation der Gewalt zwischen Wehrmacht und Roter Armee seit 1941 – hierbei spielten auch ideologisierte Feindbilder eine Rolle, die von der NS-Propaganda geschürt wurden. Insbesondere an der Ostfront glaubten die Soldaten, das Vaterland verteidigen zu müssen, auch wenn sie es dabei zerstörten.
Bis fünf nach zwölf kämpfte die Wehrmacht indes nur stellenweise: Der Widerstand war am Anfang vom Ende besonders stark und liess dann tendenziell nach. Im Vorfeld des Rheins und am Westwall war der Widerstand der deutschen Truppen noch deutlich zäher als nach der alliierten Rheinüberquerung im März. Als die Westalliierten anschliessend durch die aufgerissene Front vorstiessen, leisteten viele Soldaten nur noch scheinbar Widerstand – eine reelle Alternative zur Desertion, die massenhaft genutzt wurde. Dasselbe Muster zeigte sich jetzt sogar an der Ostfront. Nicht alle Soldaten marschierten also wie Lemminge in den Untergang.
Gleichwohl: Auch nach dem Rheinübergang kam es vielerorts zu heftigen Gefechten. Die zusammengewürfelten Truppen der 19. Armee leisten während der ersten drei Aprilwochen so ernsthaften Widerstand, dass viele Ortschaften in Baden dabei dem Erdboden gleichgemacht wurden. Das Verhalten der Truppen wurde immer uneinheitlicher: Manche Einheiten kapitulierten schnell, während andere unter hohen Verlusten verbissen weiterkämpften. Entscheidend waren die Verhältnisse vor Ort – der Zustand, die Ausrüstung, die Zusammensetzung und nicht zuletzt das Führungspersonal der Einheiten.
Niemand fiel Hitler in den Arm
Dass überhaupt noch gekämpft wurde, lag in erster Linie an Hitler und den NS-Führungseliten. Wie der britische Historiker Ian Kershaw dargelegt hat, bedingten die zersplitterten Machtstrukturen des NS-Staates, dass niemand Hitler in den Arm fiel. Anders als im faschistischen Italien gab es keine Instanzen, die den Willen des „Führers“ infrage stellen konnten. Zudem war das Dritte Reich fester denn je im Griff der NSDAP und der SS. Die Gauleiter beherrschten ihre Provinzen so machtvoll wie nie – mit dem militärisch wertlosen „Volkssturm“ bekamen sie hierfür noch ein zusätzliches Kontrollinstrument in die Hand. Obwohl die NSDAP immer verhasster wurde, war die Bevölkerung immer stärker auf den Parteiapparat angewiesen, je mehr Verwüstung, Not und Apathie um sich griffen.
Besonders grossen Anteil an der Katastrophe hatte allerdings die Militärführung. Hitlers Choreografie des Untergangs wäre ein Hirngespinst geblieben, wenn seine Generäle ihm nicht bis zuletzt Gehorsam geleistet hätten.
Die vom Historiker Sönke Neitzel entdeckten Gespräche unter den Generälen in alliierter Gefangenschaft zeigen zwar, dass sie tief gespalten waren. Das änderte aber nichts daran, dass die meisten von ihnen die absurde Kriegführung an der Front weiter mittrugen. Mit ihren Kriegsgerichten und Feldgendarmen trugen sie ausserdem massgeblich zum Durchhalte-Terror bei. Die professionelle Deformation der Generalität im Nationalsozialismus offenbarte sich jetzt in horrender Verantwortungslosigkeit gegenüber den eigenen Soldaten. Das NS-Regime brach nur deshalb nicht früher zusammen, weil die Generäle es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren konnten, Befehlen zuwiderzuhandeln – obwohl sie vom NS-Terror selbst kaum betroffen waren. Nach 1945 schoben sie alle Verantwortung auf Hitler und erreichten durch viele Verdrehungen, dass sie von ihren Zeitgenossen in der Bundesrepublik weiter als Ehrenmänner angesehen wurden.
Die Soldaten kämpften weiter, weil sie es gewohnt waren
Auf den unteren Ebenen hielt der Terror die Truppen bei der Stange. Seit Februar und März 1945 wurde er immer drakonischer. Wohl bis zu zehntausend Wehrmachtssoldaten wurden in der Endphase von den Standgerichten exekutiert – jeder wusste, dass Fahnenflucht lebensgefährlich war. Dies trug wesentlich dazu bei, dass es kein neues 1918 gab: Die Wehrmachtsführung registrierte, dass die Moral zwar schwand, die Soldaten aber weiter mitzogen.
Der Terror erklärt jedoch nicht alles. In den abgehörten Gesprächen unter den Wehrmachtssoldaten in alliierter Gefangenschaft kam er auffallend selten vor. Und viele Einheiten bewiesen an der Front noch deutlich mehr Einsatzbereitschaft, als zur Wahrung des Scheins notwendig war. Die meisten Soldaten kämpften jedoch nicht mehr aus ideologischem Fanatismus: Die wenigsten glaubten jetzt noch an einen deutschen Sieg. Die letzten Hoffnungen zerschlugen sich im Januar und Februar. Auf die Parolen vom „Endsieg“ und den „V-Waffen“ hörte im Frühjahr 1945 nur noch eine kleine Minderheit. Dasselbe galt für den Hitlermythos: Noch 1944 hielt die Mehrheit in der Wehrmacht weiterhin zu Hitler, doch nach dem Jahreswechsel war der Glaube an den „Führer“ dahin. Die Soldaten kämpften auch ohne Überzeugungen weiter – schon deshalb, weil sie es gewohnt waren.
Einfach weiterzumachen war naheliegend, zumal der Gruppendruck in der Wehrmacht nicht aufhörte, als sich Sozialgefüge und Kameradschaft Anfang 1945 auflösten. Die Soldaten setzten sich jedoch auch aus eigenem Antrieb ein. Entscheidend war, wie unzählige Selbstzeugnisse belegen, die starke Identifikation mit den geltenden Soldatentugenden, mit Pflichterfüllung, Tapferkeit und Härte. Auch der spätere Bundeskanzler Helmut Schmidt führte seine Wehrmachtseinheit im Februar 1945 mit grosser Hingabe.
Pervertierte Wertevorstellungen liessen viele durchhalten
Noch in den Kriegsgefangenenlagern schwärmten Männer von ihren Waffentaten und Orden und rechtfertigten sich für ihre Gefangennahme, während Deserteure als Feiglinge verachtet wurden. Es bedurfte daher an vielen Stellen gar keiner NSDAP-Funktionäre, damit Ortschaften noch verteidigt wurden – dazu drängten die Offiziere meist schon von sich aus.
Bis zuletzt verfügten die NS-Streitkräfte über ein Korsett von motivierten Offizieren und Unteroffizieren, unter ihnen nicht wenige politische Soldaten. Diese Männer bildeten das Rückgrat der Wehrmacht – häufig lag es an diesen abgebrühten Kämpfern, wenn die kriegsmüden Truppen nicht aufgaben. Für die eingefleischten Soldaten, die in der Wehrmacht das Sagen hatten, war das Kämpfen längst eine Selbstverständlichkeit – sodass auch nicht alle wie traumatisierte Gespenster aus dem Krieg zurückkehrten, so wie es der Film „Unsere Mütter, unsere Väter“ zeigt.
Der sinnlose Kampf der Wehrmacht im Frühjahr 1945 war ihr nicht bloss aufgezwungen, sondern speiste sich auch aus ihr selbst. Dies lag jedoch weder an reiner NS-Ideologie noch an purem Professionalismus. Massgeblich war etwas dazwischen – die militärischen Wertvorstellungen, denen die Nationalsozialisten seit 1933 höhere Geltung denn je verschafft hatten. Unzählige Soldaten lebten diese ideologisch angehauchten Werte, ohne unbedingt ideologische Fanatiker zu sein. Für das Geschehen von 1945 war das entscheidender als die Kontrastierung von Opfern und Tätern, um welche die heutige Erinnerungskultur weiter kreist.
Rundfunkpropaganda im Zweiten Weltkrieg
Beginn und Ende
Der Zweite Weltkrieg begann in Europa mit einem fingierten, angeblich polnischen Überfall auf den Sender Gleiwitz am Abend des 31. August 1939. Die deutsche Bevölkerung wurde am nächsten Tag stündlich durch Rundfunksondermeldungen unterrichtet, dass der Führer Adolf Hitler daher der Wehrmacht befohlen habe, in Polen einzumarschieren. Seit 5:45 Uhr werde „jetzt zurückgeschossen!“.
So, wie der Zweite Weltkrieg mit einer Lüge im Rundfunk begonnen hatte, so wurden bis zum Schluss des Krieges über den deutschen Rundfunk Unwahrheiten verbreitet. Am 1. Mai 1945, abends, gab der Rundfunksprecher des Hamburger Reichssenders bekannt, dass der Führer Adolf Hitler in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen sei. In Wahrheit entkam Hitler seiner möglichen Gefangennahme, indem er Selbstmord beging. Im Anschluss an diese Lüge wurde eine Rede von Dönitz gesendet, in welcher dieser wahrheitswidrig sagte, der Tod habe den Führer „an der Spitze seiner Truppen“ ereilt.
Sender
Pünktlich zu Kriegsbeginn wurde mit der Verordnung über ausserordentliche Rundfunkmassnahmen das Abhören ausländischer Sender verboten. Die einzelnen Reichssender waren bereits am 1. Januar 1939 zum Grossdeutschen Rundfunk vereinigt worden und strahlten ab Juni 1940 nur noch zwei Vollprogramme aus. Marschmusik statt Tanzmusik und ständige Lageberichte von der Kriegsfront dominierten. Es begann das Wunschkonzert für die Wehrmacht – die Brücke zwischen Heimat und Front. U. a. sollten Marlene Dietrich und Hans Albers den Soldaten Mut und Kraft zum Weiterkämpfen geben.
Nach Kriegsbeginn ging der Goebbels-Vertraute und neu ernannte Leiter der Rundfunkabteilung des Propagandaministeriums, Alfred-Ingemar Berndt, daran, die Rundfunklandschaft den Erfordernissen der Kriegsführung anzupassen. Ein Grossteil des journalistischen und technischen Personals wurde in die Propagandakompanien der Wehrmacht eingezogen, die Sendepläne wurden ausgedünnt. Etwa ab Mitternacht bis zum Sendebeginn um 5.00 oder 6.00 Uhr morgens war eine Sendepause. Diese wurde durch das Programm des Deutschlandsenders ausgefüllt, der mittags um 12.30 Uhr mit seinen Sendungen begann, die nach den Frühnachrichten endeten.
Ende 1942 gab es bereits 16 Millionen deutsche Rundfunkteilnehmer. Zur gleichen Zeit zeigte sich die oft lebenswichtige Aktualität des Mediums Rundfunk: Die ersten Meldungen über angreifende Bomberverbände scheuchten die Menschen in die Luftschutzkeller. Das Radio brachte im Dauerbetrieb Luftlage- und Kriegsberichte.
Im Zweiten Weltkrieg war die BBC (mit 11.500 Mitarbeitern in London) neben Radio Beromünster (siehe unten) eine wichtige ausländische Informationsquelle für Millionen Radiohörer in Europa. Die BBC konnte über den leistungsstarken Sender Droitwich bis weit nach Mitteleuropa auf der Mittel- und Langwelle gehört werden. In Deutschland und den besetzten Ländern bedrohte die Verordnung über ausserordentliche Rundfunkmassnahmen das Hören sogenannter Feindsender mit schweren Strafen.
Bereits eine Woche nach Kriegsbeginn wandte sich Jan Masaryk über die BBC an seine Landsleute in der Heimat. Damit begann die BBC ein tägliches 15-minütiges Programm auf Tschechisch auszustrahlen, dessen Mithören vom deutschen Besatzungsregime unter Androhung der Todesstrafe verboten war.
Dagegen war in Grossbritannien das Hören deutscher Sender erlaubt. Während des Krieges nahm die Anzahl der Propagandasendungen in allen beteiligten Ländern zu. Auf deutscher Seite wurden britische und amerikanische Immigranten, die mit der NS-Politik sympathisierten, engagiert, um Briten auf Englisch anzusprechen. Eine Moderatorin war „Axis Sally“, deren Sendungen vom Grossdeutschen Rundfunk ausgestrahlt wurden. Goebbels lancierte ausserdem den Auslandsrundfunksender „Germany Calling“ in Norddeich, dessen Moderatoren, vor allem der irisch-US-amerikanische Nationalsozialist William Joyce sowie Wolf Mittler und Norman Baillie-Stewart unter dem Spitznamen „Lord Haw-Haw“ bekannt wurden. Der US-amerikanische Rundfunkjournalist Edward R. Murrow kreierte 1940 eine neue Sendeform, indem er in Livereportagen für die CBS direkt aus dem von der Luftwaffe bombardierten London berichtete. Seine Sendungen „This is London“ fesselten Millionen Zuhörer in den USA an die Radiogeräte und trugen dazu bei, die isolationistische Stimmung in den USA zurückzudrängen. Von März 1941 bis zum Kriegsende wurde Thomas Manns monatliche Radiosendung Deutsche Hörer! von der BBC über Langwelle auch in das deutsche Reichsgebiet ausgestrahlt. Etwa 25 % deutsche Hörer hörten heimlich zu. Hitler selbst beschimpfte in einer Rede im Münchner Hofbräuhaus den Autor als jemanden, der das deutsche Volk gegen ihn und sein System aufzuwiegeln versuche. Das vom deutschen Soldatensender Belgrad seit August 1941 ausgestrahlte Lied „Lili Marleen“ wurde jeden Abend von Millionen Soldaten in ganz Europa und Nordafrika, und ab Januar 1942 auch von alliierten Soldaten in einer englischen Fassung, gehört, bis es im April 1942 von Joseph Goebbels verboten wurde, weil dieser von Lale Andersens Kontakten zu Schweizer Juden erfahren hatte. Im Mai 1942 sendete BBC erstmals glaubwürdige Berichte über die Ermordung polnischer Juden. Generalfeldmarschall Paulus sprach nach der Niederlage von Stalingrad über Radio Moskau zu deutschen Hörern. Auf dem U-Boot U 96, auf dem Lothar-Günther Buchheim Ende 1941 als Kriegsberichterstatter eine Feindfahrt mitmachte, wurden regelmässig britische, US-amerikanische oder russische „Feindsender“ abgehört.
Auch Störsender wurden eingesetzt, um unerwünschte „Feindpropaganda“ zu verunmöglichen oder eigene Propaganda im Programm eines Feindsenders zu platzieren, wie zum Beispiel in Hitlers letzter Silvesteransprache.
Relevanz
Die Sendungen der BBC, der „Stimme Amerikas“, des NFD, von Radio Moskau, Radio Vatikan und dem Schweizer Sender Beromünster führten zwar dazu, dass 16 Millionen deutsche Haushalte, die (1943) Rundfunkgebühren zahlten, hinreichend über die zunehmend hoffnungslose militärische und politische Lage Deutschlands informiert sein konnten. Keinem Sender gelang es, eine mehrheitlich kritische Meinung gegenüber dem Regime in Deutschland herbeizuführen. Wie viele Deutsche heimlich BBC, die umfangreichste ausländische Informationsquelle, hörten, lässt sich nicht sagen. Schätzungen schwanken zwischen einer und zehn Millionen Hörern. In Berlin lag die Quote der BBC bei den verurteilten Rundfunkverbrechern bei 64 %. In Süddeutschland hatten 61% der Verurteilten den Sender Beromünster gehört. Die absoluten Zahlen der Rundfunkverbrechen waren eher gering.
Sofern jemand sein dadurch erworbenes Wissen nicht weitererzählt hatte, wurde das „Verbrechen“ von der Kripo häufig wie ein Kavaliersdelikt behandelt und mit der Beschlagnahme des Volksempfängers geahndet. Andernfalls konnte es geschehen, dass der Hörer von der Kripo als „Hauptübeltäter dieser Zersetzung“ festgenommen wurde und die Staatsanwaltschaft den Vorgang dem Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof in Berlin vorlegte. Weil das Hören von sogenannten Feindsendern streng verboten war, gab fast niemand, der aus dem Radio Bescheid wusste, sein Wissen an andere weiter – wenn doch, konnte ihm sogar „in besonders schweren Fällen“ die Todesstrafe drohen. Zum Beispiel hörten drei sogenannte „Vierergruppen“ 1941 gezielt feindliche Sender ab, verbreiteten deren Informationen und wurden deswegen vom Volksgerichtshof verurteilt.
Die wöchentlichen, jeden Freitagabend ausgestrahlten Berichte in der „Weltchronik“ von Jean Rudolf von Salis über den Schweizer Sender Beromünster galten Millionen von Hörern in Mitteleuropa als objektive Beurteilung der politischen und militärischen Lage in Europa. Allerdings urteilte er schwer nachvollziehbar milde über das Dritte Reich, erwähnte die Ermordung der Juden nur am Rande und kommentierte sie schon gar nicht. Die Weltchronik war keineswegs der „beherzte Akt des Widerstands“, als die sie später gerne hingestellt wurde. Sicher ist aber, dass es dem Nazi-Regime nicht gelungen ist, seine Sicht der Dinge vollständig durchzusetzen. In Frankreich wurde Charles de Gaulle, von der Vichy-Propaganda als Le Général micro verspottet, eine wichtige Stimme für viele französische Radiohörer.
Der britische Soldatensender Calais (Leiter: Sefton Delmer) war so gut aufgestellt, dass er über einen langen Zeitraum von der deutschen Bevölkerung für einen Wehrmachtssender gehalten wurde. Die fast perfekte Tarnung gelang, indem bei den Deutschen beliebte Musik, Sportergebnisse und Berichte über Ereignisse in Deutschland gesendet wurden. Gelegentlich wurden aber auch moralzersetzende Informationen eingestreut. Beispielsweise wurde das geflügelte Wort „Wenn das der Führer wüsste“, in Deutschland spätestens seit 1938 bekannt, in dessen Sendungen so geschickt verwendet, dass die geschilderten Missstände glaubhaft erschienen. Hitler wurde nie persönlich angegriffen, immer nur Leute aus seiner Umgebung. Beliebt war auch Frau Wernicke, die in den Sendungen der BBC eine Berliner Kleinbürgerin darstellte, die sich mit ihrem einfachen Gemüt, lockeren Tonfall und gesunden Menschenverstand scharfzüngig über die Nazis lustig machte.
Als nach der Niederlage in Stalingrad die BBC die Nachricht verbreitet hatte, dass Moskau die Gefangennahme von 91.000 deutschen Soldaten gemeldet hatte, war der Schock über diese Niederlage unbeschreiblich. Danach glaubten fast nur noch fanatische Nationalsozialisten, dass der Krieg gewonnen werden könne. Ausserdem hatte Joseph Goebbels vorher den heroischen Heldentod aller deutschen Soldaten in Stalingrad verkündet und war so öffentlich als Lügner entlarvt worden. Bei Kriegsende berichtete Edward Murrow (siehe oben) in für viele Zuhörer ungewohnt schonungsloser Weise von der Befreiung des KZ Buchenwald: Er beschrieb den Zustand der Überlebenden und die Leichenberge, „aufgestapelt wie Holzscheite“.
Die deutschen Wehrmachtberichte als Sonderform der Propaganda
Den täglichen Ankündigungen „Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt“ folgte vom ersten Tag des Polenfeldzuges bis zur bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht eine Zusammenfassung der Kampfhandlungen. Diese Wehrmachtberichte wurden von der Abteilung für Wehrmachtpropaganda im Wehrmachtführungsstab des OKW herausgegeben und im Grossdeutschen Rundfunk um die Mittagszeit vor den folgenden Nachrichten ausgestrahlt. Hinzu kamen im Radio mit Fanfarenstössen eingeleitete Sondermeldungen über herausragende Erfolge mit zusätzlichen Erwähnungen von Truppenteilen oder Einzelpersonen, die sich besonders ausgezeichnet hatten. Auch Aktionen der feindlichen Streitkräfte, beispielsweise Luftangriffe der Alliierten auf Kriegsziele und Städte im Reichsgebiet, wurden genannt. Die Wehrmachtberichte besassen amtlichen Charakter und waren massgebliche Quelle für die Kommentierung des Kriegsgeschehens in den Medien. Die 2080 gesendeten Wehrmachtberichte waren ein Gemisch aus nüchternem Militär-Rapport und politischer Propaganda und gelten Historikern als ebenso wertvolle wie fragwürdige Sekundärquelle. Berichtet wurde in knapper Form; ausführlicher, konkreter und teilweise übertrieben, wenn Erfolge zu vermelden waren; kürzer, abstrakter und verklausuliert, wenn es um Rückschläge und eigene Verluste ging. Sie vermieden weitgehend direkte Falschmeldungen, operierten mit Auslassungen und Zutaten, mit tendenziösen Hervorhebungen und Verharmlosungen sowie mit Beschönigungen, Verzögerungen und Verschleierungen.
Radio Londres
Radio Londres war ein französischsprachiger Hörfunksender der BBC, der von 1940 bis 1944 auf Sendung war und dessen Inhalte von den Forces françaises libres gestaltet wurden.
Gesendet wurden der „Appell des 18. Juni“ von Charles de Gaulle und weitere Aufrufe zum Widerstand gegen die deutsche Besatzung, satirische Beiträge von Pierre Dac, Maurice Schumann und anderen sowie codierte Nachrichten an die Résistance in Frankreich. 1944 wurde mit dem Gedicht Chanson d’automne (Herbstlied) von Paul Verlaine die unmittelbar bevorstehende Landung der Alliierten in der Normandie angekündigt.
Radio Tokyo
Im Krieg in Ostasien setzten auch die Japaner ab 1943 verstärkt auf Rundfunkpropaganda gegen die Amerikaner, indem sie über Radio Tokyo die Sendung „The Zero Hour“ ausstrahlten. Für die überwiegend weiblichen Moderatoren, die Amerikanisch mit einem japanischen Akzent sprachen, bürgerte sich im GI-Sprachgebrauch der Begriff Tokyo Rose ein.
Alltagsleben in Deutschland im 2. Weltkrieg
(aus LeMO, Lebendiges Museum)
Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges veränderte sich das Leben der Zivilbevölkerung entgegen weitgehenden Befürchtungen zunächst nicht grundlegend. Das NS-Regime scheute sich, der Bevölkerung allzu große Opfer abzuverlangen, und es bemühte sich auch durch Aufrechterhaltung eines ausgedehnten Kulturbetriebs um Alltagsnormalität. Nahezu jede deutsche Familie hatte im Verlauf des Krieges einen Sohn, Bruder, Vater, Ehemann oder Verlobten an der Front. Eine auch unter moralischen Aspekten ständig propagierte „Heimatfront“ sollte Verbundenheit, Zuversicht und vor allem Treue der deutschen Bevölkerung – besonders auch der weiblichen – gegenüber den Frontsoldaten dokumentieren, von deren Kriegsalltag sie zumeist in Feldpostbriefen und während des Heimaturlaubs erfuhren. Galt die alltägliche Sorge der Deutschen zunächst nur dem Leben des Familienmitgliedes an der Front, so wurde der Tod durch Ausweitung der alliierten Luftangriffe ab 1942 auch für die Großstadtbewohner zu einem ständigen Begleiter.
Lebensmittelrationierung
Von einer Kriegsbegeisterung konnte nach dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 in Deutschland keine Rede sein. Zu frisch war die traumatische Erinnerung an den Ersten Weltkrieg ein Vierteljahrhundert zuvor mitsamt seinen katastrophalen Folgen. Die miserable Lebensmittelversorgung und die Hungerjahre 1916 bis 1919 waren im Bewusstsein vieler Erwachsener vor allem in den Städten noch zu präsent. Ähnlich bedrückt war die Stimmung auf dem Land, wo der Entzug von Arbeitskräften und Pferden Probleme aufwarf. Das NS-Regime war sich der mangelnden Kriegsbegeisterung in der Bevölkerung bewusst, und es hatte aus den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges frühzeitig seine Lehren gezogen: Seit 1937 war die Rationierung von Lebensmitteln, Treibstoff, Kohle und anderen Versorgungsgütern im Reichsverteidigungsrat minutiös vorbereitet worden. Durch gute Ernten 1938 und 1939 waren die Vorratslager zudem reichhaltig gefüllt. Bei Getreide, Kartoffeln, Zucker und Fleisch war ein Selbstversorgungsgrad von 100 Prozent erreicht worden.
Stufenweise wurde bei Kriegsbeginn die Zwangsrationierung eingeführt. Fett, Fleisch, Butter, Milch, Käse, Zucker und Marmelade waren ab dem 1. September 1939 nur noch gegen Lebensmittelkarten erhältlich; Brot und Eier folgten ab dem 25. September. Mitte Oktober 1939 wurde für die nicht Uniform tragende Bevölkerung die Rationierung von Textilien mittels einer ein Jahr gültigen „Reichskleiderkarte“ eingeführt. Der Bezugsschein bestand aus 100 Punkten, die beim Kauf von Textilien abgerechnet wurden. Ein Paar Strümpfe „kostete“ 4 Punkte, ein Pullover 25 Punkte, ein Damenkostüm 45 Punkte.
Trotz der von den Nationalsozialisten propagierten agrarischen „Erzeugungsschlacht“ verlagerte sich der Ernährungsschwerpunkt während des Krieges auf Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Mehl und Zucker. Muckefuck, ein dünner Ersatzkaffee aus Gerste oder Eicheln, ersetzte zumeist den Bohnenkaffee. Ersatzkuchen wurden aus Mohrrüben oder Kartoffeln gebacken, die Ersatzmarmelade wurde aus Steckrüben hergestellt. Brot war nahezu im vorherigen Umfang erhältlich, wenn auch mit abnehmender Qualität. Ein „Normalverbraucher“ erhielt in den ersten beiden Kriegsjahren pro Woche u.a. 2.250 Gramm Brot, 500 Gramm Fleisch und rund 270 Gramm Fett. Schwerarbeiter erhielten im Bezugssystem ebenso Sonderzulagen wie werdende Mütter oder Kinder. Nur sie kamen in den Genuss von Vollmilch, die übrigen Verbraucher erhielten Magermilch. Trotz Nahrungsmittelentbehrungen und eines kritischen Versorgungsjahres 1942 mit einer verschärften Rationierung und einem allmählich einsetzenden Mangel an Fett gab es im Deutschen Reich während des Kriegs keine ernsthaften Ernährungsprobleme. Zur Versorgung der deutschen Bevölkerung wurden die besetzten Gebiete rücksichtslos ausgebeutet und der „Tod durch Verhungern“ in Osteuropa gezielt herbeigeführt.
Juden hingegen erfuhren auch im Bezugssystem von Nahrungsmitteln und Textilien starke Diskriminierungen und öffentliche Demütigungen; gegenüber der nichtjüdischen Bevölkerung erhielten Juden für ihre Lebensmittelkarten in den für sie bestimmten Läden deutlich weniger Kalorien zugeteilt. Verfolgung und Entrechtung von Juden hatten mit Kriegsbeginn in Deutschland an Schärfe deutlich zugenommen. Eine medizinische Versorgung existierte für Juden nur noch in Ansätzen. Schrittweise verboten wurde ihnen der Besitz von Radio- und Telefongeräten, Kraftwagen oder das Halten von Haustieren. Um sich als jüdischer „Reichsfeind“ öffentlich zu erkennen zu geben, musste ab dem 19. September 1941 jeder Jude ab dem sechsten Lebensjahr einen gelben Stern deutlich sichtbar auf der Kleidung tragen.
Einsatz an der „Heimatfront“
Aus Sorge vor sozialen Unruhen und sinkender Kriegsmoral sollten den „arischen“ Deutschen hingegen bewusst nur mäßige Opfer abverlangt und so lange wie möglich eine „Normalität“ des Alltagslebens aufrecht erhalten werden. Zur Befriedigung materieller Bedürfnisse wurde die Produktion der Konsumgüterindustrie kaum gedrosselt. Die vorbereitete wirtschaftliche Mobilmachung und generelle weibliche Dienstverpflichtungen unterblieben in den ersten Kriegsjahren. Das Arbeitspotential der Frauen blieb im Gegensatz zu Großbritannien und den USA relativ ungenutzt. Mit 14,9 Millionen erwerbstätigen Frauen im September 1944 wurde der Vorkriegsstand vom Sommer 1939 nur um 300.000 Frauen übertroffen. Der Arbeitskräftebedarf deckte sich vor allem durch allgegenwärtige Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene, jedoch auch durch Umschichtungen weiblicher Arbeiterinnen von stillgelegten oder kriegsunwichtigen Betrieben in die Land- und Kriegswirtschaft sowie junger Berufsanfängerinnen in den Verwaltungssektor. Für weibliche Jugendliche ab 18 Jahren wurde 1939 der sechsmonatige Reichsarbeitsdienst (RAD) verpflichtend. Ab August 1941 verlängerte sich der RAD um ein halbes Jahr „Kriegshilfsdienst“ im Luftschutz, in sozialen Einrichtungen, Krankenhäusern, kinderreichen Familien oder Verkehrsbetrieben. „Auf allen Lebensgebieten, wo es an Männern fehlt, hat die Frau den Mann zu vertreten“, wie es offiziell hieß und propagandistisch dokumentiert wurde. Im öffentlichen Dienst beschäftigte Frauen waren dabei ab Oktober 1939 ihren männlichen Kollegen im Lohnniveau ebenso gleichgestellt wie Akkordarbeiterinnen in den Rüstungsbetrieben ab 1940. Höhere Löhne, verbesserte Arbeiter- und Mutterschutzgesetze oder massive staatliche Wohlfahrtsleistungen sollten die Stabilität der „Heimatfront“ trotz stufenweiser Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit von 48 auf 50 oder mehr Stunden und verschlechterter Lebensbedingungen aufrechterhalten.
Im Zweiten Weltkrieg verstärkte sich der Zugriff auf die Jugendlichen, deren Alltag immer weniger von der Schule an sich bestimmt wurde. Alljährlich wurden Kinder und Jugendliche während des Krieges klassenweise zum Ernteeinsatz verpflichtet. Zu ihrem Alltag gehörten nunmehr auch das Auflesen von Kartoffelkäfern oder von den von alliierten Flugzeugen abgeworfenen Brandplättchen sowie Verladedienste und die Verteilung von nationalsozialistischem Propagandamaterial. Vielfältigen Sammelaktionen waren über die Schulen oder die Hitler-Jugend (HJ) organisiert. Sie sollten die Opferbereitschaft der Deutschen und den Geist einer solidarischen „Volksgemeinschaft“ beschwören. Alltägliche Erscheinungen im Straßenbild waren die Sammlungen für das Kriegswinterhilfswerk oder die „Schulaltstoffsammlungen“, bei denen die Angehörigen der HJ Altpapier, Spinnstoffe oder Metalle sammelte. Ab April 1940 riefen die Behörden regelmäßig zur „Metallspende“ für die Rüstungsbetriebe auf. Erfrierungen von Wehrmachtssoldaten an der Ostfront führten ab dem Winter 1941/42 zu Sammelaktionen von Winterbekleidung und Decken. Nicht jeder Deutsche gab seinen Mantel oder einen teuren Pelz dabei bereitwillig her.
Ablenkung vom Kriegsalltag
Radio hören und Lesen gehörten zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen von Jugendlichen und Erwachsenen gleichermaßen. Eine Flut von kriegsverherrlichender Literatur erstreckte sich für sie in den Buchhandlungen. Über die Volksempfänger hörten die Deutschen neben den einseitigen Siegesmeldungen der Wehrmachtsberichte bekannte Schlager wie „Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern“ und vor allem „Lili Marleen“, das wie kein zweites Lied Emotionen weckte und in den Wunschkonzerten gespielt wurde. Der Unterhaltungsfilm „Wunschkonzert“ wurde zu einem der erfolgreichsten Filme der NS-Zeit. Im Mittelpunkt des Films stand die äußerst populäre Radiosendung „Wunschkonzert für die Wehrmacht“, das die Verbindung zwischen Heimat und Front aufrechterhalten sollte und in der Grüße und Musikwünsche ausgetauscht oder Geburten den fernen Vätern bekanntgegeben wurden. Jeden Sonntag wurde das „Wunschkonzert“ von rund der Hälfte der deutschen Bevölkerung verfolgt.
Obwohl vollbesetzte Stadien geradezu ideale Ziele alliierter Bomber gewesen wären, gingen wöchentlich hunderttausende Menschen auf der Suche nach Freizeitvergnügen und Zerstreuung zu Fußballspielen, auch wenn diese wegen der Gefahr von Luftangriffen häufig verlegt und recht kurzfristig angesetzt wurden. Zu Zwecken der Propaganda diente der Fußball allerdings wenig, wie Propagandaminister Joseph Goebbels nach einer 2:3 Niederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden im Berliner Olympiastadion am 20. September 1942 in seinem Tagebuch festhielt: Da 100.000 Zuschauer, denen das Spiel „mehr am Herzen lag als die Einnahme irgendeiner Stadt im Osten“, das Stadion deprimiert verließen, „müßte man für die Stimmung im Inneren eine derartige Veranstaltung ablehnen“.
Stattdessen sollten beliebte Filmstars der Zeit wie Hans Albers, Heinz Rühmann, Willy Birgel, Hans Moser oder Marika Rökk die Menschen von ihren Alltagssorgen ablenken. Schauspielerinnen wie Zarah Leander, Kristina Söderbaum, Anna Dammann (1912-1993) und vor allem Ilse Werner – die „Traumfrau“ in der ersten Hälfte der 40er Jahre – genossen Vorbildcharakter, denen viele Frauen trotz Rationierung von Textilien und Mangel an Kosmetikartikeln im Aussehen nachzueifern trachteten. Im ersten Kriegsjahr – in der Saison 1939/40 – wurde im Deutschen Reich erstmals die Grenze von einer Milliarde Kinobesucher überschritten. In den Kinos liefen zumeist bewusst unpolitische Unterhaltungsfilme, viele Publikumserfolge wie „…reitet für Deutschland“ (1941) transportierten jedoch unterschwellig auch eine eindeutig politische Botschaft. Klassiker wie „Münchhausen“ (1943) oder „Die Feuerzangenbowle“ (1944) dienten in den letzten Kriegsjahren, als die vor dem Hauptfilm gezeigte „Wochenschau“ für die Deutschen nur noch wenig Erfreuliches von den Fronten zu berichten hatte, immer häufiger der Zerstreuung.
Luftangriffe und Stimmung in der Bevölkerung
Die Luftsirenen in den Großstädten ertönten ab 1942 häufiger, Verdunklungen waren an der Tagesordnung, und immer öfter mussten Menschen in drangvoller Enge zermürbende Nächte in Luftschutzräumen oder Hauskellern verbringen. Der nach den Luftangriffen anschließend tagelang über der Stadt liegende Geruch von Feuer, verbranntem menschlichem Fleisch und Fäulnis war ihnen auch Jahre nach Kriegsende noch präsent. Vom Luftschutz angebotene „Volksgasmasken“ sollten Schutz vor der gefürchteten Rauchentwicklung nach Angriffen bieten. Die Kinderlandverschickung (KLV) und Evakuierungsmaßnahmen ganzer Familien nahmen ebenfalls an Ausmaß zu, allein 1943 verließen über 700.000 Berliner die Reichshauptstadt. Zehntausende Ausgebombter mussten in Notquartieren untergebracht und von der NS-Volkswohlfahrt (NSV) unterstützt werden. Um Papier zu sparen, erschienen zahlreiche Zeitungen und Illustrierte mit Durchhalteparolen nur noch in Sonderausgaben, oder ihr Erscheinen wurde vollständig eingestellt. Verschiedene Waren konnten allein auf dem Schwarzmarkt erworben werden, der als „Kriegswirtschaftsverbrechen“ drastisch bestraft wurde, aber dennoch blühte. Missstimmungen gegen die als privilegiert geltenden „Parteibonzen“ der NSDAP nahmen zu, und auch Adolf Hitler wurde davon nun nicht mehr ausgenommen. Den Weg in den aktiven Widerstand fanden allerdings nur wenige Deutsche.
Wurden Hitler nach dem deutschen Sieg über „Erbfeind“ Frankreich im Sommer 1940 von den meisten Deutschen geradezu abgöttische Sympathien zuteil, so zweifelten im weiteren Kriegsverlauf – als die Gefallenenlisten bisher unbekannte Ausmaße annahmen – immer mehr „Volksgenossen“ am „Geschick des Führers“. Nach der Kapitulation der 6. Armee in Stalingrad im Februar 1943 und der sich unmittelbar anschließenden deutsch-italienischen Niederlage im Afrikafeldzug veränderte sich die Stimmungslage im Deutschen Reich dramatisch. Die Moral in der Bevölkerung sank rapide. Zweifel am „Endsieg“ wurden lauter, die – wenn sie in der Öffentlichkeit fielen – mit drakonischen Strafen belegt wurden. Kriegsmüdigkeit und Defätismus nahmen spürbar zu, zugleich aber auch die Angst, dafür denunziert und drastisch bestraft zu werden.
Kriegswende und Kriegsende
Die Ausrufung des „Totalen Krieges“ durch Goebbels wenige Tage nach der Niederlage in Stalingrad im Berliner Sportpalast am 18. Februar 1943 sollte die Mobilisierung sämtlicher materiellen und personellen Ressourcen zur Folge haben. Ende Juli 1944 wurden alle „kriegsunwichtigen“ Betriebe und Geschäfte geschlossen. Der NS-Staat verpflichtete nun große Teile der Bevölkerung zur Arbeit in der Rüstungsindustrie. Fast alle waffenfähigen Männer waren in der Wehrmacht, in der Waffen-SS oder bei Polizeieinheiten.
Die Sorgen der Deutschen galten nun nicht mehr allein dem Wohlergehen des erwachsenen Familienmitgliedes an der Front, sondern im zunehmenden Maße auch dem noch halbwüchsigen Sohn oder Bruder. Immer häufiger stellten Schulen das am 8. September 1939 eingeführte Notabitur aus, ein Abgangszeugnis, das bei Einberufung zum Militär als Reifezeugnis diente. 14- bis 18-jährige Hitlerjungen wurden in Wehrertüchtigungslagern in Militärtaktik unterrichtet und an Waffen ausgebildet. Mit der Erweiterung der Wehrpflicht ab August 1943 wurden auch Jungen unter 18 Jahren direkt aus den Lagern in die Wehrmacht eingezogen. Bereits 15-Jährige mussten ab 1943 die zur Front abkommandierten Flaksoldaten als „Luftwaffenhelfer“ ersetzen, häufig mit tödlichem Ausgang. Mit Einberufung des Volkssturms im Herbst 1944 standen die Halbwüchsigen schließlich mit der Waffe in der Hand dem Feind auch unmittelbar gegenüber.
Angst bestimmte in den letzten Kriegsmonaten den Alltag von Millionen Deutschen, die einer ungewissen Zukunft entgegenblickten. Die jahrelange hasserfüllte Propaganda gegen die „Bolschewisten“ wirkte, und die Verbrechen schlugen zurück auf die Deutschen. Aus Angst vor der Roten Armee setzten sich ab Oktober 1944 aus Ostpreußen und Schlesien gewaltige Flüchtlingstrecks nach Westen in Bewegung, nachdem von Rotarmisten an der deutschen Zivilbevölkerung begangene Grausamkeiten wie Ermordung, Verschleppung oder Vergewaltigung bekannt geworden waren. Im Westen des Reiches hingegen wurden Briten und Amerikaner zumeist freundlich begrüßt, weniger als „Befreier“ vom NS-Regime, sondern aus Erleichterung darüber, dass sie vor der Roten Armee als Besatzer einrückten und dass der verlustreiche Krieg, der rund 3,8 bis 4 Millionen deutschen Soldaten und 1,65 Millionen Zivilisten den Tod brachte, nun bald ein Ende haben würde. Angst aber hatten auch die Menschen im Westen, vor einem Frieden, der Deutschland diktiert werden könnte, und vor Strafen für begangene Verbrechen der Deutschen in Europa. „Genießt den Krieg, denn der Friede wird schrecklich“, dieser in den letzten Kriegsmonaten vor allem unter NS-Funktionären kursierende Spruch brachte die Stimmung bei zahlreichen Deutschen zynisch zum Ausdruck. Nicht selten herrschte im Frühjahr 1945 eine sonderbar bizarre Weltuntergangsstimmung, und jene bis dahin auch materiell Privilegierten wie Funktionäre oder Offiziere zelebrierten sie mit Alkoholorgien, während ein Großteil der Bevölkerung vor allem in den Städten und Flüchtlinge Mühe hatten, satt zu werden oder ein Dach über den Kopf zu finden.
Das Kriegsende am 8. Mai 1945 verringerte die tägliche Not der Bevölkerung zunächst nur unwesentlich. Unter gewaltigen Kriegszerstörungen und Hunger hatte sie zum Teil noch Jahre zu leiden.