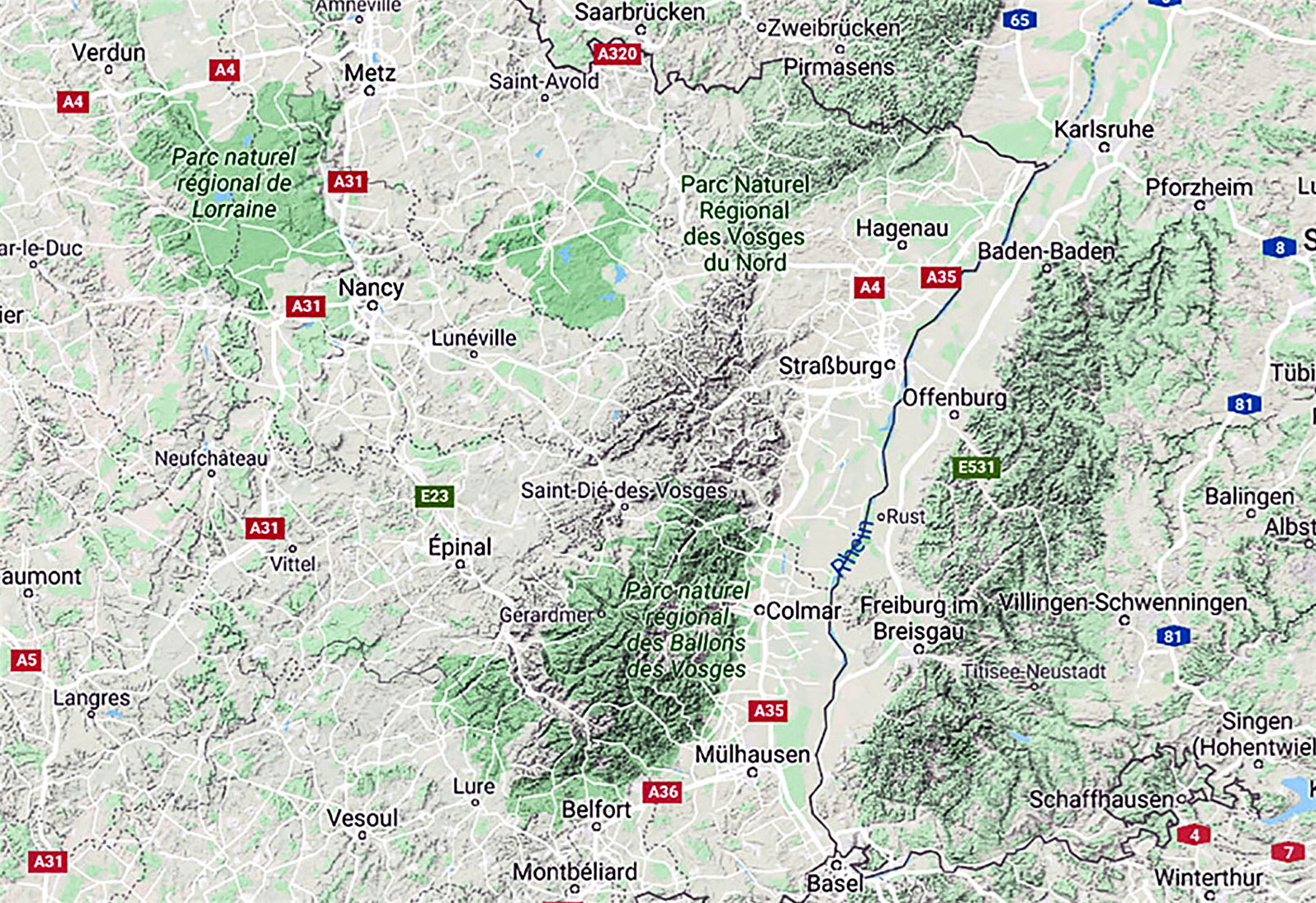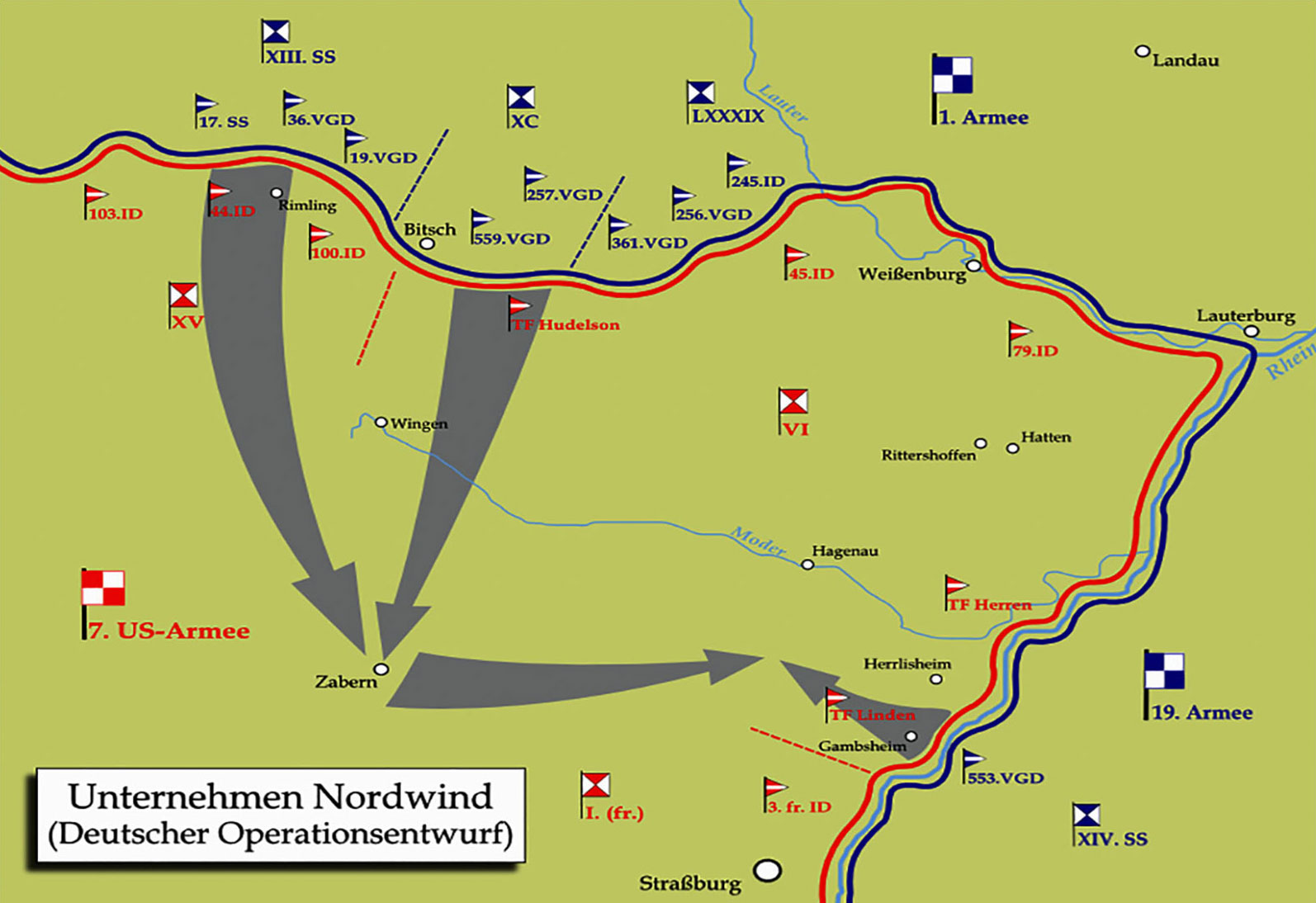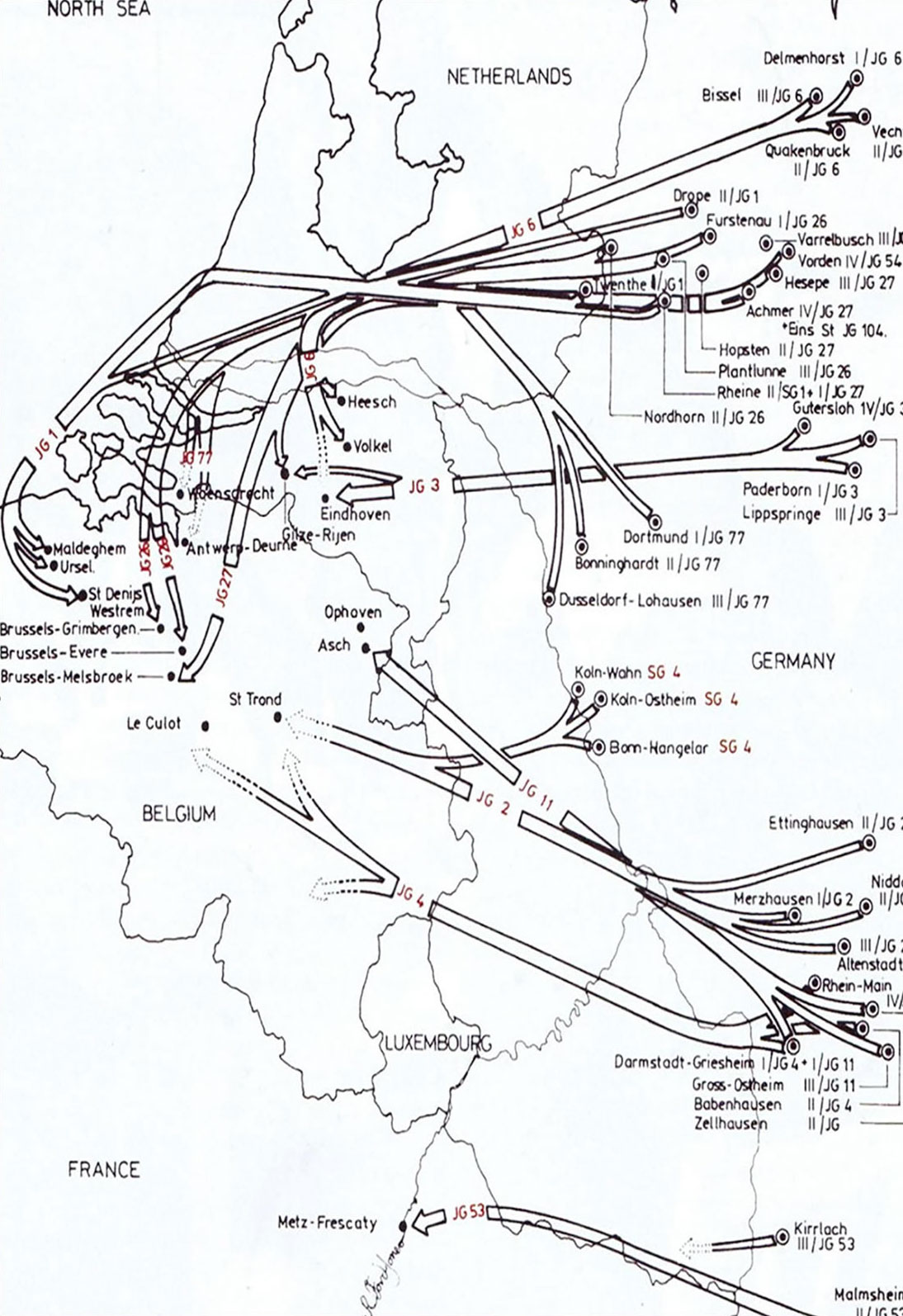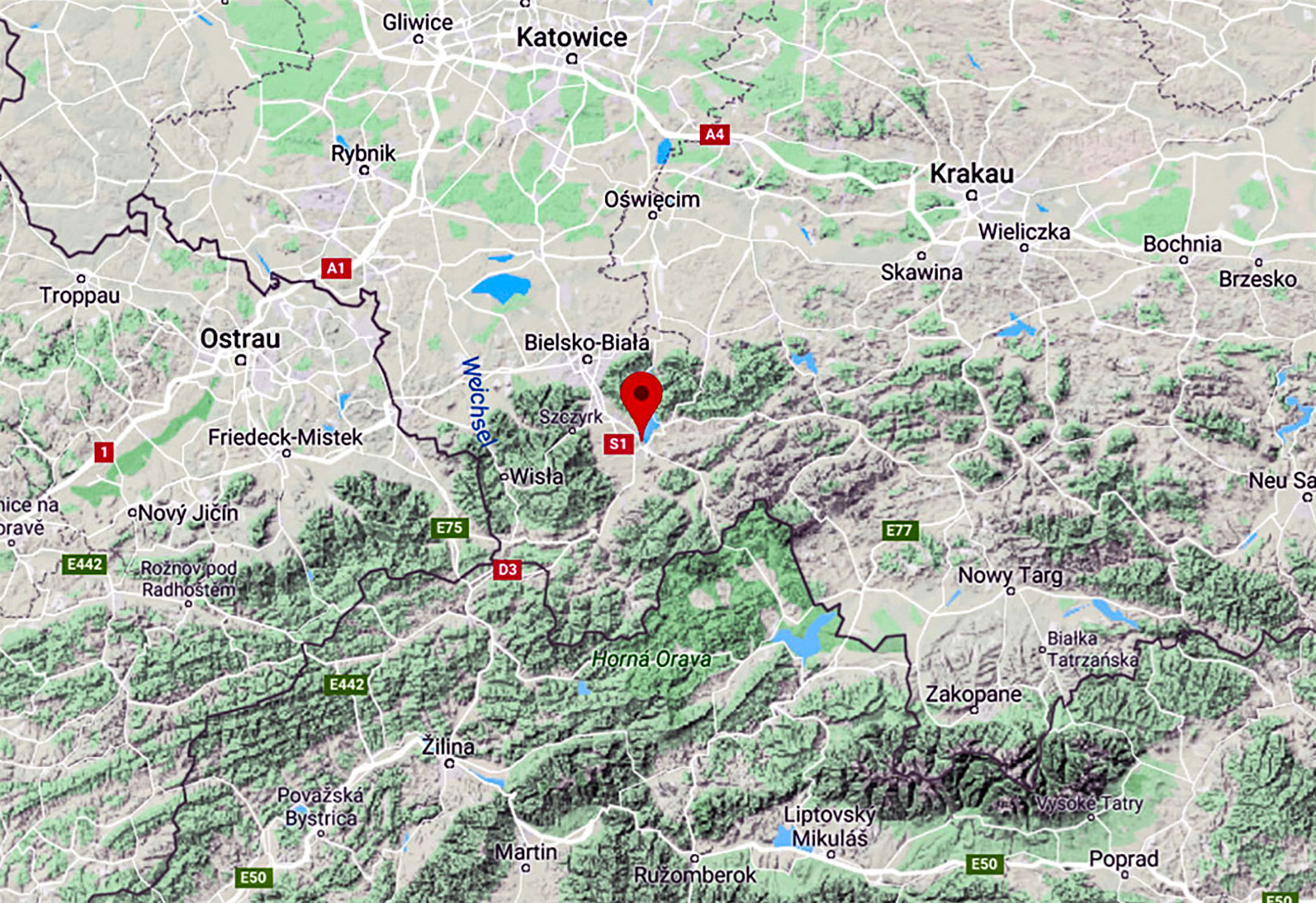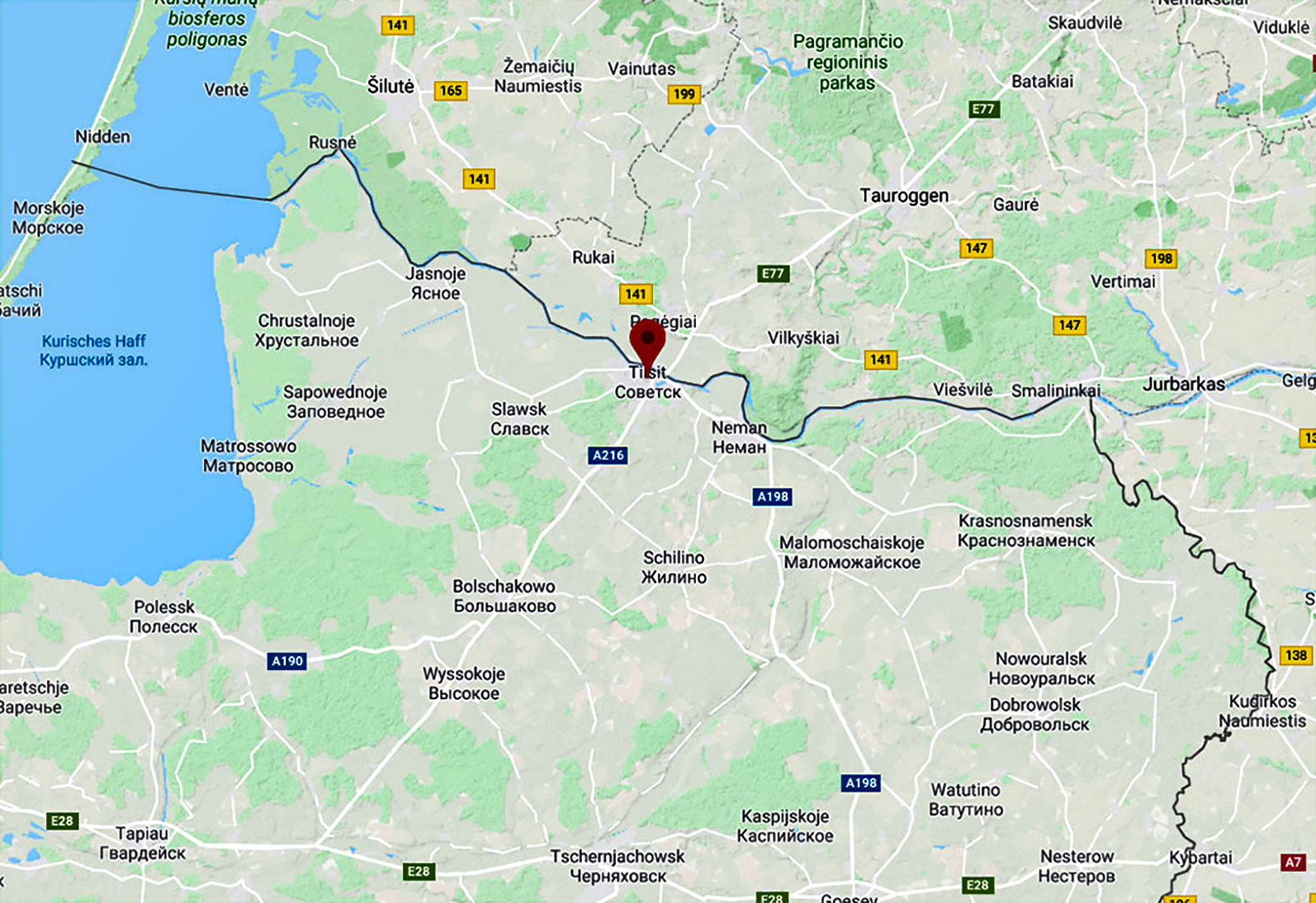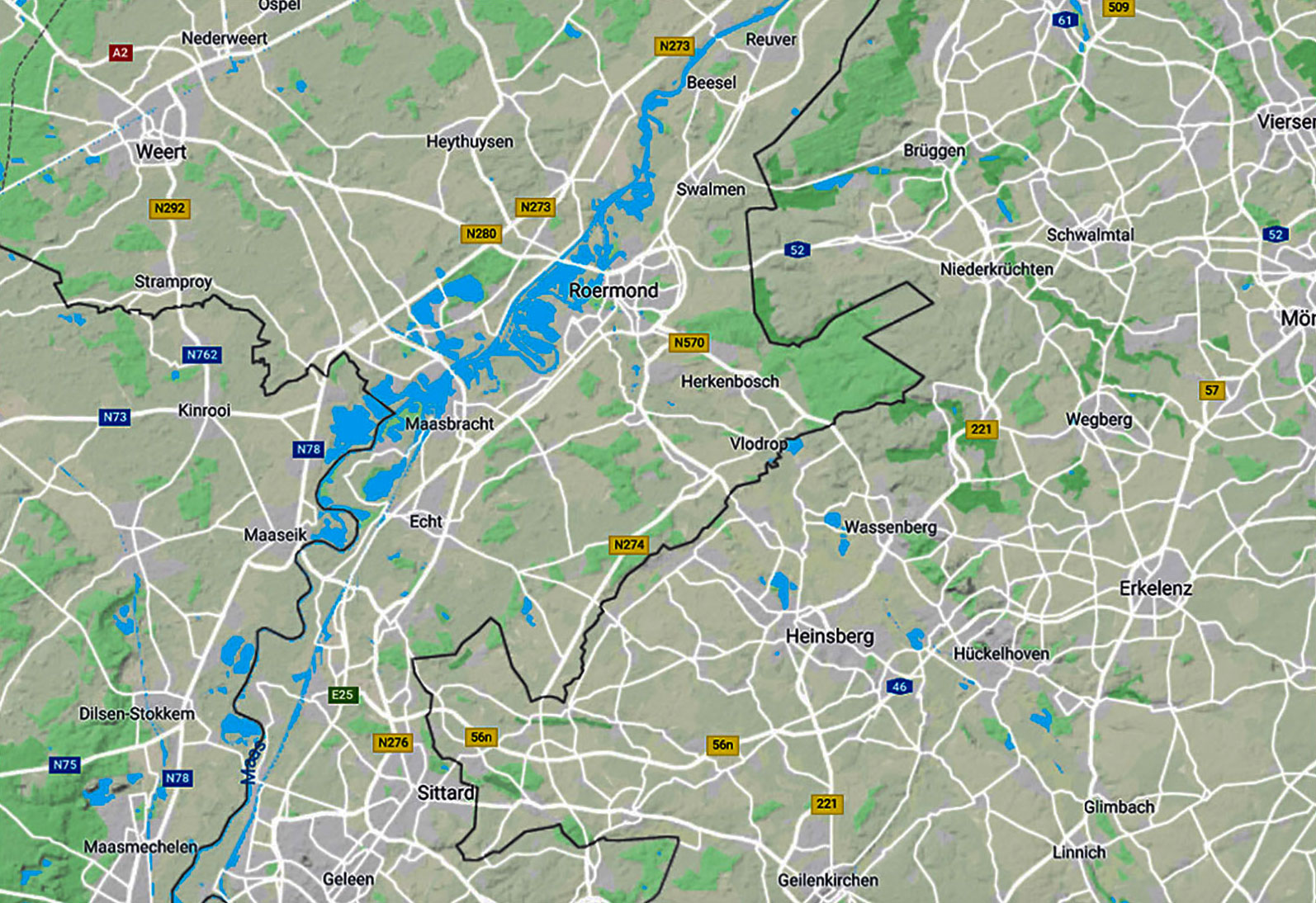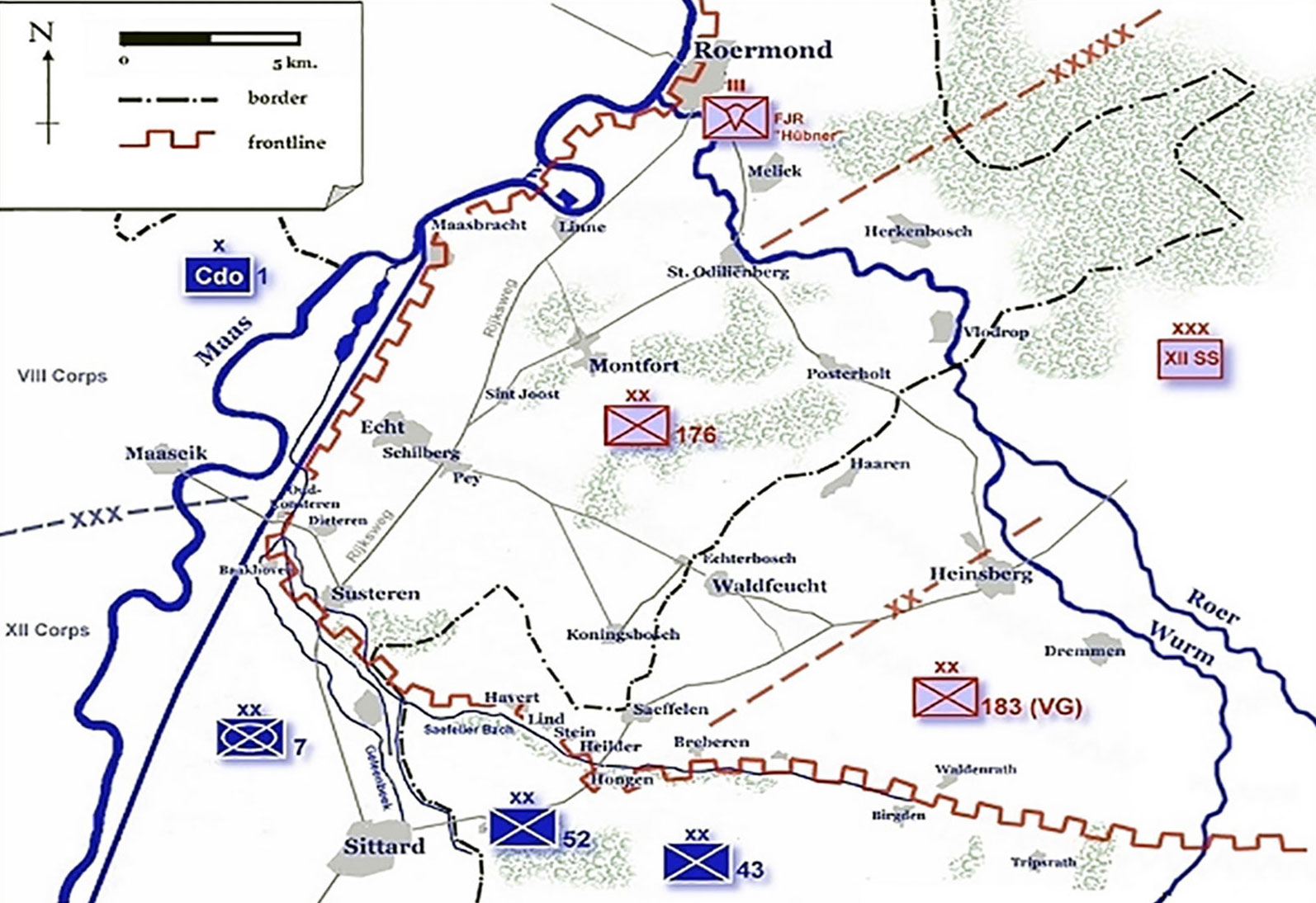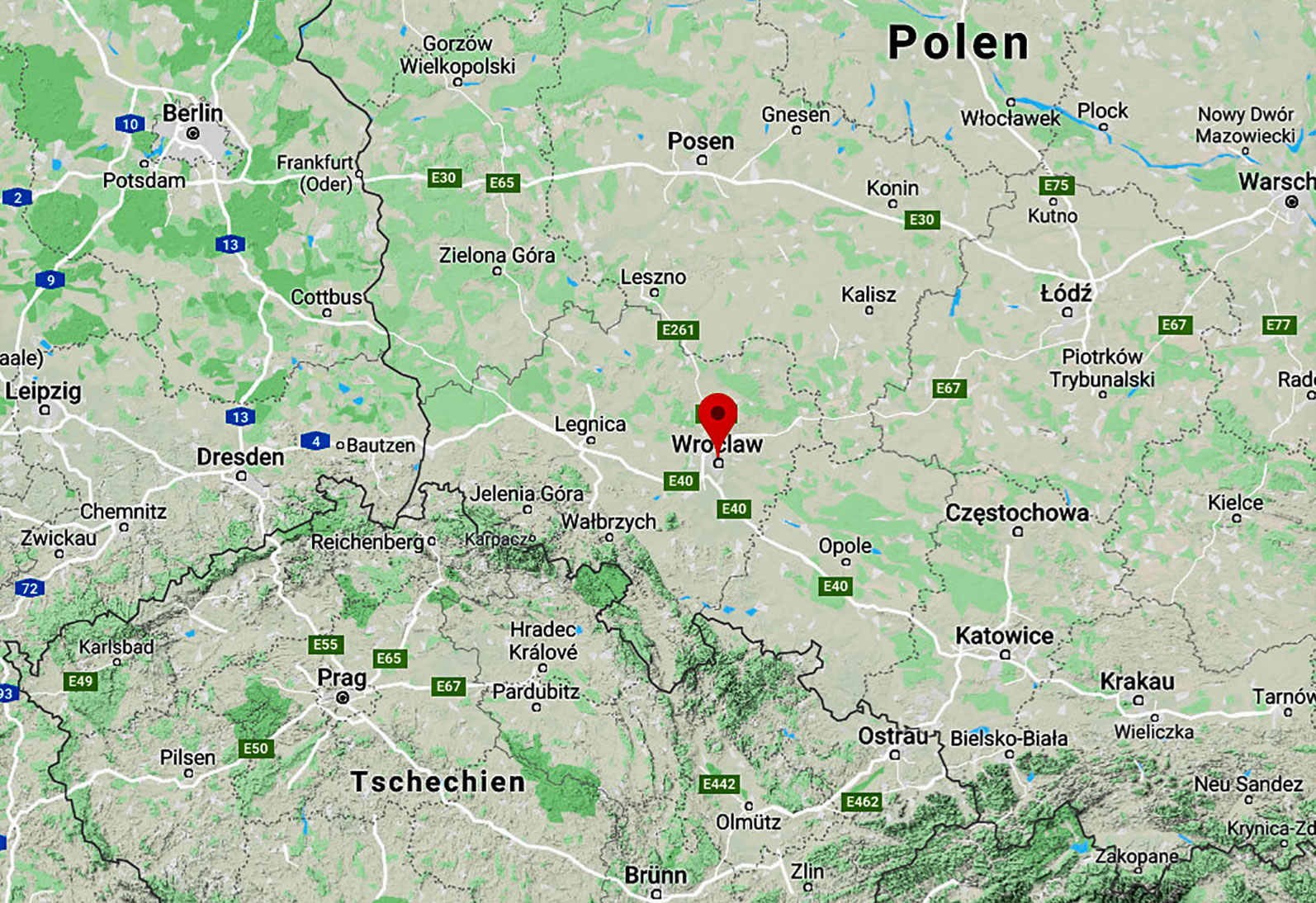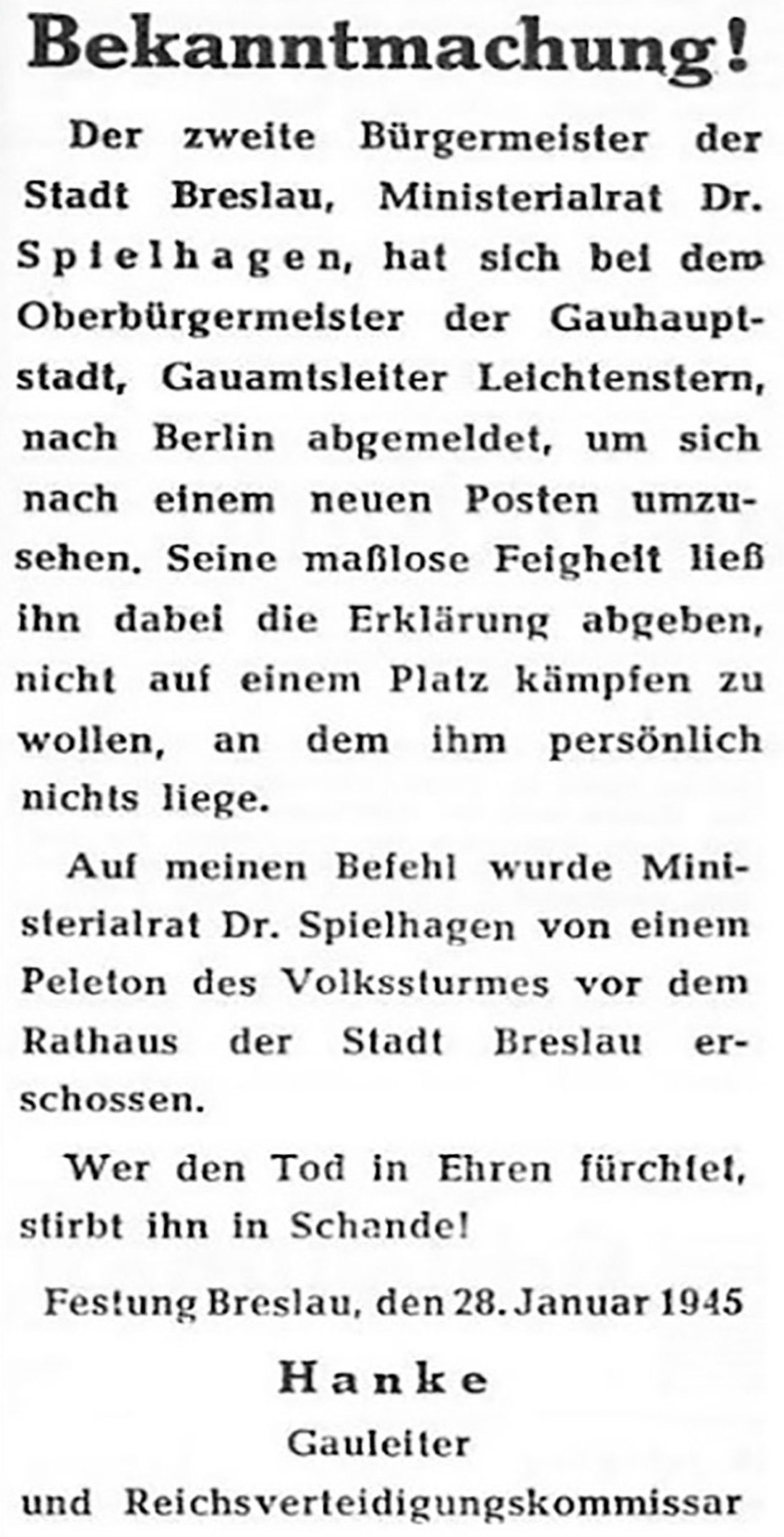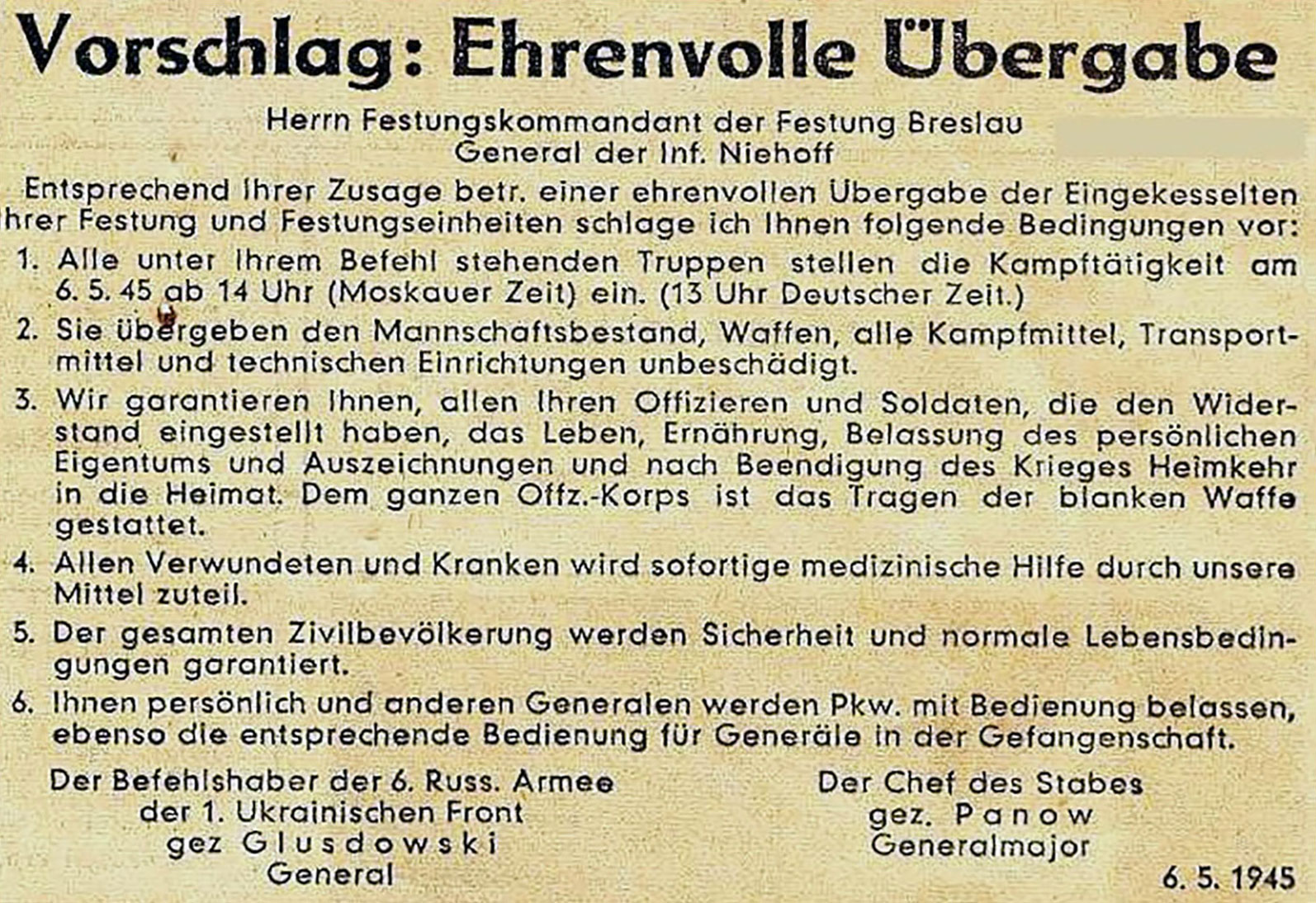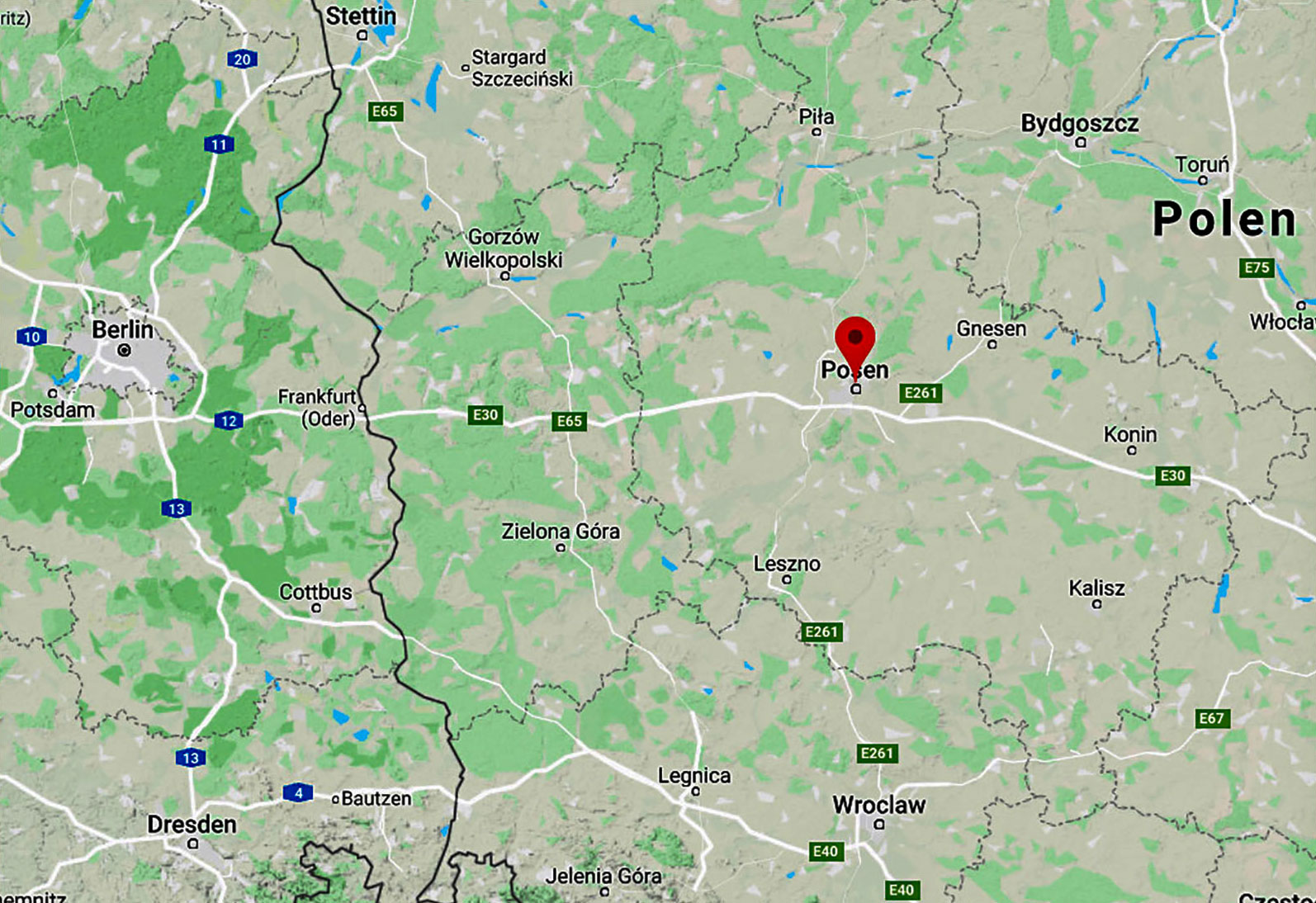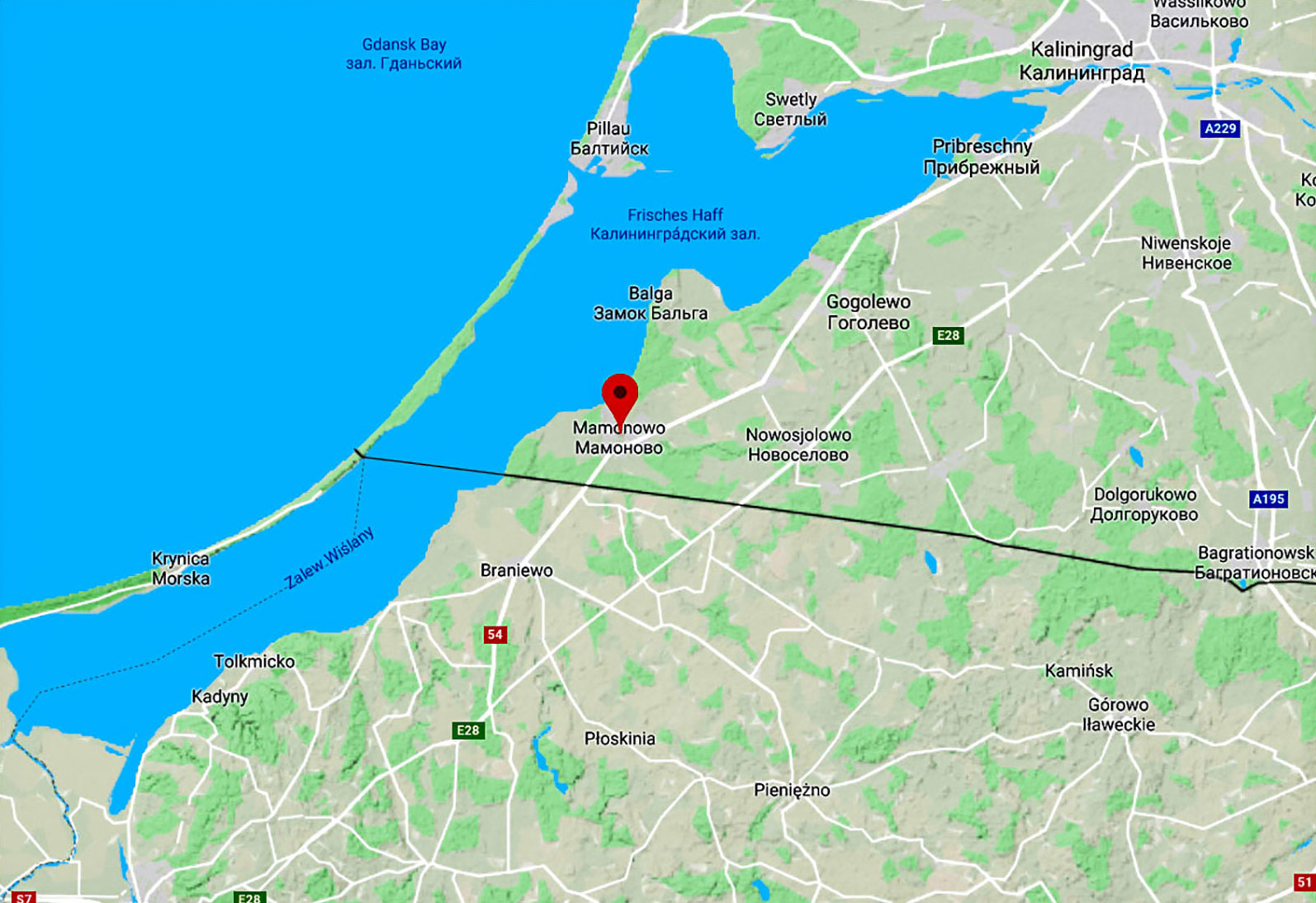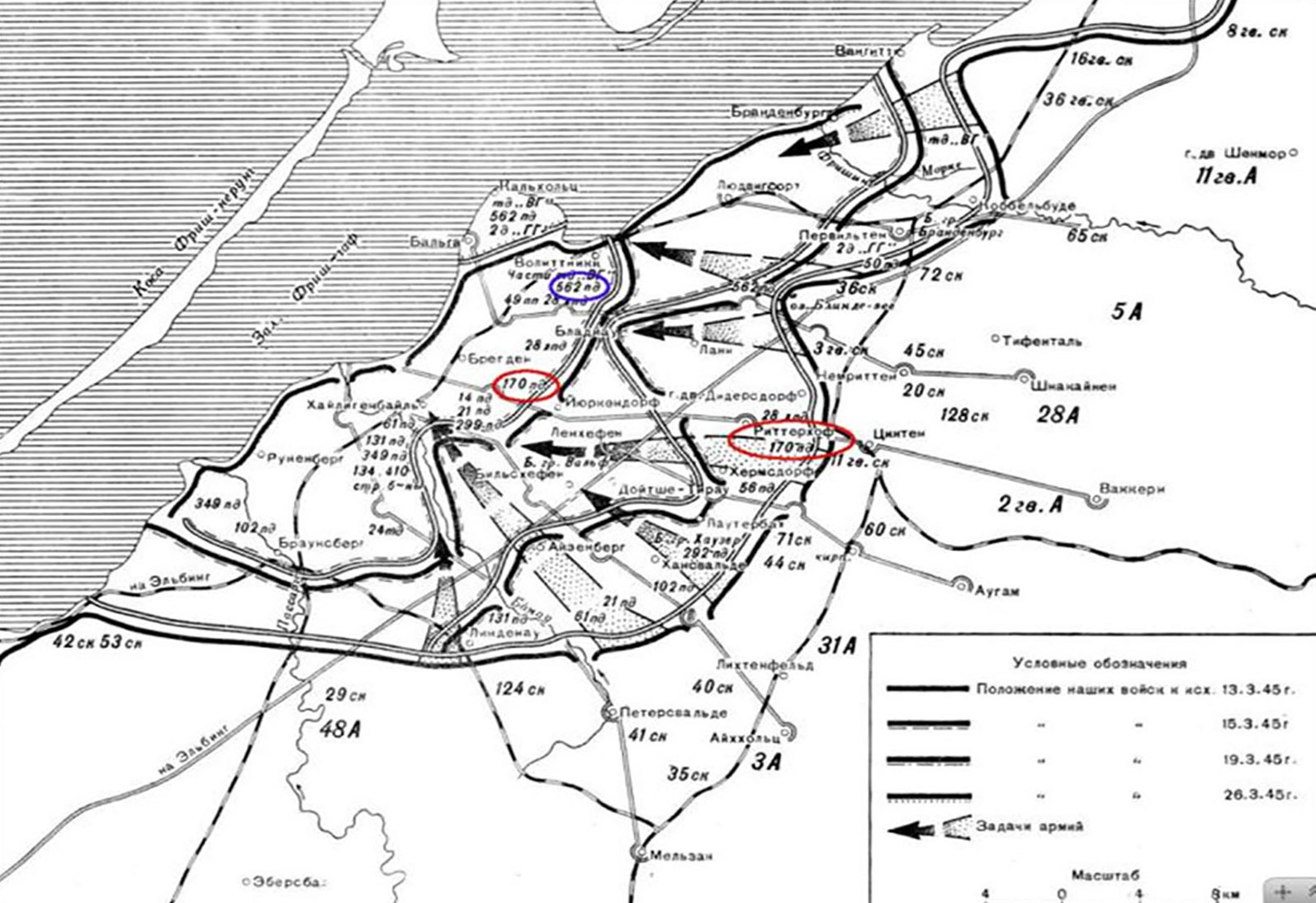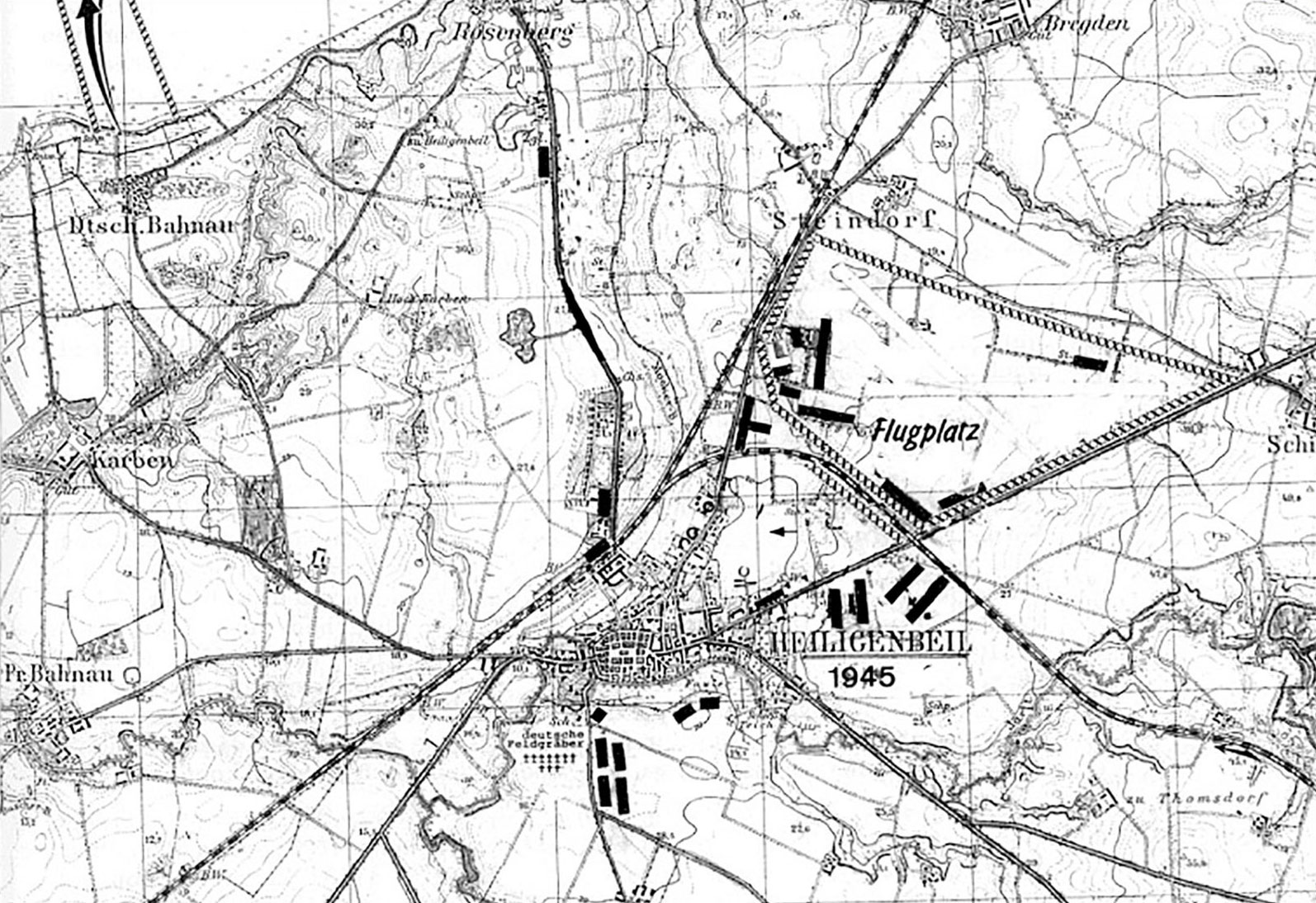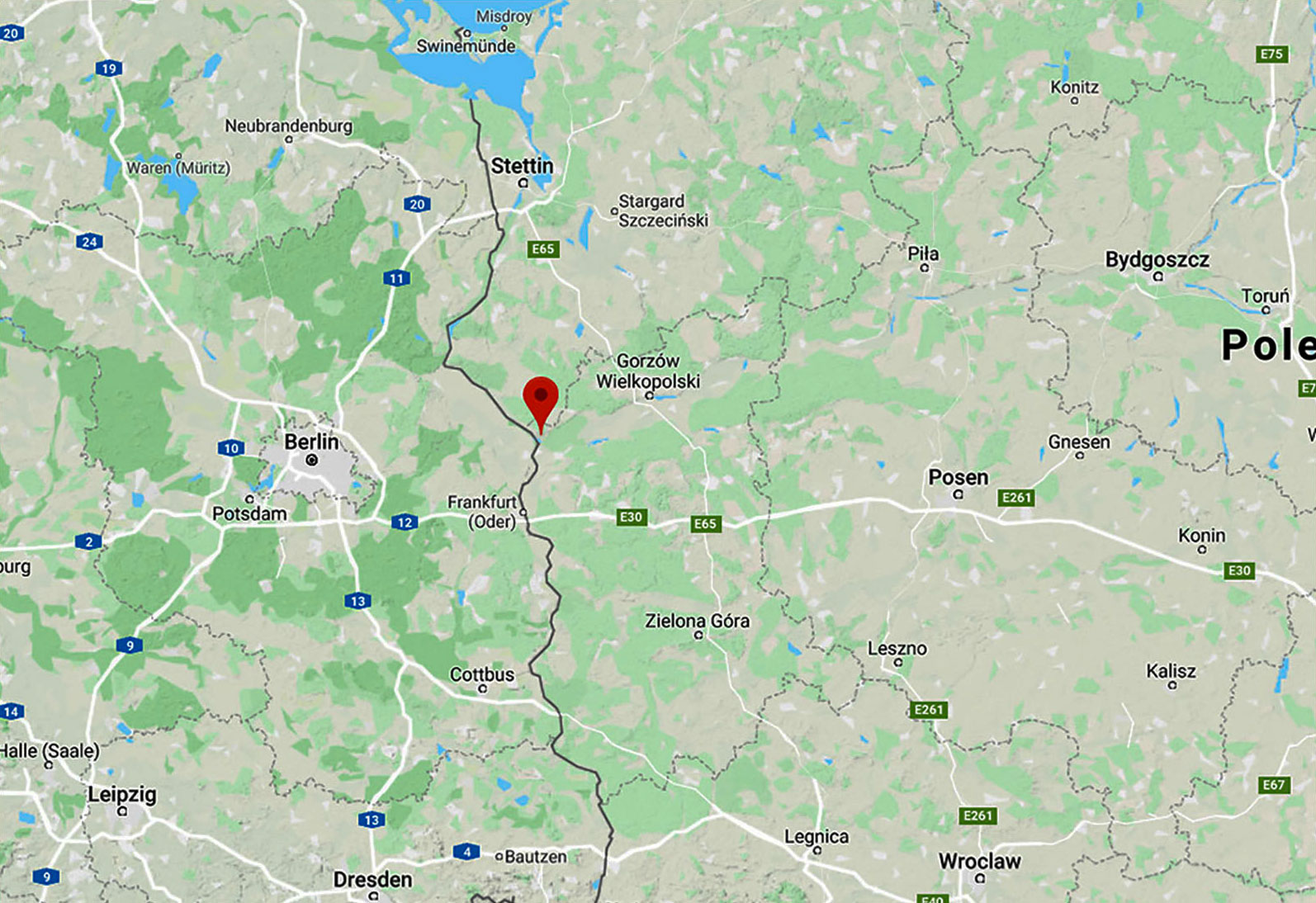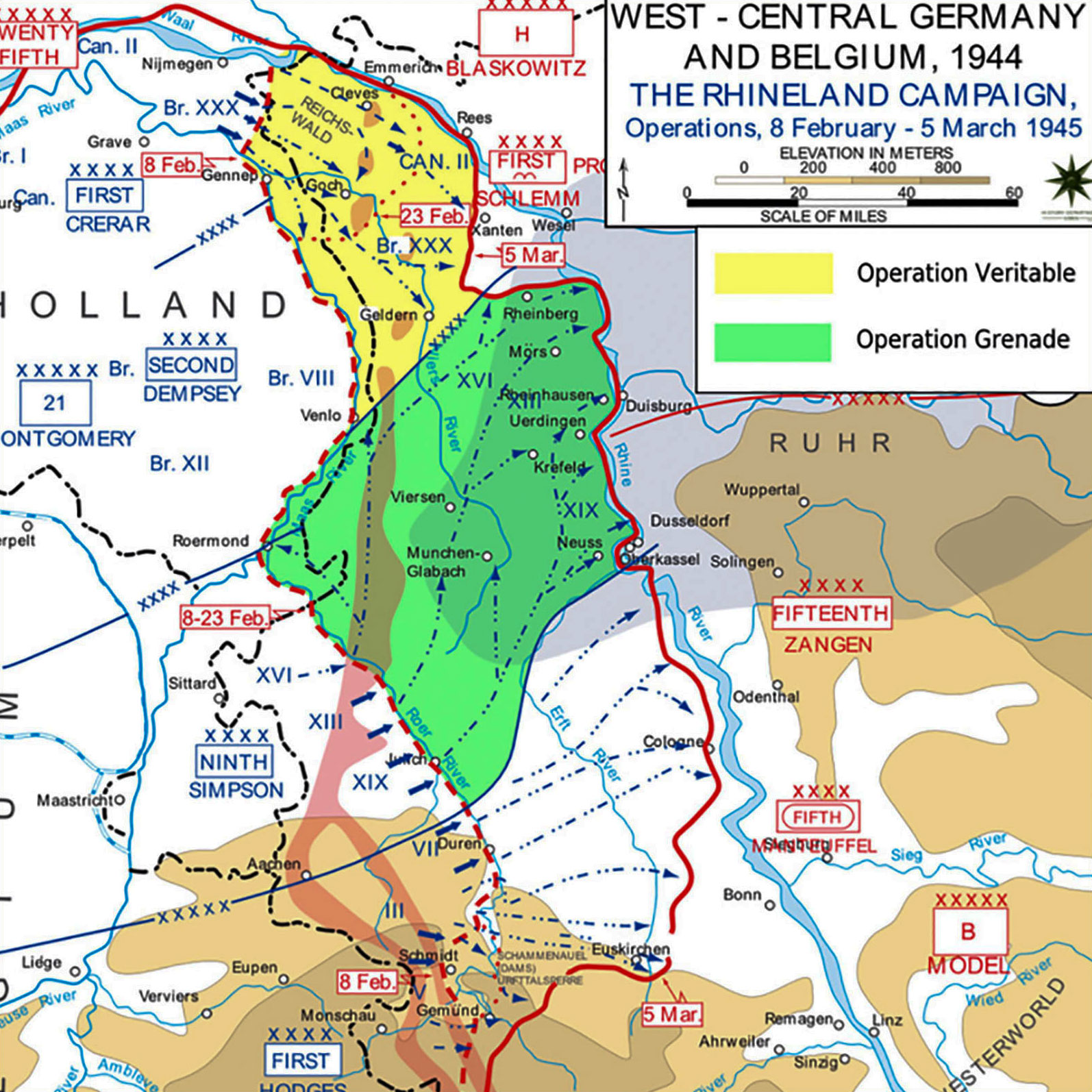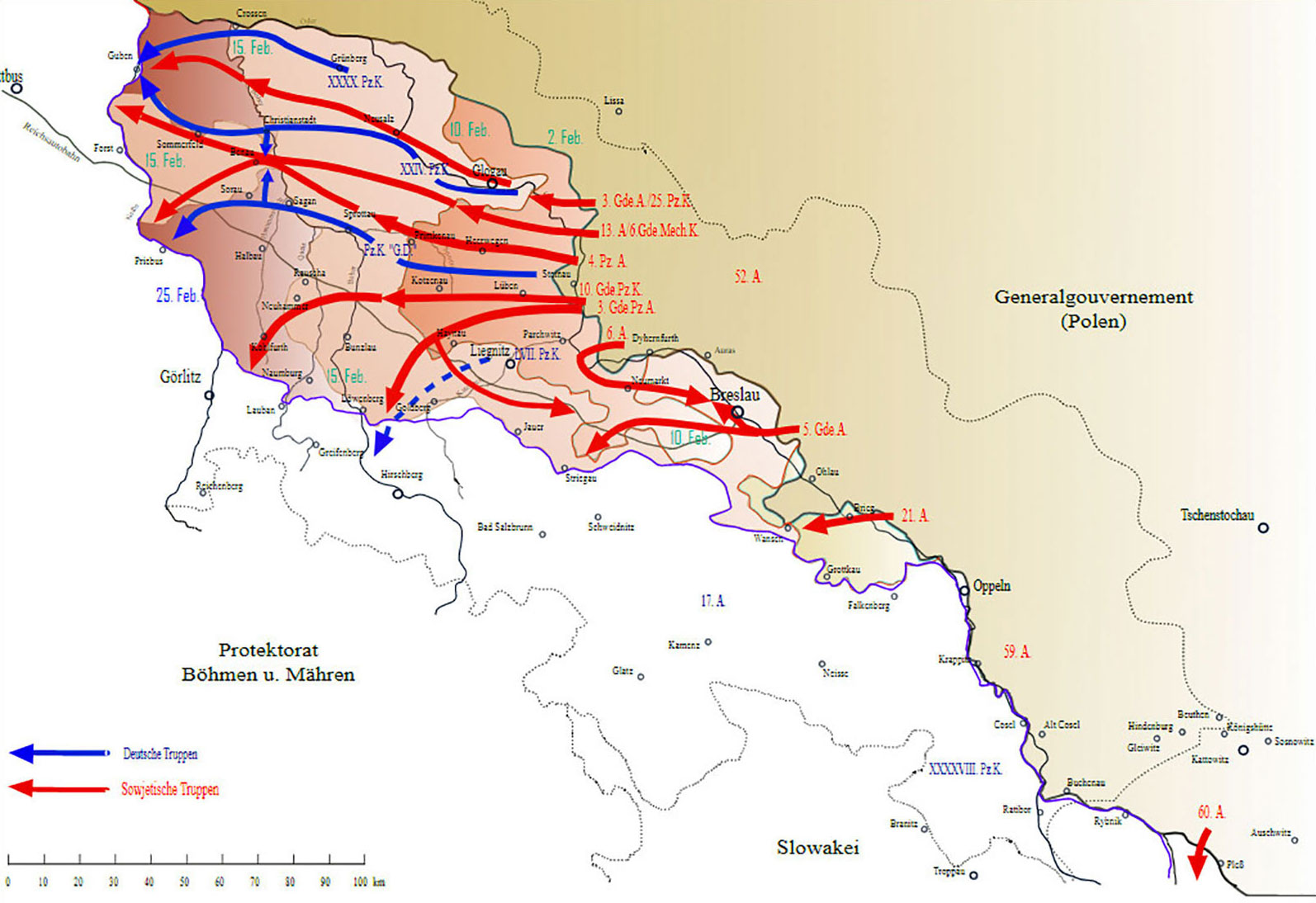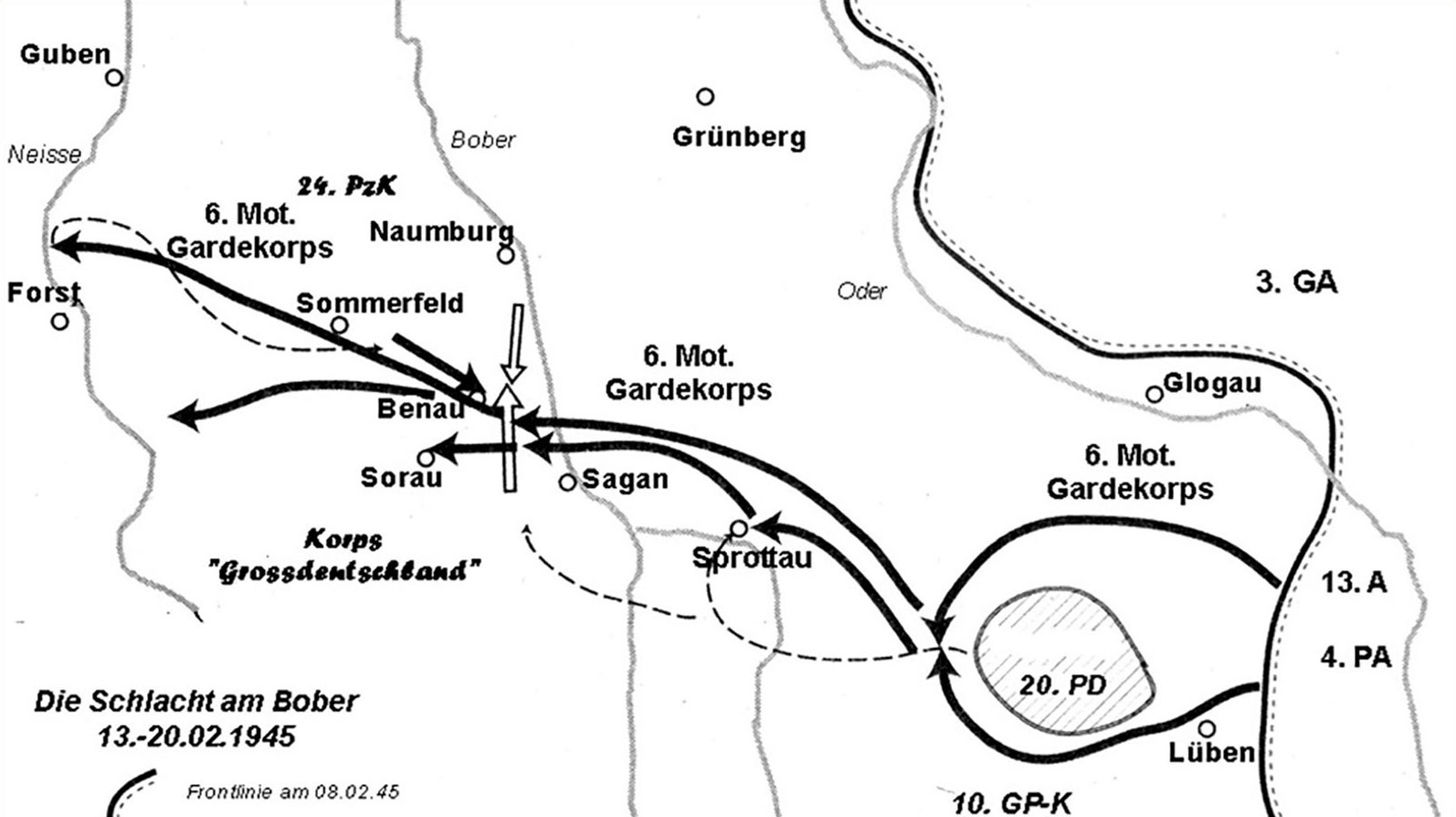Das Karussell der Niederlage dreht sich immer schneller
Datenherkunft: (Wikipedia)
aus-der-zeit.site > Kriegsverlauf 1945
- Unternehmen Nordwind (31.12.1944 – 25.01.1945)
- Unternehmen Bodenplatte (01.01.1945)
- Westkarpatische Operation (12.01.1945 – 18.01.1945)
- Weichsel-Oder-Operation (12.01.1945 – 30.03.1945)
- Eroberung Tilsits 1945 (13.01.1945 – 20.01.1945)
- Ostpreussische Operation (13.01.1945 – 20.01.1945)
- Operation Blackcock (14.01.1945 – 26.01.1945)
- Schlacht um Breslau (23.01.1945 – 06.05.1945)
- Schlacht um Posen (25.01.1945 – 23.02.1945)
- Kesselschlacht von Heiligenbeil (26.01.1945 – 29.03.1945)
- Kampf um Küstrin (02.02.1945 – 16.04.1945)
- Schlacht im Reichswald (07.02.1945 – 22.02.1945)
- Niederschlesische Operation (08.02.1945 – 24.02.1945)
Unternehmen Nordwind (31.12.1944 – 25.01.1945)
Das Unternehmen Nordwind war im Zweiten
Weltkrieg die letzte Offensive deutscher Streitkräfte an der Westfront, in deren Rahmen vom 31. Dezember 1944 bis zum 25. Januar 1945 Kampfhandlungen im Elsass und in Lothringen stattfanden. Obwohl das Unternehmen zu politischen Spannungen zwischen den USA und Frankreich führte, die als Strassburger Kontroverse bezeichnet werden, gehört es zu den weniger bekannten und teilweise sogar falsch dargestellten Grossoperationen des Zweiten Weltkrieges; in der öffentlichen Wahrnehmung dominierendie gleichzeitigen Kämpfe in den Ardennen und an Weichsel und Oder.
Zeitweilig als Alternative zur Ardennenoffensive oder auch zu ihrer Unterstützung geplant, wurde das Unternehmen begonnen, als die dortigen Angriffe längst zum Stehen gekommen waren. Während deutsche Truppen die Ardennen bereits weitgehend wieder geräumt hatten und die sowjetischen Truppen vor der Einnahme Warschaus und kurz vor ihren ersten Erfolgen in Ostpreussen standen, erreichten die Kämpfe im Elsass mit dem Einsatz weiterer deutscher Divisionen ihren Höhepunkt. Ein wesentlicher Teil der Kampfhandlungen fand vom 8. bis zum 20. Januar 1945 im Raum zwischen Hagenau und Weissenburg statt, wenngleich Kämpfe am Vogesenkamm und um einen neugebildeten Brückenkopf am Oberrhein die Ereignisse deutlich stärker bestimmten. Die Schlacht endete nach dem Rückzug der amerikanischen Truppen auf die Moder-Linie nahe Hagenau und ihrem Abwehrerfolg gegen die letzten deutschen Angriffe am 25. Januar.
Im Gegensatz zur vor allem durch Treibstoffmangel behinderten Ardennenoffensive gelten unzureichende Artillerieunterstützung, ungenügende Aufklärung und vor allem Personalmangel sowie hartnäckiger alliierter Widerstand als entscheidende Gründe für das Scheitern von Nordwind. Die in diesem Frontabschnitt eingesetzten, durch die vorangegangenen Rückzugskämpfe geschwächten Verbände wurden nur unzureichend personell aufgefrischt – ein Manko, das erst verspätet durch den Einsatz von Reserven kompensiert wurde. Die operative Führung wurde zusätzlich dadurch erschwert, dass der Operationsraum nicht allein im Bereich der Heeresgruppe G lag, sondern zwischen ihr und der neu gebildeten Heeresgruppe Oberrhein unter dem Kommando von Heinrich Himmler (Reichsführer SS) aufgeteilt war.
Ausgangslage
Am 12. November 1944 trat die 6. US-Heeresgruppe, bestehend aus der 7. US-Armee und der französischen 1. Armee, im Zusammenwirken mit der 3. US-Armee zur Offensive beiderseits der Vogesen an. Die alliierten Armeen durchbrachen die Zaberner Steige und die burgundische Pforte und erreichten den Oberrhein am 19. November bei Mülhausen und am 23. November bei Strassburg. Auf ausdrücklichen Befehl Dwight D. Eisenhowers überschritten die alliierten Verbände den Rhein nicht, sondern drehten nach Norden ein. Anfang bis Mitte Dezember hatten sie die deutsche 1. Armee weitestgehend aus dem Unterelsass nach Norden zurückgedrängt und Teile der 19. Armee im Brückenkopf Elsass umfasst. Letztere wurde am 2. Dezember 1944 aus der Heeresgruppe G herausgenommen und in die neu gebildete Heeresgruppe Oberrhein überführt, deren Oberbefehl Heinrich Himmler am 10. Dezember erhielt und die direkt dem Führerhauptquartier unterstand.
Deutsche Planungen
Ende Dezember 1944 kam nach Anfangserfolgen die deutsche Ardennenoffensive zum Stehen (siehe Belagerung von Bastogne). Um Kräfte für einen amerikanischen Gegenangriff in den Ardennen freizumachen, übernahm die 7. US-Armee grosse Teile des Frontabschnittes der 3. US-Armee im Unterelsass und in Lothringen, der damit zum schwächsten Abschnitt der amerikanischen Front wurde. Andererseits standen dem Oberbefehlshaber West noch mehrere, ab Mitte Januar 1945 einsetzbare Divisionen als Reserve zur Verfügung.

Nach der Billigung des Vorstosses entlang des Vogesenkammes durch von Rundstedt und Generaloberst Johannes Blaskowitz (Oberbefehlshaber der Heeresgruppe G) befahl Hitler, den westlichen Vorstoss unterstützend zu dem Hauptstoss mit mindestens zwei Panzer- und drei Infanterie-Divisionen durchzuführen. Er hatte angesichts der Witterungsbedingungen in den Vogesen (es war ein sehr kalter Winter) Zweifel an der Durchhaltefähigkeit der Truppe. Rundstedt änderte seine Befehle in diesem Sinne noch am 22. Dezember ab.
Tatsächlich musste nur diese Feinplanung vorgenommen werden, denn bereits im Oktober 1944 hatte der Wehrmachtführungsstab Studien für eine Gegenoffensive im Elsass entwickelt. Eine solche Offensive war am 17. und 25. November als Angriff in die Flanke, der möglicherweise über den Rhein stossenden alliierten Kräfte erwogen worden und letztlich zugunsten des Angriffs in den Ardennen verworfen worden. Nun konnte man auf diese Studien zurückgreifen. In einer Besprechung mit Blaskowitz wurden am 24. Dezember die Ziele der Operation festgelegt. Mit der Zaberner Steige zwischen Pfalzburg und Zabern sollten die Verbindungslinien der im nördlichen Elsass stehenden alliierten Kräfte abgeschnitten und Letztere zerschlagen werden. Anschliessend sollte durch einen Vorstoss nach Süden die Verbindung zur 19. Armee hergestellt werden. Zu diesem Zweck wurden im Bereich der 1. Armee unter General der Infanterie Hans von Obstfelder zwei Stossgruppierungen gebildet. Die erste – bestehend aus dem XIII. SS-Armeekorps (zwei Volksgrenadier- und eine SS-Panzergrenadier-Division) – sollte östlich der Blies die alliierten Linien bei Rohrbach durchbrechen und dann gemeinsam mit der zweiten Gruppe in Richtung Pfalzburg antreten. Die zweite Gruppe – bestehend aus dem LXXXX. Armeekorps (zwei Volksgrenadier-Divisionen) und LXXXIX. Armeekorps (drei Infanterie- bzw. Volksgrenadier-Divisionen) – sollte aus dem Raum östlich von Bitche in mehreren Stosskeilen angreifen und danach mit der ersten Gruppe zusammenwirken. Je nach Entwicklung der Lage sollte die Offensive dann entweder östlich oder westlich der Vogesen in Richtung der Linie Pfalzburg–Zabern erfolgen.
Um einen Durchbruch ausnutzen zu können, wurden die 25. Panzergrenadier-Division sowie die 21. Panzer-Division in der Armee-Reserve gehalten. In der offiziellen Sprachregelung vom 25. Dezember 1944 wurde der Operation der Deckname „Unternehmen Nordwind“ zugewiesen.
In die Planungen war am 23. Dezember 1944 auch die südliche Heeresgruppe Oberrhein einbezogen worden, die unter dem Oberbefehl des Reichsführers SS Heinrich Himmler stand. Sie wurde gebeten, durch Stosstruppunternehmen und die Bildung von Brückenköpfen über den Rhein nördlich und südlich von Strassburg die gegnerischen Kräfte dort zu binden. Zeitweilig wurde auch erwogen, mit Teilen der 19. Armee auf Molsheim westlich von Strassburg vorzustossen, wodurch auch die zweite, kleinere Verbindungslinie der Alliierten im Unterelsass gekappt worden wäre. Nachdem Hitler am 27. Dezember 1944 den Beginn der Offensive auf den 31. Dezember um 23 Uhr festgelegt hatte, erhielt die Heeresgruppe ihre endgültigen Aufträge. Sie sollte erst angreifen, wenn die Verbände der 1. Armee die Ostausgänge der Vogesen zwischen Ingweiler und Zabern in Besitz genommen hätten. Ihre Divisionen hatten die Aufgabe, die gegnerische Front nördlich von Strassburg zu durchbrechen und sich im Raum Hagenau–Brumath mit der 1. Armee zu vereinigen. Die Ausführung dieser zunächst nebensächlichen Operationen oblag der 19. Armee unter General der Infanterie Siegfried Rasp. Diese plante neben kleineren Vorstössen in Bataillonsstärke aus dem Brückenkopf Elsass vor allem den Angriff der 553. Volksgrenadier-Division bei Gambsheim über den Rhein.
Nach dem Abschluss der Zerschlagung der alliierten Kräfte im Unterelsass war als Folgeoperation das Unternehmen Zahnarzt vorgesehen, ein Vorstoss in die Flanke der 3. US-Armee.
Hitlers Absicht
Hitler verband mit dem „Unternehmen Nordwind“ nicht nur die Aussicht auf einen weiteren Teilerfolg an der Westfront, sondern auch die Vorstellung, auf diese Weise die festgefahrene Ardennenoffensive wieder ins Rollen zu bringen. Diese Ansichten legte er am 28. Dezember 1944 in einer Ansprache vor den beteiligten Befehlshabern und Kommandeuren dar:

„Ich bin mit den Massnahmen völlig einverstanden, die getroffen worden sind. Ich hoffe, dass es uns gelingen wird, besonders den rechten Flügel [im Raum Bitsch] schnell vorwärtszubringen, um die Eingänge nach Zabern zu öffnen, dann sofort in die Rheinebene hineinzustossen und die amerikanischen Divisionen zu liquidieren. Die Vernichtung dieser amerikanischen Divisionen muss das Ziel sein. […] Schon die blosse Vorstellung, dass es überhaupt wieder offensiv vorgeht, hat auf das deutsche Volk eine beglückende Wirkung ausgeübt. Und wenn diese Offensive weitergeführt wird, wenn die ersten wirklich grossen Erfolge sich zeigen […] können sie überzeugt sein, dass das deutsche Volk alle Opfer bringen wird, die überhaupt menschenmöglich sind. […] Ich möchte daher anschliessend an Sie nur den Appell richten, dass Sie mit Ihrem ganzen Feuer, mit Ihrer ganzen Energie und mit Ihrer ganzen Tatkraft hinter diese Operation treten. Das ist mit eine entscheidende Operation. Ihr Gelingen wird absolut automatisch das Gelingen der zweiten [in den Ardennen] mit sich bringen. […] Wir werden das Schicksal dann doch meistern.“
Deutsche Kräfte
Neben den am Oberrhein in den Bunkern des Westwalls eingesetzten Einheiten des Volkssturms und örtlichen Polizeikräften standen auf deutscher Seite auf dem Papier zahlreiche Divisionen, die jedoch in Teilen nur Regimentsstärke hatten und zum Teil unerfahren waren.
1. Armee
Einteilung in zwei Sturmgruppen,[19] XIII. SS-Armeekorps als Sturmgruppe 1 für den Angriff westlich der Vogesen, LXXXX. Armeekorps und LXXXIX. Armeekorps als Sturmgruppe 2 für den Angriff auf dem Vogesenkamm.

19. Armee

Alliierte Pläne
Noch während die 3. US-Armee zur Abwehr der deutschen Ardennenoffensive umgliederte, wurden dem SHAEF (Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force) die Herausforderungen bewusst, die auf die 6. US-Heeresgruppe mit ihrem nunmehr überdehnten Frontabschnitt zukamen. In einer Folgediskussion am 26. Dezember 1944 teilte der kurz zuvor zum General of the Army beförderte Dwight D. Eisenhower dem Befehlshaber der 6. US-Heeresgruppe Jacob L. Devers mit, dass er zwecks Verkürzung der Front der 6. US-Heeresgruppe deren Rücknahme vom Oberrhein an den Vogesenkamm wünsche. Da weder diese Äusserung noch das nachfolgende Drängen des SHAEF einen förmlichen Befehlscharakter hatten und Devers nach dem Ardennen-Fiasko des alliierten militärischen Nachrichtenwesens Zweifel an der Lagebeurteilung von SHAEF hatte, sah er einen Rückzug nicht als dringlich an. Er liess ihn nur planen, statt ihn durchzuführen. Nach seiner Einschätzung, die auch von dem Befehlshaber der 7. US-Armee Alexander Patch geteilt wurde, war ein deutscher Angriff an der Saar am wahrscheinlichsten, zumal die mittlerweile in den Ardennen eingesetzte Panzer-Lehr-Division im Dezember 1944 hier einen Störangriff durchgeführt hatte. Als weitere, wegen des Geländes aber weniger wahrscheinliche Möglichkeit wurde ein Angriff entlang des Vogesenkammes angesehen, während ein deutscher Angriff in der Oberrheinebene wegen der von den Amerikanern hier gehaltenen Abschnitte der Maginotlinie als abwegig angesehen wurde.
Aus genannten Gründen plante Patch vier Auffangstellungen aus, auf die nacheinander ausgewichen werden konnte:
- Stellungssystem der Maginot-Linie
- Bitsch–Niederbronn–Moder
- Bitsch–Ingweiler–Strassburg
- Ostausläufer der Vogesen.
Alliierte Kräfte
Die Alliierten verfügten auf dem Papier über weniger Divisionen als die Deutschen, hatten dafür aber eine bessere Personal- und Materiallage. Erfahrungs- und Ausbildungsstand unterschied sich von Division zu Division erheblich; einige Verbände kämpften seit dem Italienfeldzug, während andere gerade neu aufgestellt worden und erst im November 1944 eingeführt waren. Letzteres traf insbesondere auf die französischen Verbände zu, von denen viele sich aus der Résistance rekrutierten. Einzelne amerikanische Divisionen befanden sich gerade erst in der Aufstellungsphase; die Infanterieregimenter waren bereits eingetroffen, während die Artillerieanteile sowie die Logistik noch zugeführt werden sollten.
7. US-Armee

1. Französische Armee

Verlauf
Angriff am Vogesenkamm, 1. bis 6. Januar
Die Offensive, die von den Alliierten wegen schlechten Wetters nur ansatzweise aufgeklärt wurde, begann ohne Artillerievorbereitung – als Überraschungsangriff – in den letzten Abendstunden des 31. Dezembers 1944.
Der Angriff der Sturmgruppe 1 stiess auf die tiefgestaffelte Verteidigung der 44. und der 100. US-Infanteriedivision und blieb mit Ausnahme eines drei Kilometer tiefen Einbruches im Raum Bliesbrücken–Rimlingen liegen. Nachdem deutsche Angriffsspitzen am 3. Januar Grossrederchingen genommen hatten und zeitweilig bis zur Ortschaft Achen durchgebrochen waren, kam dieser Angriff am 5. Januar endgültig zum Stehen.
Der Angriff der Sturmgruppe 2 war deutlich erfolgreicher. Der bergige und bewaldete Geländeabschnitt in den Vogesen wurde lediglich von der „Task Force Hudelson“ gehalten, die den angreifenden deutschen Kräften wenig entgegenzusetzen hatte. Nachteilig auf deutscher Seite wirkte sich dort aber die unterbliebene Aufklärung aus, wodurch die angreifenden Verbände orientierungslos waren. Die 361. Volksgrenadier-Division, die vor wenigen Wochen dort noch in Rückzugskämpfe verwickelt gewesen war, gewann dank ihrer Kenntnisse des Geländes am meisten Raum. Innerhalb der nächsten vier Tage kam die Sturmgruppe 2 immerhin 16 Kilometer voran.
Die Lageentwicklung bewog Blaskowitz und Obstfelder dazu, die Anfangserfolge der Sturmgruppe 2 zu nutzen und die gerade aus Norwegen herangeführte 6. SS-Gebirgs-Division „Nord“ dort einzusetzen. Dieser Verband, der deutlich den höchsten Einsatzwert aller deutschen Divisionen dieses Frontabschnittes aufwies, trat über die 257. und 361. Volksgrenadier-Divisionen auf Wingen und Wimmenau an. In den Morgenstunden des 4. Januar besetzten zwei Bataillone dieser Division Wingen und überrannten dabei einen amerikanischen Bataillonsgefechtsstand. Da ihnen jedoch die Fernmeldeverbindungen in Gestalt eines Funklastwagens abhandengekommen waren, konnten sie keine Verstärkungen anfordern. Amerikanische Gegenangriffe scheiterten zunächst, denn sie waren zunächst darauf ausgerichtet, lediglich eine Kompanie aus Wingen zu werfen. Da jedoch kein Unterstützungsangriff seitens der 19. Armee/Heeresgruppe Oberrhein erfolgte, konnten die Amerikaner Kräfte aus Frontabschnitten am Oberrhein abziehen und zu weiteren Gegenangriffen auf Wingen ansetzen. Als der amerikanische Druck übermächtig wurde, setzten sich die mittlerweile abgekämpften deutschen Bataillone in der Nacht vom 6. zum 7. Januar aus Wingen ab.
Strassburger Kontroverse
Die unklare Situation hinsichtlich des von Eisenhower angesonnenen Rückzugs hinter die Vogesen begann während des Angriffes auf Zabern politische Kreise zu ziehen. Noch am Nachmittag des 1. Januars rief der Chef des Stabes von SHAEF General Devers an und warf der 7. US-Armee Befehlsverweigerung vor, da sie nicht auf die Vogesen ausweiche. Devers gab hieraufhin an, dass die diesbezüglichen Vorbereitungen anliefen, wegen der Verhältnisse vor Ort aber Zeit benötigen würden. Noch am gleichen Tage teilte Devers Patch mit, dass seine Armee bis zum 5. Januar hinter die Vogesen ausweichen und die Oberrheinebene samt Strassburg aufgeben müsse. Patch begann unverzüglich mit der Umsetzung, indem er die im Zuge der Lauter eingesetzten Verbände nach Süden zurücknahm. Zeitgleich mit dem Befehl an Patch gab Devers diese Information über die französischen Verbindungsoffiziere an die französische Regierung weiter. Daraufhin protestierte de Gaulle in einem Brief an Devers. Hintergrund der französischen Haltung war vor allem die jüngere Geschichte des Elsass als Zankapfel zwischen Deutschland und Frankreich. Vor allem Strassburg, wo Claude Joseph Rouget de Lisle 1792 die Marseillaise komponiert hatte, besass bei den Franzosen einen Stellenwert, der nur von der Hauptstadt Paris übertroffen wurde. Ausserdem wurde befürchtet, dass eine erneute deutsche Besetzung Repressalien gegen diejenigen Teile der Bevölkerung nach sich ziehen würde, die nach der Einnahme durch die Alliierten am 23. November 1944 offen ihre Loyalität gegenüber Frankreich gezeigt hatten. Devers, der die Haltung Frankreichs teilte, entsandte daraufhin am 2. Januar seinen Chef des Stabes, Generalmajor Barr nach Paris zu Eisenhower, um klare Anweisungen zu erhalten. De Gaulle nahm auch Verbindung mit Roosevelt und Churchill auf und bestellte Eisenhower am 3. Januar zu einem Gespräch nach Paris, wo Churchill als Mediator fungierte. De Gaulle bezeichnete Eisenhowers Entscheidung als nationale Katastrophe, wohingegen Eisenhower an seiner Entscheidung zunächst festhielt und der französischen 1. Armee die Schuld gab, da sie bei der Zerschlagung des Brückenkopf Elsass versagt habe. Hieraufhin drohte De Gaulle mit einem Ende der französischen Beteiligung bei SHAEF, während der ebenfalls anwesende General Alphonse Juin Andeutungen machte, Frankreich werde den Alliierten die Nutzung seines Eisenbahnnetzes verwehren. Eisenhower akzeptierte am Ende unter Churchills Lob die französischen Bedenken. Der ebenfalls anwesende Generalmajor Barr gab die Information sofort an Devers weiter, noch bevor die Entscheidung am 7. Januar in Form eines Communiques schriftlich fixiert wurde. Devers stoppte die Absetzbewegungen von der Lauter.
Kämpfe in der Oberrheinebene
Nach der Räumung Wingens gab das OKW den Angriff im Zuge der Vogesen, beziehungsweise westlich davon auf und verlagerte den Schwerpunkt. Die ursprüngliche Absicht der Heeresgruppe G, den Angriff nunmehr mit gepanzerten Kräften am Ostrand der Vogesen über das Zwischenziel Rothbach westlich Hagenau zu führen, wurde wegen der nachstehend beschriebenen Lageentwicklung im Frontabschnitt der 19. Armee aufgegeben, und zwar zugunsten eines Angriffes unmittelbar in der Oberrheinebene ostwärts von Hagenau.
Neuer Brückenkopf bei Gambsheim, 5. bis 10. Januar
Noch während des Angriffs der Sturmgruppe 2 auf Wingen gelang der der 19. Armee unterstellten 553. Volksgrenadier-Division, die von allen beteiligten deutschen Divisionen den niedrigsten Einsatzwert hatte, in der Nacht vom 4. auf den 5. Januar die Bildung eines Brückenkopfes am Zusammenfluss von Zorn und Moder bei Gambsheim. Da die amerikanischen Verbände – hier Task Force Linden – die Verteidigung dieses Frontabschnittes nur durch Spähtrupps sicherstellen konnten und da die Bevölkerung in dieser Region deutschfreundlich war, konnten die Soldaten der 553. Volksgrenadier-Division ungehindert in ihren Sturmbooten über den Rhein setzen, den Brückenkopf nach seiner Sicherung auf Herlisheim und Offendorf ausweiten und sich im Südwesten bis an den Ortsrand von Kilstedt vorschieben.
Die Versorgung des Brückenkopfes wurde nachts durch Fährbetrieb sichergestellt, da eine Brücke Luftangriffen der alliierten Luftwaffe ausgesetzt gewesen wäre. Die Bedrohung aus diesem Brückenkopf wurde von den Alliierten als so gering eingeschätzt, dass sie die nächsten drei Tage keinen Versuch zur Abriegelung unternahmen, wenngleich Patch dem Kommandeur des VI. US-Korps bereits am 6. Januar den Befehl zur Zerschlagung des Brückenkopfes gegeben hatte. Erst am 8. Januar setzte er Teile der 12. US-Panzerdivision auf den Brückenkopf an, und zwar Combat Command B (ein Manöverelement in Brigadestärke) gegen vermeintlich nur 500 bis 800 unorganisierte deutsche Infanteristen des Brückenkopfes. Tatsächlich befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits 3330 deutsche Soldaten, verstärkt durch Panzerabwehrkanonen, in gut ausgebauten Stellungen. Demgegenüber verringerte die schwache Infanteriekomponente der 12. US-Panzerdivision den Einsatzwert dieses Verbandes. Combat Command B trat am 8. Januar auf Herlisheim an. Zwar gelang es, mit Infanterie in Herlisheim einzudringen, da jedoch die amerikanischen Panzer von den deutschen Panzerabwehrkanonen in Schach gehalten werden konnten und zudem die Funkverbindung zu den Infanteristen abriss, räumten letztere in den Morgenstunden des 10. Januar Herlisheim.
Unternehmen Sonnenwende, 8. bis 12. Januar
Die eigentliche Unterstützung der 19. Armee, Deckname Unternehmen Sonnenwende, bestand in einem Angriff ab 8. Januar 1945 durch die zwischen Rhein und Ill eingesetzte 198. Infanterie-Division, Teile der 269. Infanterie-Division und die Panzerbrigade 106 aus dem Brückenkopf Elsass auf Strassburg. Der betreffende Frontabschnitt war kurz zuvor von den Amerikanern an die 1. Französische Armee übergeben worden. Den deutschen Verbänden gelang es, sämtliche südöstlich der Ill eingesetzten französischen Kräfte zurückzuwerfen und so das Dreieck zwischen Ill und Rhein wieder unter Kontrolle zu bringen.[38] Hierbei wurden drei französische Kampfgruppen in Bataillonsstärke abgeschnitten und bis zum 13. Januar vernichtet. Gleichwohl gelang es den französischen Kräften, an der Ill im Zuge der Ortschaften Benfeld, Erstein und Kraft den deutschen Angriff am 12. Januar aufzufangen und zum Stehen zu bringen. Das eigentliche Ziel, die Einnahme Strassburgs, wurde nicht erreicht.
Kämpfe um Hatten-Rittershofen, 8. bis 20. Januar
Die in der nordöstlichen Ecke des Elsass eingesetzten amerikanischen Streitkräfte hatten in Umsetzung des Rückzugsbefehls von Eisenhower bereits in den ersten Januartagen den Raum an der Lauter geräumt und somit Reipertsweiler und Weissenburg aufgegeben. Nach der Intervention de Gaulles bezogen sie an der Maginot-Linie die erste der geplanten Auffangstellungen. Lediglich im Raum Hatten gelang es am 8. Januar den aus dem Bienwald heraus nachdrängenden, zur Kampfgruppe Feuchtinger verschmolzenen 21. Panzer-Division und 25. Panzergrenadier-Division, über die Maginot-Linie hin aus vorzustossen. Auf Drängen Himmlers bestand die Absicht des OKW nunmehr darin, über Hatten auf Hagenau vorzustossen und sich im Raum Bischweiler mit den aus dem Brückenkopf Gambsheim entgegenstossenden Kräften zu treffen, so das VI. US-Korps im Raum Sufflenheim einzuschliessen und es dann zu vernichten, oder zumindest die alliierten Kräfte hier frontal zu binden, damit die am Vogesenkamm stehende Sturmgruppe 2 und die im Brückenkopf Gambsheim stehenden Kräfte – verstärkt durch die ursprünglich für Unternehmen Zahnarzt vorgesehenen Reserven – auf Hagenau vorstossen und somit das VI. US-Korps einschliessen konnten.
In der Folge wechselten Teile dieses Ortes und des benachbarten Rittershofen in erbitterten Kämpfen immer wieder den Besitzer, wobei weder Amerikaner noch Deutsche die Oberhand gewinnen konnten, obwohl Letztere vom 11. bis zum 15. Januar Verstärkung durch die 7. Fallschirmjäger-Division erhielten. Auch die Zivilbevölkerung hatte hohe Verluste zu beklagen, da sie von den Amerikanern nicht evakuiert wurde. Zeitgleiche Versuche, den ursprünglichen Angriff der Sturmgruppe 2 auf Zabern wieder vorzutragen, scheiterten, wenngleich der 6. SS-Gebirgs-Division „Nord“ am 16. Januar die Einschliessung und Zerschlagung einer amerikanischen Kampfgruppe gelang. Unterdessen gelang es der 7. Fallschirmjäger-Division, sich am linken Rheinufer den Weg bis zum Brückenkopf Gambsheim freizukämpfen und so eine Landverbindung herzustellen.
Patt bei Herlisheim, 16. bis 21. Januar
Da am 10. Januar der Versuch von Combat Command B, den Brückenkopf von Gambsheim einzudrücken, gescheitert war, setzte der Kommandeur des VI. US-Korps am 13. Januar die gesamte 12. US-Division dort ein, die am 16. Januar erneut antrat, Combat Command B erneut auf Herlisheim und Combat Command A auf Offendorf und den nahe gelegenen Steinwald. Auch diesmal gelang es dem Combat Command B, in Herlisheim einzudringen, doch die Geländegewinne gingen durch einen deutschen Gegenangriff wieder verloren. Von den Amerikanern unbemerkt setzte die 10. SS-Panzer-Division in der Nacht vom 15. zum 16. Januar mit Fähren über den Oberrhein und bezog in dem Brückenkopf einen Verfügungsraum. Der Divisionsgefechtsstand wurde nach Offendorf verlegt und begann mit der Planung eines Ausbruches aus dem Brückenkopf für den 17. Januar. Dieser Angriff lief planmässig vor dem Morgengrauen an und mündete in einem unentschiedenen Begegnungsgefecht mit dem ebenfalls (erneut) angreifenden Combat Command A. Es zeigte sich, dass in dem von Ortschaften, der Zorn sowie von Bahndämmen und Entwässerungsgräben durchzogenen Gelände der Einsatzwert von Panzern gering war und sie leicht eine Beute von Panzerabwehrkanonen und Panzerfäusten wurden. Auch ein Versuch von Combat Command B, Herlisheim nördlich zu umgehen, schlug fehl. Am 18. Januar gelang es der zur 10. SS-Panzer-Division gehörenden 3./SS-Panzerabteilung 10, ein in Herlisheim eingedrungenes US-Panzerbataillon zu zerschlagen, hierbei zehn Sherman-Panzer zu erbeuten und ein ebenfalls dort eingesetztes US-Infanteriebataillon aufzureiben. Am 19. Januar gelang bei Drusenheim die Zerschlagung eines weiteren, der 79. US-Infanteriedivision angehörenden Bataillons.
Die 3. Französische Infanteriedivision wies vom 17. bis zum 21. Januar Angriffe der 10. SS-Panzer-Division auf Kilstedt blutig ab.
US-Rückzug hinter die Moder, 20. und 21. Januar
Trotz der Abwehrerfolge der Franzosen bei Kilstedt bestand die Gefahr, dass die 10. SS-Panzer-Division weiter nördlich aus dem Brückenkopf ausbrechen würde, wo sie gerade drei amerikanische Bataillone zerschlagen beziehungsweise aufgerieben hatte. Mit einem Vorstoss aus dem Raum Drusenheim nach Westen im Zuge des nördlichen Moderufers hätte sie die amerikanische Front bei Hatten und Rittershofen aus den Angeln heben können. Die Gefahr eines erneuten Angriffs der Sturmgruppe 2 sowie der kräftezehrende Kampf um Hatten und Rittershofen vervollständigte ein Lagebild, wonach der Frontbogen des VI. US-Korps langsam unhaltbar wurde. Zwar wurden durch die Beseitigung des deutschen Frontvorsprunges in den Ardennen die 101. US-Fallschirmjägerdivision und die 28. US-Infanteriedivision frei und in den Elsass verlegt, doch verzögerten schlechte Witterungsbedingungen das Eintreffen dieser Verstärkungen. Es gelang Patch, Devers Einverständnis für einen Rückzug zu erwirken, mit dem das Korps am Südufer von Rotbach, Moder und Zorn im Zuge einer deutlich verkürzten Frontlinie die zweite Auffangstellung beziehen konnte.
Die Absetzbewegung begann in der Nacht vom 20. auf den 21. Januar und wurde durch schlechtes Wetter begünstigt; deutsche Truppen bemerkten den Rückzug erst, als er bereits erfolgt war. Sie drängten am 22. Januar nach und erweiterten die Landverbindung zum Brückenkopf Gambsheim.
Nachdrängen deutscher Kräfte bis zum 25. Januar
Der Rückzug der alliierten Kräfte führte zur Preisgabe von grossen Abschnitten der Maginot-Linie. Deutsche Kräfte waren damit ihrem Operationsziel Zabern so nah wie während der Kämpfe um das Zwischenziel Wingen. Daher bestand unverändert die deutsche Absicht, auf Zabern vorzustossen. Durch die Geländegewinne ermutigt, unternahmen deutsche Kräfte unmittelbar danach den vergeblichen Versuch, Hagenau und Bischweiler zu nehmen. In der Nacht vom 24. auf den 25. Januar traten Teile von drei deutschen Divisionen im Raum zwischen Neuburg und Schweighausen an, wurden jedoch nach Anfangserfolgen zurückgeschlagen. Ebenfalls am 25. Januar wurden Angriffe der 6. SS-Gebirgs-Division „Nord“ auf Bischholz und Schillersdorf abgewehrt. Zu diesem Zeitpunkt war angesichts des Zusammenbruchs der deutschen Front im Osten eine Fortsetzung der Angriffe nicht mehr möglich. Hitler befahl daher, die Offensive einzustellen. In der Folge wurden am 27. Januar die 21. Panzer-Division und die 25. Panzergrenadier-Division herausgezogen und an die Ostfront verlegt, die 10. SS-Panzer-Division folgte im Februar.
Folgen
Nach dem Abschluss der Offensive hielten deutsche Kräfte wieder rund 40 Prozent des Elsass besetzt. Als taktische Erfolge konnten sie eine Verkürzung der Front und im Vergleich zu den Alliierten geringere Verluste verbuchen. Strategische Erfolge blieben ihnen jedoch versagt; eine Zerschlagung nennenswerter alliierter Kräfte gelang ihnen ebenso wenig wie die Einnahme Strassburgs.
Durch das Ausweichen hinter die Moder verschafften sich die alliierten Kräfte sogar die Handlungsfreiheit für einen Angriff auf den Brückenkopf Elsass, der zur Zerschlagung mehrerer deutscher Divisionen in den Vogesen und zur Beseitigung ebendieses Brückenkopfes am 9. Februar 1945 führte. In diesem Zeitraum wurden auch Teile des ehemaligen Gambsheimer Brückenkopfes zurückerobert, während das Gebiet zwischen Moder und den deutschen Ausgangsstellungen erst während Operation Undertone im März 1945 von deutschen Truppen geräumt wurde.
Strategisch gesehen band das Unternehmen Nordwind – ähnlich wie der Verbleib deutscher Verbände in den Ardennen – Kräfte, die angesichts des Zusammenbruches der Ostfront dort sehr viel dringender benötigt worden wären; Nordwind wurde erst zu einem Zeitpunkt abgebrochen, als die Rote Armee bereits die Hälfte von Ostpreussen überrannt (Ostpreussische Operation (1945) ab 13. Januar 1945) und Posen eingeschlossen hatte. Diese Lageentwicklung konnte durch die Verlegung der vormals im Elsass eingesetzten Divisionen nicht mehr rückgängig gemacht werden.
Sämtliche taktische Erfolge hätten durch Räumung des Brückenkopfes Elsass zu einem deutlich geringeren Preis erkauft werden können. Die erbitterten Kämpfe vermochten am Ausgang des Krieges nichts zu ändern. Sie erhielten jedoch auch nach dem Scheitern der Ardennenoffensive bei den Westalliierten den Eindruck aufrecht, das Dritte Reich sei noch nicht am Ende seiner Kräfte.
Die Strassburger Kontroverse war mitursächlich für den von de Gaulle 1966 vollzogenen teilweisen Bruch mit der NATO und nährte selbst in der Bundesrepublik Deutschland Zweifel am amerikanischen Beistand im Falle eines sowjetischen Angriffes.
Unternehmen Bodenplatte (01.01.1945)
Das Unternehmen Bodenplatte war ein Luftangriff durch Jagdflugzeuge der deutschen Luftwaffe auf Flugplätze der Alliierten in den Niederlanden, Belgien und Frankreich am 1. Januar 1945. Die Luftwaffe plante, bei diesem Angriff 17 feindliche Frontflugplätze zu zerstören. Während tatsächlich einige hundert alliierte Flugzeuge zerstört oder beschädigt wurden, fielen die hohen eigenen Verluste, vor allem an erfahrenen Piloten, ins Gewicht und beschleunigten den Niedergang der Luftwaffe wesentlich.
Planung und Durchführung
Im Herbst 1944 begann die deutsche Wehrmacht mit der Planung einer grossen Offensive gegen die Alliierten im Gebiet der Ardennen („Unternehmen Wacht am Rhein“). Die Vorbereitungen für einen begleitenden Einsatz der Luftwaffe gegen alliierte Flugplätze begannen am 16. September. Ab 16. Oktober wurde mit Verlegungen von Einheiten aus dem Reichsgebiet in die Nähe des Operationsgebietes begonnen. Der Befehl Hermann Görings verlangte einerseits, die alliierten taktischen Luftstreitkräfte durch einen Überraschungsangriff auf ihre Flugplätze entscheidend zu dezimieren, und andererseits den eigenen Bodentruppen durch Luftunterstützung Bewegungsfreiheit zu verschaffen. Mit der Durchführung wurde Generalmajor Dietrich Peltz als Kommandeur des II. Jagdkorps beauftragt, der am 5. Dezember die Detailplanung des „Unternehmens Bodenplatte“ mit den Geschwaderkommandeuren leitete. Dafür wurde die Mehrzahl der verfügbaren Jagdflugzeuge vorgesehen. Diese sollten die Bomber- und Jägerverbände der in Belgien, Frankreich und in den Niederlanden stationierten Royal Air Force (RAF) und der United States Army Air Forces (USAAF) im Tiefflug angreifen und nach Möglichkeit eine grosse Anzahl feindlicher Flugzeuge am Boden zerstören. Die Bodenoffensive, die später als Ardennenoffensive bezeichnet wurde, begann planungsgemäss am 16. Dezember. Wegen schlechten Wetters konnte der begleitende Luftangriff nicht gleichzeitig stattfinden. Wegen der langen Verzögerung und der ins Stocken geratenen Bodenoffensive nahmen angeblich einige Geschwaderkommandeure an, Bodenplatte sei abgesagt, als am 31. Dezember 1944 der Befehl zur Durchführung kam.
Überraschungsangriff
Alle Jagdgeschwader, die zur Reichsverteidigung an der Westfront stationiert waren, nahmen an dem Angriff teil. Sie waren hierzu auf den Fliegerhorsten Bonn-Hangelar, Köln-Ostheim und Köln-Wahn stationiert. 44 Junkers-Ju-88-Nachtjäger der II. bzw. III./ NJG 1, III./ NJG 5, II./ NJG 6, II./ NJG 100 und I. bzw. II./ NJG 101 leiteten als „Lotsen“ die Angriffsverbände zu ihren Angriffszielen.
Die Hauptlast des Angriffes trugen einmotorige Jäger und Jagdbomber der Typen Messerschmitt Bf 109 und Focke-Wulf Fw 190, die wegen der Einsatzlänge keine Bomben mitführen konnten. Über dem Einsatzgebiet kam es zu heftiger Gegenwehr durch Flugabwehrgeschütze, nur verhältnismässig wenige alliierte Abfangjäger konnten zur Verteidigung aufsteigen. Da die deutschen Flugzeugführer zumeist unerfahren und für Luft-Bodeneinsätze kaum ausgebildet waren, konnte der Überraschungseffekt kaum genutzt werden.
Übersicht über Angriffsziele und beteiligte Einheiten
Den Jagdgeschwadern (JG), Kampfgeschwadern (KG) und Schlachtgeschwadern (SG) der Luftwaffe standen auf alliierter Seite gegenüber:
Die Royal Air Force mit der 2nd Tactical Air Force (2nd TAF). Diese war in vier Groups (Geschwader) eingeteilt, die sich wiederum in Wings (dt. Gruppe) von drei bis fünf Squadrons (entspricht einer deutschen Staffel) mit durchschnittlich zwölf einsatzfähigen Flugzeugen aufteilten.
die 8. und 9. US-Luftflotte. Diese unterteilten sich in Fighter Groups (Jagdgeschwader) und Bombardment Groups (Bombergeschwader) und weiter in Squadrons.
Die Aufgaben der 2nd TAF und der 9. US-Luftflotte war während der Invasion in der Normandie vor allem die Luftnahunterstützung der Bodentruppen gewesen. Mit dem Fortschreiten des Bodenkrieges wurden die Einheiten auf das europäische Festland verlegt. Die Aufgabe der 8. US-Luftflotte war der strategische Luftkrieg gegen Deutschland.


Auftrag „Hermann“
Die letzte Eintragung im Flugbuch vieler deutscher Piloten lautete: „Auftrag Hermann 1.1.1945, Zeit: 09:20 Uhr“. Als die Unterlagen bei den abgeschossenen Piloten gefunden wurden, dachte man auf alliierter Seite zunächst, es handele sich um die „Operation Hermann“, also um ein nach seinem mutmasslichen Planer, Hermann Göring, benanntes Unternehmen. Tatsächlich stand „Hermann“ lediglich für „Angriffstermin“ und bedeutete, dass alle Verbände um 09:20 Uhr den Angriff auf die gegnerischen Flugplätze eröffnen würden. Hermann Göring selbst hatte mit der komplexen Planung des Unternehmens nichts zu tun.
Air Vice Marshal (Generalleutnant) John Edgar „Johnnie“ Johnson, der sich an diesem Tag in Brüssel-Evere aufhielt, beschrieb den Angriff so:

„Operation Hermann war ein kühner Schlag. Wir konnten feststellen, dass der durchschnittliche deutsche Pilot der Aufgabe nicht gewachsen war“.
Ergebnis
Schlussfolgerungen basierend auf den letzten Erkenntnissen zufolge sind insgesamt 305 alliierte Flugzeuge zerstört und 190 beschädigt worden. Davon wurden 15 Flugzeuge durch Luftkämpfe verloren und 10 beschädigt.
Von den rund 850 eingesetzten deutschen Flugzeugen gingen 292 verloren. Dabei fielen 213 Piloten oder wurden gefangen genommen. Auf dem Hin- und Rückflug wurden nach heutigen Erkenntnissen 30–35 Maschinen durch die deutsche Flugabwehr (Flak) abgeschossen, frühere Publikationen nennen wesentlich höhere Verluste. Aufgrund von Geheimhaltung, Planungsmängeln und Abweichungen von der Flugroute waren manche deutsche Batterien nicht über den Überflug von eigenen Kräften informiert gewesen.
Besonders folgenschwer für die Kampfkraft der Jagdverbände war der Verlust von insgesamt 22 Verbandsführern. Drei Geschwaderkommodore, fünf Gruppenkommandeure und 14 Staffelkapitäne kehrten von dem Einsatz nicht mehr zurück.
Folgen
Die Alliierten führten in den darauffolgenden zwei Wochen keinen Grossangriff von den getroffenen Flugplätzen durch.
Die deutsche Heimatverteidigung war durch den hohen Verlust an Piloten unwiderruflich gebrochen. Die deutsche Ardennenoffensive war spätestens seit dem 3. Januar gescheitert, als die alliierte Gegenoffensive begonnen hatte.
Das Ende der Luftwaffe – April und Mai 1945
Die militärische Situation der deutschen Streitkräfte verschlechterte sich gegen Ende des Zweiten Weltkriegs quasi stündlich. Die alliierten Streitkräfte drückten von Westen und Süden in das restliche von den deutschen Truppen gehaltene Gebiet, während sich die sowjetischen Truppen von Osten unaufhaltsam und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Berlin vorkämpften.Ohne Flugzeuge, Ersatzteile, Munition und Treibstoff sah die Luftwaffe spätestens ab Anfang April 1945 ihrem Ende entgegen. Trotzdem flogen Piloten noch bis zuletzt Einsätze gegen die Alliierten. Die letzten Luftkämpfe fanden tatsächlich noch am 8. Mai 1945 statt, am letzten Tag des Krieges in Europa.
Als sich Teile der Roten Armee und Einheiten der US Army am 25. April 1945 in Torgau an der Elbe die Hände reichten, waren die deutschen Truppen in drei Regionen aufgeteilt: Teile Tschechiens, Bayerns, Österreichs, Südtirols und Norditaliens, die nach dem Willen Hitlers eine „Alpenfestung“ bilden sollten, sowie Norddeutschland mit Berlin und als dritte Region das Baltikum, damals Kurland genannt. Die Luftwaffe hatte nach dem „Unternehmen Bodenplatte“ am Neujahrstag 1945 keine eigene gross angelegten Offensivoperationen mehr durchführen können. Das „Unternehmen Bodenplatte“, bei dem zwar mehrere Hundert alliierte Flugzeuge zerstört wurden, traf die Luftwaffe härter als ihre Gegner, denn sie verlor an diesem Tag 290 Flugzeuge und über 240 Piloten. Diese waren in der Folge nicht zu ersetzen, sodass diese Operation den Niedergang der deutschen Luftwaffe beschleunigte.
Zwar wurde gerade 1945 noch mit Hochdruck an verschiedenen neuen Flugzeugtypen gearbeitet, wie Bachem Natter, Messerschmitt P.1101, Heinkel He 162 oder Focke-Wulf Ta 152, aber einige dieser Flugzeuge wurden nicht mehr vor Kriegsende geflogen beziehungsweise kamen nicht über das Erprobungstadium hinaus oder wurden nicht mehr regulär eingesetzt. Die industriellen Ressourcen des untergehenden Deutschen Reiches wurden durch den Vormarsch der Alliierten immer geringer.
Am 9. April 1945 meldete die Luftwaffe einen Bestand von 3331 einsatzfähigen Flugzeugen, darunter 1310 Jäger, 480 Nachtjäger, 917 Schlachtflieger und 37 Bomber. Aber Munition und Treibstoff waren knapp, zudem war die Luftüberlegenheit der gegnerischen Luftstreitkräfte erdrückend. Alliierte Flugzeuge beherrschten nach Belieben den Himmel über Deutschland, Tiefflieger warteten in der Nähe der verbliebenen Flugplätze auf startende oder landende deutsche Flugzeuge, die zur leichten Beute wurden. Transportflugzeuge konnten nur noch im Schutz der Dunkelheit fliegen, ansonsten wären sie sofort abgeschossen worden. Trotzdem flog die Luftwaffe im wahrsten Sinne des Wortes bis zum letzten Tag des Krieges in Europa noch Einsätze. Wir haben Berichte von Augenzeugen aus diesen Tagen gesammelt, die das Ende der Luftwaffe aus eigenem Erleben beschreiben.
Siegfried Radtke, der beim Kampfgeschwader 54 diente, schrieb in einem Buch über die letzten Tage des Krieges, die er in Prag erlebte:

„Zum 1. Mai sind noch sieben Me 262 (Jabo) der 2./KG51 über Hörsching nach Prag gelangt. Vom 1. bis zum 5. Mai werden mit allen einsatzklaren Me 262 Tiefangriffe auf die vorstossenden Kolonnen der Amerikaner und Sowjets geflogen. Es geht längst nicht mehr um Sieg oder Niederlage, sondern nur noch um das Überleben und um die Rettung von möglichst vielen Flüchtlingen und Soldaten“.
Im Osten versucht die Luftwaffe zwischen März und April 1945 noch, die Oderbrücken zu zerstören, um die Nachschubverbindungen der Roten Armee für ihren Sturm auf Berlin zu unterbrechen. Dabei kommt es zu mehreren Angriffen mit Mistelgespannen. Am 27. April greift beispielsweise ein Verband mit sieben Mistelgespannen des KG200 die Oderbrücke bei Küstrin an, die den Sowjets unzerstört in die Hände gefallen ist. Sie erhalten Jagdschutz von mehreren Fw 190. Unter der Führung von Leutnant Eckard Dittmann erreichen sie die Oder, aber können aufgrund der Wolken ihr Ziel nicht genau ausmachen. Zwei Mistelflugzeuge werden auf das Ziel abgeworfen, verfehlen aber die Brücke. Fünf Mistelgespanne gelten nach dem Einsatz als vermisst. Allerdings wird vermutet, dass sie sich nach Dänemark abgesetzt haben, da wenig später in Tirstrup britische Truppen einige Mistelgespanne unversehrt vorfinden.
In Leck in Schleswig-Holstein bereiten die Angehörigen des Jagdgeschwaders 4 (JG4) die Übergabe ihrer Flugzeuge an die Briten vor. Im Kriegstagebuch des JG4 steht dazu: „Wir bauen die Flugzeuge, Kraftfahrzeuge und alles Gerät parademässig auf. Der Engländer wird staunen über das imposante Bild am Platz. Uns erfüllt der Anblick von mehr als 100 Maschinen mit einer stolzen Wehmut. Neueste Muster, die Me 262 und He 162, kaum im Einsatz gewesen, stehen zwischen den alten braven ‚Beulen‘ Bf 109 G und den Stürmern Fw 190, die in tausenden von Luftschlachten siegreich waren und warten auf die Übergabe an den Feind“. Unter dem 7.5.45 steht im Tagebuch:

„Wir haben die Luftschrauben und ein Leitwerksruder von den Flugzeugen abzunehmen und die Munition herauszunehmen. Das Bild auf dem Horst ist für uns Flugzeugführer ein unsagbar trauriges und schmerzvolles. Unser Stolz, unsere Waffe, unsere Welt so nackt dastehen zu müssen! Wohl 30 bis 40 Me 262, die schnellsten Jagdflugzeuge der Welt, stehen dicht nebeneinandergesetzt zur Abgabe vor einer Halle!“
Letzter Luftsieg am 8. Mai 1945
Woanders wird zu diesem Zeitpunkt noch gekämpft und Menschen sterben. Am 8. Mai 1945 flog Oberleutnant Gerhard Thyben von der 7./JG54 aus dem Kurland-Kessel noch mit seiner Focke-Wulf Fw 190 über der Ostsee. Er war früh am Morgen gestartet und sah kurz vor acht Uhr eine russische Petljakow Pe-2. Er nahm an, dass sie nach Schiffen suchte, die Flüchtlinge aus dem Kurland-Kessel nach Schleswig-Holstein bringen wollten. Er griff die Pe-2 an und schoss sie ab. Das Flugzeug versank in der Ostsee, mit ihm die dreiköpfige Besatzung, bestehend aus den Helden der Sowjetunion, Alexeji Gratschew, Gregori Davidenko und Michail Muraschko. Thyben flog dann nach Westen und landete in britisch besetztem Gebiet.
Unteroffizier Bernhard Ellwanger, Schlachtflieger bei der III/SG77, flog am 8. Mai noch einen Einsatz. Er war in Pardubice stationiert. Er berichtete nach dem Krieg: „Am 8. Mai waren alle Flugzeuge bis auf vier enttankt worden. Warum meine 190 zu den vier Flugzeugen gehörte, die noch über Treibstoff verfügten, kann ich heute nicht sagen. Geführt von Hauptmann Günther Ludigkeit, dem Staffelkapitän der 7. Staffel, sind wir in Pardubice gestartet und haben direkt Kurs auf Prag genommen. Unser Einsatzbefehl lautete, einen Sender der tschechischen Partisanen zu zerstören. Als wir über der Stadt ankamen, so ungefähr in 4000 Metern Höhe, habe ich aus Westen kommend Hunderte von amerikanischen Jagdflugzeugen gesehen, die wie zu einer Luftparade aufgereiht flogen. Sie blinkten in der Sonne. Wir waren von diesem Schauspiel so fasziniert, dass wir beinahe unseren Auftrag vergassen. Unser Schwarm kippte nach links ab und startete seinen Angriff. Als das Ziel in meinem Revi auftauchte, warf ich die Bombe, so ungefähr aus 1500 Meter Höhe. Sie war ein Volltreffer. Dann sind wir in Richtung Osten zu unserem Platz zurückgeflogen und gelandet. Dies war mein letzter Flug und auch meine letzte Chance, mich in den Westen zu den Amerikanern abzusetzen“.
Auch Major Erich Hartmann, der erfolgreichste Jagdflieger aller Zeiten, war am letzten Tag des Kriegs in Europa noch in einen Luftkampf verwickelt. An diesem Tag flog er eine Bf 109 K-4. In einem Interview nach dem Krieg erzählte er: „Am 8. Mai 1945 bin ich gegen acht Uhr vom Flugplatz Brod in Ostböhmen in Richtung Brünn gestartet. Mein Kaczmarek und ich haben kurz nach dem Start acht Jaks gesehen. Sie flogen völlig unbedacht Kunstflug unter uns, über der brennenden Stadt. Wir haben angegriffen, und ich habe eine abgeschossen, die gerade einen Looping drehte. Dies war mein letzter Luftsieg. Ich habe mich entschlossen, die anderen Jaks nicht zu attackieren, denn über uns tauchten zwölf Mustangs auf. Mit meinem Flügelmann sind wir sofort abgetaucht. Im Tiefflug konnten wir in den Rauchwolken der Bodenkämpfe entkommen. Zurück am Platz sind wir gelandet, und man hat uns gesagt, der Krieg sei zu Ende. Während des gesamten Krieges habe ich nie einen Befehl verweigert, aber als General Seidemann mir und Hermann Graf befohlen hat, nach Dortmund in den britischen Sektor zu fliegen, damit wir uns dort ergeben und nicht in die Hände der Russen fallen, habe ich mir gesagt, ich kann doch nicht meine Einheit im Stich lassen und allein in sowjetische Gefangenschaft gehen lassen.
Also haben wir die restliche Munition und die verbliebenen Flugzeuge vernichtet, alles. Das muss man sich einmal vorstellen: Wir haben 25 Jagdflugzeuge, die in einem relativ guten Zustand waren, einfach angezündet. Es wäre schön, wenn man sie heute in einem Museum sehen könnte. Ich bin dann mit meiner Einheit nach Westen marschiert, wo wir uns den Amerikanern der 90. Infanterie-Division ergeben haben“.
Manfred Böhme schreibt in der Chronik des Jagdgeschwaders 7, das mit Me 262 ausgerüstet in Prag stationiert war, über das Ende des Krieges: „Die am 6. Mai einsetzende Beschiessung des Flugplatzes Rusin durch Artillerie und Granatwerfer hatte die ohnehin schon geschrumpfte Zahl flugfähiger Düsenjäger noch weiter dezimiert. Als um die Mittagsstunden des 7. Mai die Gefahr des Überrollens durch die Wlassow-Armee drohte, wurden diese Maschinen gesprengt und die noch flugklaren Turbos nach Saaz beordert. Dort waren am Morgen des 8. Mai 1945 die Reste der eingesetzten Düsenflugzeuge, etwa 15 bis 20 Me 262, zusammengezogen. Mangels anderslautender Befehle wurde den Flugzeugführern in den Stunden unmittelbar vor Inkrafttreten der Gesamtkapitulation freigestellt, mit ihren Maschinen Zielorte ihrer Wahl anzufliegen. So kam es im Laufe des Tages zur völligen Auflösung des Geschwaders. Manche Piloten entschieden sich für ihre Heimatorte im anglo-amerikanisch besetzten Gebiet“.
Böhme führt aber auch aus, dass ein Pilot, der Staffelkapitän Oberleutnant Fritz Stehle, noch am späten Nachmittag mit seiner Me 262 und einem Rottenflieger zu einem Einsatz startet, auf dem er den wohl letzten Abschuss eines Jagdflugzeugs der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg erzielt. Gegen 15.20 Uhr treffen Stehle und sein Rottenflieger über Freiberg im Erzgebirge auf eine Jak-9, die keine Chance gegen die schnellen Me 262 hat. Sie schiessen sie ab und setzen ihren Flug fort in Richtung britisch besetzter Zone. Sein Rottenflieger und er trennen sich, Stehle landet unbehelligt in Fassberg und übergibt sein Jagdflugzeug den Briten.
Westkarpatische Operation (12.01.1945 – 18.01.1945)
Die Westkarpatische Operation war eine Offensive der Roten Armee während des Zweiten Weltkrieges, die vom 12. Januar bis zum 18. Februar 1945 andauerte.
Truppenstärke
Die 4. Ukrainische Front (mit dem 1. Tschechoslowakischen Korps) unter Iwan Petrow zusammen mit der 2. Ukrainischen Front (mit der 1. und 4. rumänischen Armee) unter Rodion Malinowski sollten die in den Westkarpaten versammelten deutschen Truppen zurückdrängen, die sich aus der 1. Panzerarmee, der 8. Armee, Teilen der 17. Armee und der ungarischen 1. Armee zusammensetzten. Die Tiefe der deutschen Verteidigung schloss neben dem gebirgigen Gelände auch mehrere Seen und Flussläufe ein.
Verlauf
Die Offensive begann zeitgleich mit der wesentlich grösseren Weichsel-Oder-Operation, während einen Tag später die Ostpreussische Operation (1945) eröffnet wurde.
Offensive der 4. Ukrainischen Front
Am 12. Januar um 8.15 Uhr griff die 38. Armee (Generaloberst Moskalenko) der 4. Ukrainischen Front nach starker Artillerievorbereitung mit zwei Schützenkorps (101. und 67.) – hinter der linken Flanke stand das 52. Schützenkorps als zweite Staffel zum Nachstossen bereit. Bis zum 15. Januar gelang der Durchbruch beim deutschen XI. SS-Armeekorps (General Kleinheisterkamp) und konnte in den nächsten Tagen bis zu 18 km vorgetragen werden. Am 16. Januar wurde Jaslo durch die 70. Garde- und 140. Schützen-Division des 101. Schützenkorps eingenommen.
Am 18. Januar eröffnete auch die südlicher anschliessende die 1. Gardearmee (General Gretschko) ihre Offensive gegen das deutsche XI. Armeekorps (General von Bünau) über den Ondava-Abschnitt. Bei der 4. Ukrainischen Front standen etwa 215 Panzer und Selbstfahrlafetten zum Einsatz, davon 134 Panzer bei der 38. Armee und wegen des gebirgigen Geländes nur 42. Panzer bei der 1. Garde-Armee. Die Front der im Raum 25 km südlich von Jasło zwischen Polany und südlich Stropkov eingesetzten 253. Infanterie-Division (Generalleutnant Becker) wurde vom sowjetischen 11. und 107. Schützen-Korps aufgerissen. Die deutschen Truppen wurde bis zu 22 km zurückgedrängt und am nächsten Tag wurde Prešov (Eperjes) von sowjetischen Truppen eingenommen. Südlich davon griff die sowjetische 18. Armee (Generalleutnant Gastilowitsch) die Stellungen des deutschen XXXXIX. Gebirgskorps (General de Le Suire) an, im Abschnitt des ungarischen V. Korps ging am 19. Januar Košice (ungarisch Kassa) verloren.
Offensive der 2. Ukrainischen Front
Der linke Flügel der 2. Ukrainische Front eröffnete parallel dazu ihre Offensive aus Nordungarn und drang in das Slowakische Erzgebirge ein. Die sowjetische 40. Armee (Generalleutnant Schmatschenko) drängte die ungarische 1. Armee durch den Rosenauer Kessel nach Rožňava zurück, überschritt den Fluss Slaná und nahm die Stadt Briesen (Brezno) ein. Links davon begleitete die sowjetische 27. Armee (Generaloberst Trofimenko) den Vorstoss auf Altsohl.
Schlussphase
Ende Januar erreichten die Truppen der 4. Ukrainischen Front die deutschen Verteidigungslinien am Fluss Sola östlich von Saybusch (Żywiec) – Jablonka – Neuhäusel in der Liptau (Liptovský Hrádok) – Sankt Nikolaus in der Liptau (Liptovský Mikuláš). Der Vormarsch der 4. Ukrainischen Front wurde westlich von Schwarzwasser an der Weichsel (Strumień), Saybusch (Żywiec) und Jablonka, östlich von Neuhäusel in der Liptau (Liptovský Hrádok) und Sankt Nikolaus in der Liptau (Liptovský Mikuláš) gestoppt. Die heftig verteidigte Stadt Bielitz (Bielsko-Biała) wurde von der 1. Gardearmee und der 38. Armee eingenommen. Die 2. Ukrainische Front setzte die Kämpfe noch bis Mitte März fort und erreichte den Fluss Gran.
Verluste und Folgen
Die Rote Armee zerschlug 17 Divisionen und 1 Brigade der Achsenmächte und machte dabei nach eigenen, objektiv nicht immer verifizierbaren Angaben 137.000 Gefangene. Daneben vernichtete bzw. erbeutete sie, ebenfalls nach eigenen Angaben, 2.300 Geschütze, 320 Panzer und 65 Flugzeuge. Grosse Teile der Slowakei und die südlichen Gebiete Polens wurden von den deutschen Besatzern befreit. Die Rote Armee beziffert ihre eigenen Verluste mit 78.988 Mann (davon 16.337 Tote und 62.651 Verwundete). Die rumänische 1. und 4. Armee verloren 12.000 Soldaten (2.500 Tote) und das 1. Tschechoslowakische Korps 970 Mann (260 Tote). Darüber hinaus sollen auf sowjetischer Seite 359 Panzer, 753 Geschütze und 94 Flugzeuge verloren gegangen sein. Das deutsche Reich verlor mit dem Slowakischen Erzgebirge ein wichtiges Industriegebiet.
Weichsel-Oder-Operation (12.01.1945 – 30.03.1945)
Die Weichsel-Oder-Operation (russisch Висло-Одерская операция, Wislo-Oderskaja operazija) ist die Bezeichnung einer Offensive an der deutsch-sowjetischen Ostfront des Zweiten Weltkrieges. Die Rote Armee begann am 12. Januar 1945 eine neue strategische Operation auf der 1.200 Kilometer breiten Front zwischen der Ostsee und den Karpaten. Sie endete am 3. Februar 1945. Im Laufe dieser Operation entwickelten sich zwei Hauptstossrichtungen: über Warschau und Posen nach Küstrin und aus dem Sandomierz-Brückenkopf nach Schlesien entlang der Oder.
Lage vor der Offensive aus deutscher Sicht
Der Jahresbeginn 1945 stand im Spannungsfeld dreier Kriegsschauplätze: Im Westen war die Ardennenoffensive im Ausklang, im Südosten war der Kampf um Budapest und das ungarische Öl noch nicht entschieden und an der Ostfront waren die Vorbereitungen der Sowjetarmee erkennbar abgeschlossen.
„Am 9. Januar – einen Tag nachdem Hitler den Oberbefehlshaber West v. Rundstedt ermächtigt hatte, die Westardennen zu räumen, traf Guderian nach einer Besichtigungsfahrt an die Ostfront in Hitlers Hauptquartier bei Frankfurt ein“. Guderian forderte Hitler auf, Italien, Norwegen, den Balkan und das Baltikum [Kurland] aufzugeben und „alle auftreibbaren Reserven zu versammeln, um die Russen aus Deutschland herauszuhalten“. Die Ostfront war seit dem Herbst 1944 kaum verstärkt worden.
An der Front zwischen Ostsee und Karpaten standen von den 287 deutschen Divisionen 75, „und zwar weit schwächere Divisionen als im Westen“. Nach Angaben Stalins in Jalta hatte er 180 Divisionen versammelt, „die an den Schwerpunkten den Deutschen an Männern und Panzern […] sechsfach überlegen waren“.
Nach einer weiteren Besprechung mit Guderian ordnete Hitler an, die 6. Panzer-Armee aus den Ardennen herauszuziehen, sie sollte jedoch zur Verfügung v. Rundstedts bleiben, „damit wir dort die Initiative behalten“. Die Ostfront werde nicht verstärkt und er werde auch keine Rückzüge zulassen.
Verlauf
Konews Grossoffensive über die Weichsel nach Schlesien
Am 12. Januar 1945 griff die 1. Ukrainische Front unter Marschall Konew im Süden aus den Weichsel-Brückenköpfen von Baranow und Sandomierz heraus gegen die Front der deutschen 4. Panzer-Armee unter General Gräser an. Der Abschnitt des XXXXVIII. Panzerkorps östlich von Pinschow wurde ebenso wie der Abschnitt des XXXXII. Armeekorps östlich von Kielce durchbrochen. Das zum Gegenstoss vorgezogene XXIV. Panzerkorps (16. und 17. Panzer-Division) wehrte sich standhaft, wurde aber selbst sofort von den durchgebrochenen Panzerkeilen der sowjetischen 3. Gardepanzer- und 4. Panzerarmee im Raum Kielce umschlossen. Truppen der sowjetischen 52. Armee besetzten am 17. Januar Tschenstochau, die 3. Gardepanzerarmee am 18. Januar Petrikau.
Bis zum 18. Januar waren die sowjetischen Truppen gegenüber der Heeresgruppe A auf 300 km Breite bis zu 150 km tief eingebrochen und hatten die Hauptkräfte der deutschen Verteidigung überrannt. Abgeschnittene deutsche Truppen versuchten nach Kämpfen mit sowjetischen Armeetruppen und polnischen Partisanen die Verbindung mit der inzwischen weit nach Westen abgedrängten deutschen Front wiederherzustellen. Das XXXXII. Armeekorps wurde dabei bis zum 23. Januar zum grössten Teil vernichtet, der Kommandierende General Recknagel wurde zwischen Petrikau und Tomaszów von Partisanen erschossen. In einem „wandernden Kessel“ zog sich die deutsche „Korpsgruppe Nehring“ (Gen. Kdo. XXIV. Panzerkorps) unter schweren Verlusten in mehrtägigen Kämpfen über die Warthe zur Oder im Raum Glogau zurück.
Am 19. Januar überquerten die ersten sowjetischen Truppen die Grenzen des Deutschen Reiches, danach begann der Kampf um das Schlesische Industriegebiet, das von der deutschen 17. Armee verteidigt wurde. Sowjetische Bomber griffen Breslau an. Krakau wurde am gleichen Tag von der sowjetischen 59. Armee freigekämpft. Am 27. Januar 1945 befreiten Einheiten der sowjetischen 60. Armee die Überlebenden der Konzentrationslager Auschwitz und Birkenau. Die 100. Schützen-Division setzte dabei von Norden her über die Weichsel und deckte die Flanke der von Süden anrückenden 107., 148. und 322. Schützen-Division.
Nebenoffensiven gegen Ostpreussen
Am 13. Januar traten an der nördlichen Ostfront auch die 3. Weissrussische Front unter General Tschernjachowski aus dem Raum Pilkallen gegen die Front der deutschen 3. Panzer-Armee an der östlichen Grenze von Ostpreussen mit dem Ziel an, nach Königsberg durchzubrechen. Am 14. Januar folgte die Offensive der 2. Weissrussische Front unter General Rokossowski aus den Brückenköpfen bei Serok und Rozan über den Narew mit dem Ziel die Provinz Ostpreussen auch von Süden her zu überrennen und bei Elbing zur Ostsee durchzubrechen. Die deutsche 3. Panzerarmee unter Generaloberst Raus wurde über die Memel bis auf den Pregel und die Angerapp zurückgedrängt. Die Front der deutschen 2. Armee unter General Weiss am Narew war ebenfalls durchbrochen und bis 21. Januar über die südliche Grenze Ostpreussens bis Osterode zurückgeworfen. Die noch intakte Front der deutschen 4. Armee unter General der Infanterie Hossbach zwischen Augustow und Lomscha am Bobr musste eiligst abgebaut werden, um nicht abgeschnitten zu werden. Die sowjetischen Truppen drängten von 19. und 24. Januar auf breiter Front zwischen Soldau – Neidenburg – Willenberg bis Goldap über die ostpreussische Grenze.
Schukows Hauptangriff über Lodz auf Posen
„Am 14. Januar [erfolgte] aus den Brückenköpfen von Magnuszew und Pulawy“, in der Frontmitte im Raum beiderseits und südlich von Warschau der Angriff der 1. Weissrussischen Front unter Marschall Schukow aus dem Brückenkopf von Warka gegen die deutsche 9. Armee (General von Lüttwitz). Zusammen mit den Truppen von Konews Front befanden sich jetzt aus den drei bereits im September 1944 eroberten Brückenköpfen von Baranow,
Pulawy und Magnuszew (Warka) insgesamt 163 Schützen-Divisionen und Panzerbrigaden mit 7042 Panzern und Sturmgeschützen in der Offensive. Die sowjetische 47. Armee und die polnische 1. Armee umfassten Warschau, das bis zum Abend des 17. Januar erobert werden konnte. Die 8. Gardearmee unter General Tschuikow welche zusammen mit der 5. Stossarmee aus dem Brückenkopf von Magnuszew antrat, durchbrach die Front des VIII. Armeekorps beiderseits der Pilica und stiess auf Tomaszow durch. Gegenstösse der deutschen 19. und 25. Panzer-Division gegen die durchgebrochenen sowjetischen Panzermassen blieben erfolglos. Der Angriff der sowjetischen 33. Armee aus dem Brückenkopf von Pulawy zielte auf die Stadt Radom, die bis 16. Januar zusammen mit der südlicher vorgehenden 69. Armee umschlossen und erobert wurde. Die 1. und 2. Garde-Panzer-Armee führten nach dem Einbruch an der Front des deutschen XXXXVI. Panzerkorps den operativen Durchbruch in Richtung auf Kutno und Lodz, in der zweiten Phase nördlich der Warthe über Posen bis zur Oder.
Die katastrophale Lage im Generalgouvernement zwang das Oberkommando der Wehrmacht zur Freigabe des in Ostpreussen dringend benötigten Panzerkorps „Grossdeutschland“, ab 15. Januar wurde dabei die Fallschirmdivision Hermann Göring und die Panzergrenadierdivision Brandenburg nach Kalisz verlegt.
Die Stadt Lodz wurde am 19. Januar im Zusammenwirken des 29. Garde-Schützenkorps der 8. Gardearmee mit dem von Süden herangekommenden 9. mechanischen Korps befreit. Ab 25. Januar 1945 wurden die rund 30.000 bis 63.000 Verteidiger der zur „Festung“ erklärten Stadt Posen eingeschlossen. Der nun folgende Kampf um Posen bis zur Kapitulation der letzten Verteidiger dauerte bis zum 23. Februar 1945.
Der sowjetische Vormarsch in Ostpreussen und westlich der Weichsel erfolgte in der Hälfte der vom sowjetischen Oberkommando veranschlagten Zeit.
Reaktion auf deutscher Seite
Erst mehr als eine Woche nach dem Beginn der Angriffsoperationen ist Hitler die Lage bewusst geworden: „Am 22. Januar endlich genehmigte Hitler, der nun verzweifelt Reserven aufzutreiben suchte, die Räumung Memels, doch weigerte er sich noch immer, Kurland aufzugeben“.
Die sofortige Überführung der 6. Panzerarmee vom Westen nach dem Osten wurde angeordnet. Aus der Pfalz und dem Elsass wurden die 21. Panzer- und die 25. Panzergrenadier-Division herausgelöst und an die bedrohte Oderfront verlegt. Hitler erkannte, dass er den Vorteil der inneren Linie verloren hatte:

„Es hat gar keinen Sinn, dass man sich in etwas hineinhypnotisiert und sagt: Ich brauche es hier, folglich muss es auch so kommen. Letzten Endes muss ich mit den Dingen rechnen, wie sie sind. Der Aufmarsch einer wirklich beachtlichen Kraft vom Westen ist einmal vor 6 bis 8 Wochen nicht denkbar“.
Schlussphase der Offensive
Ende Januar erreichte Rokossowskis 2. Weissrussische Front die Danziger Bucht und schnitt die 25 in Ostpreussen stehenden Divisionen ab. Konews 1. Ukrainische Front eroberte nach Krakau das oberschlesische Industriegebiet und kesselte Breslau ein. Schukows Panzer (1. Weissrussische Front) rollten durch Mittelpolen und überschritten die deutschen Grenzen in der Neumark. Die 4. Ukrainische Front unter Generaloberst Iwan Petrow eroberte Südpolen und die Nordtschechoslowakei (die heutige nördliche Slowakei).
Nach den von dem 26. bis dem 29. Januar tobenden Schneestürmen schoben sich General Tschuikows Einheiten bis zur Oder vor. Der vorentscheidende Erfolg der Offensive gelang im Zentrum der Operation beiderseits Küstrin. Am 1. Februar erreichten Vorausabteilungen der 8. Gardearmee den noch zugefrorenen Strom. Am 2. Februar bildete das 4. Garde-Schützenkorps (Generalmajor Glasunow) am westlichen Ufer bei Neu Manschnow einen kleinen Brückenkopf. Nordwestlich von Küstrin erreichte Bersarins 5. Stossarmee die Oder. Das 1. mechanische Korps unter Generalleutnant Kriwoschein errichtete einen weiteren kleinen Brückenkopf nahe Genschmar an der Kalenziger Bunst. Am gleichen Tag erreichte auch das 8. mechanische Gardekorps (Generalmajor Dremow) und das 11. Garde-Panzerkorps (Oberst Babadschanjan) die Oder. Die übergesetzten Einheiten bildeten südlich und nördlich von Küstrin bei Güstebiese und Kienitz erste starke Brückenköpfe. „Abgesehen davon, dass ein vereister Strom kein natürliches Hindernis bildete, schien er dort, wo er bei Frankfurt und Küstrin Berlin am nächsten ist, überhaupt nicht mehr verteidigt zu werden“. Der Höhenrand des Oderbruchs blieb aber im Wesentlichen unter deutscher Kontrolle.
Lage zum Abschluss der Offensive
Am 4. Februar 1945 waren die Kämpfe im nördlichen Bereich von Königsberg bis zu den Karpaten weitgehend zur Ruhe gekommen. Es bildeten sich neue Fronten: zwei Kessel in Ostpreussen an der Ostsee, der nördliche Teil Kurlands konnte sich halten, in Schlesien bis Küstrin verlief die Abwehrlinie um oder entlang der Oder, von Küstrin durch den Süden Pommerns bis Danzig. In Ungarn gingen die Kämpfe unvermindert weiter. Am 14. Februar 1945 fiel Budapest.
In der Lagebesprechung vom 27. Januar 1945 mit Göring und Jodl richtete sich Hitlers Hoffnung darauf, „dass mit jedem Schritt der Russen näher an Berlin heran die Westmächte einen Schritt näher zu einem Kompromiss gebracht würden“. Als Sofortmassnahme wurde der Berliner Volkssturm an die Ostfront verlegt und Heinrich Himmler zum Oberbefehlshaber einer Heeresgruppe Weichsel ernannt, um an der Oder die neue Front zu festigen. Von der Westfront wurden dazu mehr als die Hälfte der Panzerdivisionen abgezogen.
Nun gab Hitler der Ostfront auch in der Produktion den Vorrang: Im Februar 1945 gingen „1.675 neue oder reparierte Panzer und Sturmgeschütze nach dem Osten, an die Westfront hingegen in derselben Zeit nur 67. […] Durch diese drastische Neuverteilung hoffte Hitler, die Ostfront zu stabilisieren, ehe die britisch-amerikanischen Armeen ihre Offensive zum Rhein erneuern könnten“.
Im März 1945 versuchte die Wehrmacht im Kampf um Küstrin vergeblich, die Brückenköpfe, zwischen denen die Versorgungslinie zur Stadt verlief, zu beseitigen. Am 22. März gelang den sowjetischen Truppen die Vereinigung der beiden Brückenköpfe. Die 1. Weissrussische Front konsolidierte schliesslich bis Anfang April den Oder-Brückenkopf auf 44 km Breite und 7–10 km Tiefe, der sich von Lebus im Süden bis nördlich Kienitz erstreckte.
Auswirkungen
Die sowjetischen Truppen waren nach der Offensive erschöpft und nahmen auch keine Gelegenheit wahr, weiter auf Berlin vorzustossen. Sie konnten „solange nicht zum Durchbruch [auf Berlin] antreten […], wie sie den Nachschubverkehr durch das verwüstete Polen nicht organisiert hatten“. In den nächsten Wochen bereinigten die sowjetischen Fronten ihren Rückraum: In der Schlacht um Ostpommern (10. Februar bis 4. April 1945) drangen sie an die Ostsee, die Ostpreussische Operation (1945) wurde am 9. April 1945 mit der Eroberung von Königsberg weitgehend abgeschlossen, Danzig wurde Ende März 1945 besetzt und in der Niederschlesischen Operation und der Westkarpatischen Operation wurden die deutschen Truppen auf die Tschechoslowakei zurückgedrängt. Trotz des militärischen Erfolgs der Sowjetfronten kehrte sich die Gesamtlage jedoch gleichsam um: Vorläufig hatten die deutschen Armeen an Oder und Neisse eine neue Abwehrlinie errichten können, während nun – ab Anfang Februar 1945 – die westalliierten Heere nach Deutschland einbrachen.
Die Sowjetarmee trat am 16. April 1945 zum Angriff auf Berlin an.
Die Kämpfe waren für beide Kriegsparteien sehr verlustreich. Die Rote Armee verlor nach eigenen Angaben 193.125 Soldaten (davon 43.251 Tote und Vermisste sowie 149.874 Verwundete), 1.267 Panzer, 374 Geschütze und 343 Flugzeuge.
Eroberung Tilsits 1945 (13.01.1945 – 20.01.1945)
Die Eroberung von Tilsit gelang der Roten Armee am 20. Januar 1945. Seitdem ist das 600 Jahre alte Tilsit eine russische Stadt in der Oblast Kaliningrad.
Lage
Die sowjetische 43. Armee unter General Beloborodow stand mit acht Schützendivisionen zwischen Russ und Schmalleningken am nördlichen Ufer der Memel. Seit dem 20. Dezember 1944 zugefroren, war der Fluss kein Hindernis. Zudem war im Abschnitt Schmalleningken–Schillfelde noch die 39. Armee unter Generalleutnant Iwan I. Ljudnikow mit sechs Schützendivisionen aufmarschiert. Den Sowjets gegenüber stand das IX. Armeekorps der am Memel-Abschnitt führenden deutschen 3. Panzerarmee. Drei neuaufgestellte Volksgrenadier-Divisionen (551, 548, 561) sowie die 56. und 69. Infanterie-Division waren unter der Führung des Kommandierenden General Wuthmann in Stellung gegangen. Die Führung der übergeordneten 3. Panzerarmee hielt Tilsit für ausreichend geschützt; auch Armeegeneral Iwan Danilowitsch Tschernjachowski, der Oberbefehlshaber der 3. Belorussischen Front wies der Stadt nur eine Nebenrolle zu. Seine Absicht bestand darin, die deutsche Abwehrstellung weiter südlich zwischen Schlossberg und Ebenrode massiert zu durchbrechen und über Gumbinnen und Insterburg in Richtung Wehlau vorzustossen.
13. bis 16. Januar
Tschernjachowskis Offensive begann am nebligen Wintermorgen des 13. Januar, sein Hauptstoss war gegen die Stellungen des deutschen XXVI. Armeekorps unter General der Infanterie Matzky gerichtet. Stundenlang nahm die russische Artillerie im Raum Schlossberg die Stellungen der 1. Infanterie-Division und der 349. Infanterie-Division unter Feuer. Trotz massiver Panzerunterstützung stiessen die sowjetischen Truppen auf hartnäckige und zunächst erfolgreiche Abwehr. Als die 5. Panzer-Division den deutschen Grenadieren zu Hilfe kam, wurde Kattenau zum Zentrum einer erbitterten Schlacht. In vier Tagen wechselte es mehrfach den Besitzer. Erst am Abend des 16. Januar konnten die Rotarmisten die tief gestaffelte Verteidigungsstellung durchbrechen und bis auf die Linie Kussen-Radschen-Mallwen vordringen. Auch Schlossberg musste aufgegeben werden. Die nördlich von Schlossberg stehende 69. Infanterie-Division geriet dadurch in eine bedrohliche Lage; denn sie befand sich nun in einem weit überhängenden Vorsprung der Kriegsfront. Um nicht abgeschnitten zu werden, erwirkte sie in der Nacht zum 17. Januar den Befehl zum Rückzug in Richtung Tilsit. Diese Absetzbewegung blieb nicht unbemerkt. Die 39. Armee stiess unverzüglich über die Scheschuppe nach, besetzte Haselberg und nahm die Verfolgung der 69. Infanterie-Division auf. Der nördliche Flügel der Front geriet ins Wanken. Tschernjachowski erkannte seine Chance. Unverzüglich beorderte er das bei Eydtkau in Reserve liegende 1. Panzerkorps unter Generalleutnant Butkow an die nördliche Flanke, um überraschend in die deutsche Absetzbewegung hineinzustossen und eine Lücke südöstlich von Tilsit aufzureissen.
17. und 18. Januar
Butkow trat im Morgengrauen des 17. Januar an. Seine drei Panzerbrigaden rollten in zügigem Tempo auf der Strasse Schlossberg–Spullen–Rautenberg vor. Während die 69. ID noch dabei war, die vorbereitete Inster-Stellung zu beziehen und zur Verteidigung einzurichten, gelang es dem russischen Panzerkorps hinter Gerslinden eine Lücke zu finden, die Inster aus der Bewegung heraus zu überwinden und bei Nesten einen Brückenkopf zu bilden. Das konnten auch die Reste der 56. ID nicht verhindern. Sie hatten sich ebenfalls auf die Inster-Stellung zurückgekämpft und waren noch dabei, einen stabilen Abwehrriegel aufzubauen, um eine Bedrohung Tilsits von Süden her zu verhindern.
Die russischen Anstrengungen galten dem raschen Ausbau des Brückenkopfs Nesten (heute im Bezirk Klaipėda). Verbände der 39. Armee schlossen nach einem Gewaltmarsch von Haselberg auf das Panzerkorps auf und bezogen am späten Abend des 17. Januar im Brückenkopf Stellung. Am nächsten Morgen, einem Freitag, entbrannten um Nesten erbitterte Kämpfe. Mit aller Kraft wurde noch einmal versucht, einen weiteren Vormarsch der Sowjets zum Stehen zu bringen. Generalleutnant Rein, der Kommandeur der 69. Infanterie-Division, fiel in den verlustreichen Kämpfen bei Hohensalzburg. Trotz heftiger Gegenwehr konnte gegen Mittag an der rechten Flanke die 89. Panzerbrigade die Abwehrfront nach Norden durchbrechen und auf der Strasse nach Tussainen vordringen. Hier stiess sie nicht nur in die Flanke der zurückgehenden 561. Volksgrenadier-Division, sondern auch in den Rücken der bei Ragnit stehenden 548. Volksgrenadier-Division unter Generalmajor Sudau. Sie war seit den frühen Morgenstunden in heftige Kämpfe verwickelt; denn das am nördlichen Memelufer liegende 54. sowjetische Schützenkorps war wenige Stunden zuvor zum Angriff angetreten und hatte nach einem mächtigen Feuerschlag die vereiste Memel überwunden. Von zwei Seiten bedrängt, war Ragnit nicht mehr zu halten.
19. Januar
Damit trat der Kampf um Tilsit in die entscheidende Phase. Am Freitag, dem 19. Januar 1945, bauten die zurückgehenden Einheiten der 69. ID, der 561. und 548. VGD in gebotener Eile in Tilsit-Preussen (Tilsits östlichem Stadtteil) einen neuen Sperr-Riegel auf. Die nachstossende 126. Schützendivision prallte aus der Bewegung auf die gerade bezogene Abwehrstellung vom Grenadier-Regiment 36 der 69. Infanterie-Division. Zusammengefasstes Feuer aller Waffen stoppte ihr weiteres Vordringen. Die durch den Memel-Übergang bei Ragnit ohnehin stark geschwächten russischen Regimenter 366, 690 und 550 erlitten schwere Verluste und stellten den Angriff ein. Der frisch nach Ragnit herangeführten 263. Schützendivision wurde befohlen, unverzüglich nach Tilsit weiterzumarschieren und nachts in die Stadt einzudringen. Ohne Ruhepause bewegte sich das Schützenregiment 997 im Eilmarsch entlang der Reichsstrasse 132. Ihm folgte das Schützenregiment 995, das über Schalau-Girschunen abbog, um Tilsit von Südosten anzugreifen. Hier sollte ein Angriff am wenigsten erwartet werden, weil seit dem Vortag der Schwerpunkt des russischen Angriffs am Memelufer lag. Tatsächlich erwartete die deutsche Verteidigung den Hauptschlag von Norden, zumal seit 21.00 Uhr heftiger Artilleriebeschuss vom rechten Memelufer einsetzte. Alle Reserven wurden mit Front zum Memelufer in Alarmbereitschaft versetzt.
Inzwischen hatte das Schützenregiment 995 Birgen (Birjohlen) erreicht. Den Vorstoss entlang der Bahnlinie zur Tilse vereitelten grossflächige Draht- und Minensperren; dem 2. und 3. Bataillon gelang es jedoch, über die Moritzhöher Strasse bis an die Pfennigbrücke heranzukommen. Die deutsche Brückenwache sprengte sie um 22 Uhr, im letzten Augenblick. Aus der Neustädtischen Schule wurden die russischen Soldaten heftig beschossen. Mehrere Sturmangriffe über die vereiste Tilse wurden abgeschlagen. Als herangeführte schwere Waffen kurz vor Mitternacht den Übergang erzwangen, konnten die russischen Truppen in Richtung Karlsberg vordringen. Das Schützenregiment 997 nahm den Fletcherplatz und ging entlang der Deutschen Strasse in Richtung Zellstofffabrik vor. Von der anderen (rechten) Memelseite beschoss russische Artillerie die deutschen Verteidigungsstellungen. Der neue Angriffsbefehl für die am nördlichen Memelufer liegenden Regimenter der 115. Schützendivision wurde für 23 Uhr ausgegeben. In mehreren Wellen rannten die Rotarmisten über den breiten Strom gegen die mit Minensperren, Drahthindernissen und Maschinengewehr-Bunkern ausgebaute Verteidigungslinie an. Wieder erlitt die 115. Schützendivision schwere Verluste mit 600 Toten. Kurz vor 24 Uhr brach das 292. Schützenregiment bei Teichort im Nahkampf in die deutschen Stellungen ein. Trotz heftiger Gegenwehr konnte das Grenadier-Regiment 1114 der 551. Volksgrenadier-Division die Bildung eines kleinen Brückenkopfes nicht verhindern.
20. Januar
Unter Dauerfeuer drang das Schützenregiment 995 in der ersten Stunde des Sonnabends bis zum Anfang der Grünwalder Strasse vor. Von dort stürmte das 2. Bataillon den Karlsberg mit der Strassengabelung Königsberger/Kallkapper Strasse. Das 1. Bataillon kämpfte sich durch enge Strassen und dunkle Höfe zwischen Clausius- und Kleffel-Strasse zum Bahnhof vor und meldete 2 Uhr nachts die befohlene Einnahme. In dieser kritischen Lage wollte die deutsche Armeeführung die Stadt entlasten. Sie setzte mehrere Panzer der 5. Panzerdivision aus Kreuzingen in Marsch. Auf der Königsberger Strasse zügig vorangekommen, liefen sie um 2.30 Uhr auf die Sperre am Karlsberg auf. Eine geballte Ladung setzte den vordersten Panzer ausser Gefecht. Irritiert durch den nächtlichen Feuerzauber in der Stadt, drehten die deutschen Panzer wieder ab, um entlang der Reichsstrasse 138 die nördliche Flanke der ostpreussischen Verteidigung zu stabilisieren. Tilsit war sich selbst überlassen. Die deutschen Einheiten erwehrten sich des Gegners nach allen Seiten. Auch aus dem Memel-Brückenkopf heraus ging der Kampf ohne Pause und mit unverminderter Heftigkeit weiter. Um 2.20 Uhr meldete das Schützenregiment 292 die Einnahme des südlichen Memelufers mit Preussenhof und Weinoten (Landkreis Elchniederung). Von hier aus kämpften sich die Russen der Stolbecker Strasse entlang, wo sie gegen 0.07 Uhr früh auf dem Gelände der Zellstoffwerke mit den ihnen aus Osten entgegenkommenden Kameraden des Schützenregiments 997 aufeinandertrafen. Zwei Angriffskeile hatten sich vereinigt.
Ein weiteres Regiment der 115. Schützendivision, das Regiment 638, hatte in den frühen Morgenstunden am Engelsberg die Memel überschritten und begann mit der Säuberung des Stadtzentrums. Das Regiment 801 der 235. Schützendivision übernahm die Sicherung des südlichen Stadtrands und des Bahnhofs Pamletten. Der Kampf war vorbei. Nach einem Dokument des Zentralarchivs vom Ministerrat der UdSSR galt Tilsit ab dem 20. Januar 1945, 5.10 Uhr als erobert.

„Zwischen Insterburg und Tilsit wechselten starke feindliche Angriffe mit unseren Gegenangriffen. Nach erbitterten Kämpfen konnte der Feind in Tilsit eindringen“.
Deutsche Rückzugsgefechte
Nach mehrstündiger Ruhe am südwestlichen Ortsausgang setzten die russischen Schützenregimenter 292 und 638 den Marsch in Richtung Heinrichswalde fort. Auch für die Regimenter der 263. Schützendivision wurde 16 Uhr der Abmarschbefehl gegeben. Zurück blieb eine menschenleere Stadt. Südlich von Tilsit tobte noch den ganzen Sonnabend der Kampf. Mit Panzerunterstützung der 5. Panzerdivision wurde die Reichsstrasse 138 nach Taplacken offengehalten. Das galt besonders für die Kreuzung Sandfelde, wo die Strassen aus Heinrichswalde und Schillen zusammentrafen und gegen die die Rotarmisten des Schützenregiments 801 den ganzen Nachmittag vergeblich anrannten. Das galt auch für die Kreuzinger Strassenkreuzung, wo die Chaussee von Neukirch/Gr. Friedrichsdorf (Landkreis Elchniederung) einmündete. Ein Artillerie-Regiment der 548. Volksgrenadier-Division feuerte hier bis zur letzten Granate. Erst nachdem die letzten Einheiten aus Tilsit durchgezogen waren, wurde Kreuzingen gegen 22 Uhr aufgegeben. Die 69. Infanterie-Division (Oberst Grimme) musste sich kämpfend über Tapiau zurückziehen und traf am 27. Januar in Königsberg ein. Hierhin gelangten auch die Reste der 56. Infanterie-Division unter Generalmajor Blaurock. In ununterbrochenen Rückzugsgefechten gelang es den drei Volksgrenadier-Divisionen, die Deime zu erreichen und im Samland einen neuen Abwehrriegel zu errichten.
Ostpreussische Operation (13.01.1945 – 20.01.1945)
Die Schlacht um Ostpreussen fand vom 13. Januar bis zum 25. April 1945 statt und war die blutigste und längste Schlacht des Jahres. Im Laufe der Ostpreussischen Operation (russisch Восточно-Прусская операция) führte die Rote Armee sechs Unteroperationen durch: die Insterburg–Königsberger, Mlawa–Elbinger, Heilsberger, Braunsberger, Samlander und die Königsberger Operation.
Vorgeschichte
Im Sommer 1944 war den sowjetischen Truppen die Zerschlagung der Heeresgruppe Mitte gelungen, fast unaufhaltsam rückte die Rote Armee bis an die östliche Grenze des Deutschen Reiches heran. Die weit nach Osten vorgelagerte Provinz Ostpreussen spürte zuerst die Schrecken des Krieges. Der erste Grossangriff durch die sowjetische 11. Gardearmee (General Galitzki) brach am 16. Oktober 1944 während der Gumbinnen-Goldaper Operation los und konnte im Raum südlich Gumbinnen bis zur Angerapp durchstossen. Die Einbrüche an der Front des XXVI. und XXVII. Armeekorps konnten durch Gegenstösse des XXXIX. Panzerkorps bis Ende Oktober abgeriegelt werden. Trotzdem hatten die Sowjets die Grenze Ostpreussens zwischen Memel und der Rominter Heide auf etwa 130 Kilometer Breite umfasst und deutschen Boden im Raum Schirwindt-Eydtkau-Trakehnen-Rominten bis 40 Kilometer Tiefe in ihre Hände gebracht. Die Front stabilisierte sich Ende Oktober notdürftig an der Linie Augustow-Goldap-Grosswaltersdorf-Grünweiden-Schlossberg, entlang der Memel über Tilsit zum Kurischen Haff. Das durch sowjetische Truppen angerichtete Massaker von Nemmersdorf diente der NS-Propaganda dazu, die verängstigte Bevölkerung zum Durchhalten zu animieren.
Am 12. Januar 1945 begann mit der Weichsel-Oder-Operation die sowjetische Grossoffensive gegen die zwischen Warschau und Sandomierz an der Weichsel-Linie haltende Heeresgruppe A. Nach der richtigen Einschätzung der Stawka war die deutsche Ostfront wegen der Ardennenoffensive an der Westfront von fast allen Reserven entblösst. Noch vor Erreichung des operativen Durchbruches im südlichen Polen, wurde der gleichzeitige Angriff der nördlichen Frontarmeen in Ostpreussen beschlossen, der um einen Tag später erfolgen sollte. So stand die Ostfront zwischen der Ostsee und den Karpaten im Angriff. Der nun auf die Hälfte der Ostfront ausgedehnte Grosskampf überstieg die militärischen Ressourcen der Wehrmacht völlig. Die seit dem Winter 1944 neu aufgestellten Volksgrenadier-Divisionen waren kein Ersatz für die im Vorjahr durch die Rote Armee zerschlagenen Divisionen.
Truppenstärke
Ostpreussen und Teile Nordpolens wurden von der 3. Panzerarmee unter Erhard Raus und der 4. Armee unter Friedrich Hossbach (ab 30. Januar unter Friedrich-Wilhelm Müller) im nördlichen Frontabschnitt der deutschen Heeresgruppe Mitte unter Georg-Hans Reinhardt verteidigt. Sie hatten 580.000 Soldaten und 200.000 Angehörige des Volkssturms, 8.200 Geschütze, 700 Panzer und 700 Flugzeuge (41 Divisionen und 6 Brigaden). Ihnen gegenüber standen die 2. Weissrussische Front unter Konstantin Rokossowski, die 3. Weissrussische Front unter Iwan Tschernjachowski (ab 20. Februar unter Alexander Wassilewski) und die 43. Armee der 1. Baltischen Front unter Hovhannes Baghramjan mit einer Gesamtstärke von 1,67 Mio. Soldaten, 25.000 Geschützen, 3.000 Panzern und 3.000 Flugzeugen.
Verlauf
Tilsit-Insterburger Operation
Am 13. Januar begann der durch starkes Artilleriefeuer eingeleitete Angriff der 3. Weissrussischen-Front, der nördlich der Memel durch den südlichen Flügel der 1. Baltischen-Front erweitert wurde. Tschernjachowskis Absicht bestand zunächst darin, die deutsche Abwehrstellung südlich zwischen Schlossberg und Ebenrode zu durchbrechen und über Insterburg auf Königsberg vorzustossen. Die zwischen Russ und Schmalleningken stehende sowjetische 43. Armee unter General Beloborodow griff auf breiter Front vom nördlichen Ufer der zugefrorenen Memel nach Süden an.
Gegenüber verteidigte auf deutscher Seite das IX. Armeekorps unter General Wuthmann mit einer am Haff eingesetzten Sicherungsdivision und drei neuaufgestellten Volksgrenadier-Divisionen. Die sowjetische 39. Armee unter Generalleutnant Ljudnikow war links von der 43. Armee zwischen Schillfelde und Trappen aufmarschiert und setzte ihren Angriff auf Haselberg in Richtung zur Inster an. Der Hauptstoss war gegen die Stellungen des deutschen XXVI. Armeekorps unter General der Infanterie Matzky gerichtet. Trotz starker Panzerunterstützung stiess die sowjetische 28. Armee (General A. A. Lutschinski) im Angriff auf Gumbinnen zunächst auf erfolgreiche Abwehr. Erst am Abend des 16. Januar konnten die Rotarmisten das tief gestaffelte Verteidigungssystem durchbrechen. Schlossberg wurde von der sowjetischen 5. Armee (General N. I. Krylow) umfasst und musste von der ostpreussischen 1. Infanterie-Division aufgegeben werden. Um nicht abgeschnitten zu werden musste das XXVI. Armeekorps in der Nacht zum 17. Januar den Rückzug in Richtung Tilsit antreten. Diese Absetzbewegung ermöglichte der sowjetischen 39. Armee über die Scheschuppe nachzusetzen und Haselberg einzunehmen. Zudem wurde das bei Eydtkau in Reserve liegende 1. Panzerkorps unter General Butkow in die Frontlücke eingeführt und konnte die Inster am 17. Januar überwinden, um einen Brückenkopf zu bilden. Durch die 5. Panzerdivision wurde die Reichsstrasse nach Taplacken offengehalten. Die 69. Infanterie-Division musste sich kämpfend über Tapiau zurückziehen und traf am 27. Januar in Königsberg ein. Der Divisionskommandeur Generalleutnant Rein fiel bei den Rückzugskämpfen um Hohensalzburg.
Der sowjetischen 11. Gardearmee gelang erst am 18. Januar im Raum südlich von Gumbinnen der operative Durchbruch. Die deutsche 4. Armee sah sich am linken Flügel (XXVI. Armeekorps) an der Inster bereits durch die 39. Armee überflügelt. General Hossbach musste die noch intakte Front (VI. A.K. und XXXXI. Pz.K.) zwischen Goldap und den Narew schnellstens aufgeben, nachdem auch die anfangs von der 2. Armee gehaltene Front eingestürzt war. Am 20. Januar konnte die sowjetische 43. Armee in Tilsit eindringen. Am gleichen Tag brachen Panzer der 11. Gardearmee zwischen Kreuzingen und Aulenbach durch, die Sowjets waren vor Norkitten und vor Taplacken in die deutschen Linie eingebrochen. Der deutsche Rückzug aus der Nordenbug-Pentlack-Stellung wurde notwendig. Am 21. Januar fiel Insterburg in die Hände des 36. Garde-Schützenkorps unter Generalmajor Koschewoi. Dazwischen versuchten sich die abgekämpften Reste der geschlagenen deutschen 3. Panzerarmee hinter Pregel und Deine abzusetzen und sich nach Königsberg zu retten. Das freigewordene Armeeoberkommando wurde über See herausgezogen und übernahm später die Befehlsführung an der nördlichen Oderfront.
Zur gleichen Zeit konnte Baghramjans 1. Baltische Front im westlichen Kurland die Belagerung der Hafenstadt Memel beenden. Das noch gegenüber der sowjetischen 51. Armee im Brückenkopf Memel haltende XXVIII. Armeekorps (58. und 95. Infanteriedivision) unter General Gollnick wurde ab 22. Januar über die Frische Nehrung nach Samland abgesetzt
Mlawa–Elbinger Operation
Das deutsche XXVII. Armeekorps hielt gegenüber dem Serok-Brückenkopf der sowjetischen 65. Armee die Verbindung zum linken Flügel der 9. Armee. Zwischen Narew und Weichsel deckte dabei die 542. Volksgrenadier-Division gegenüber der sowjetischen 47. Armee im Raum Modlin, während nördlich davon die 252. und 35. Infanterie-Division eingesetzt waren. Wegen der schlechten Wetterlage musste der südlichere Angriff durch die 2. Weissrussische Front aus den Narew-Brückenköpfen von Serok (65. und 70. Armee) und Różan (48. Armee) zweimal verschoben werden und konnte erst am 14. Januar beginnen. Die von den Truppen Rokossowskis geführte Mlawa-Elbinger Operation blieb anfangs weit unter den Erwartungen. Der Widerstand der deutschen 2. Armee war zu Beginn stärker als erwartet und erlaubte den Sowjets am ersten Angriffstag nur ein Vorgehen von 7-8 Kilometer Tiefe. Erst als sich Rokossowski entschloss, auch die 2. Stossarmee unter General Fedjuninski in die Schlacht einzuführen, gelang der Durchbruch in nordwestliche Richtung auf Neidenburg. Am 17. und 18. Januar fielen Modlin, Płońsk und Płock in sowjetische Hände. Das XX. und XXIII. Armeekorps der 2. Armee räumte am 17. Januar Ciechanow und Przasnysz und gab am 18. Januar auch Mława und das Armee-Hauptquartier in Proskowo auf. Dadurch wurde im Norden der sich im Raum nördlich Lomscha und der Bober noch haltende rechte Flügel (LV. Armeekorps) der 4. Armee unhaltbar. Die Masse der 2. Armee (XXIII. und XXVII. A.K.) konnte sich der drohenden Umfassung im Raum Pultusk entziehen, indem sie das von der Heeresgruppe aus der Reserve zugeführte Generalkommando VII. Panzerkorps an sich zog und sich nördlich der Weichsel in Richtung auf Graudenz zurückzog, um später die Verteidigung in Westpreussen zu übernehmen. Rokossowskis Front führte am 20. Januar die geplante Schwenkung nach Norden aus und stiess über Allenstein bis zum Frischen Haff vor. Am 21. Januar fielen Osterode und Hohenstein in die Hände der Sowjets. Das Tannenberg-Denkmal wurde durch Pioniere der 299. Infanteriedivision gesprengt und die sterblichen Überreste Hindenburgs und seiner Gattin wurden über See nach Westen überführt. Am Abend des 23. Januar brach die Vorhut der 5. Gardepanzerarmee in die Stadt Elbing ein, ab 26. Januar war die Ostsee erreicht und der Rückzug der 4. Armee nach Westen abgeschnitten. Von den grösseren Städten Ost- und Westpreussens waren Ende Januar nur noch Königsberg, Elbing, Marienburg, Graudenz und Thorn in deutscher Hand. Die dünne Front der 2. Armee verstärkten die aus dem Kurlandkessel herangeführte 31. Volksgrenadier-, 32. und die 227. Infanteriedivision. Die 4. Panzerdivision unter General Betzel wurde zur Hauptstütze der Abwehrkämpfe an der bedrohten Südfront der 2. Armee. Nach dem Verlust der Landverbindung nach Stettin standen dieser Gruppierung zur Versorgung nur noch die Häfen von Danzig und Gotenhafen zur Verfügung, wo das VII. Panzerkorps unter General von Kessel die Führung übernahm. Am 31. Januar begann die von sowjetischen Truppen abgeschnittene Thorn-Gruppe (31. und 73. Infanterie-Division) mit dem Ausbruch in der Richtung auf Schwetz um sich wieder mit der Masse der 2. Armee an der Weichsel zu vereinigen. Thorn fiel am 1. Februar in sowjetische Hand, am 3. Februar gelang es den Resten des XXVII. Armeekorps die Weichsel zu erreichen.
Bis zum 8. Februar hatte die 2. Weissrussische Front die Masse ihrer Armeen zur Eroberung von Ostpommern umgegliedert und wurde nach Anlaufen der Ostpommern-Operation zusätzlich durch die 19. Armee verstärkt. Zwischen der Weichsel, Stolp und Preussisch Friedland versuchte die deutsche 2. Armee (XXIII. und XXVII. AK.) eine neue Front aufzubauen.
Folgen für die Zivilbevölkerung
Die Folgen des sowjetischen Durchbruches wurde für die Bewohner Ostpreussens zur Katastrophe. Durch den Vorstoss der Roten Armee aus dem Raum nördlich von Warschau nach Elbing und zur Ostsee wurde Ostpreussen Ende Januar 1945 vom Deutschen Reich abgeschnitten. Die Menschen versuchten sich in Trecks nach Westen durchzuschlagen oder die Ostseehäfen zu erreichen, um von dort auf Schiffen der Kriegsmarine nach Westen zu gelangen. Für diejenigen, die von der Roten Armee eingeholt oder überrollt wurden, bedeutete dies in den meisten Fällen Verschleppung, Vergewaltigung oder Tod. Es wird geschätzt, dass von den bei Kriegsende etwa 2,4 Millionen Bewohnern Ostpreussens ungefähr 300.000 unter elenden Bedingungen auf der Flucht ums Leben gekommen sind. Unter den Menschen, die bei den Versenkungen der Wilhelm Gustloff (30. Januar), der General von Steuben (10. Februar) und der Goya (16. April) starben, befanden sich viele Flüchtlinge aus Ostpreussen, mehrere Tausend pro Schiff. Anfang April befanden sich noch etwa 400.000 Zivilisten in den letzten von der Wehrmacht gehaltenen Regionen, davon die meisten in Pillau. Nach der Kapitulation Königsbergs am 9. April handelte es sich bei den Transporten im Wesentlichen lediglich um einen Pendelverkehr nach Hela, nicht in den sicheren Westen. Mit der Eroberung von Samland durch die Rote Armee am 25. April fanden die Transporte aus Pillau ein Ende.
Allgemeiner Rückzug auf Königsberg
Am 25. Januar wurde gegen den ausdrücklichen Befehl Hitlers Lötzen und die masurische Seenstellung aufgegeben, die nördlich anschliessende Angerapp-Linie war bereits unhaltbar. Am gleichen Tag ging im Bereich der 2. Fallschirm-Panzer-Division „Hermann Göring“ Zinten verloren. Der gegen den Führerbefehl befohlene Rückzug der 4. Armee, kostete Generaloberst Reinhardt und General Hossbach das Kommando. Zum neuen Oberbefehlshaber der Heeresgruppe hatte Hitler Generaloberst Rendulic bestellt. Am 26. Januar drangen sowjetische Truppen südlich von Tolkemit zur Ostsee durch, damit begann eine regellose Flucht der Bevölkerung aus dem Raum Königsberg. Bis zum 29. Januar erreichten die Truppen der 3. Weissrussischen Front bei Gross Heydekrug das Frische Haff westlich von Königsberg. Somit entstanden zunächst drei Kessel, mit bis zu 30 Divisionen: bei Heiligenbeil (4. Armee) sowie um Königsberg und im Samland (Korps Gollnick). Die letzten beiden konnten sich am 19. Februar wiedervereinigen und so die Versorgung aus bzw. Evakuierung von Königsberg nach Pillau ermöglichen. Im zurückeroberten Gebiet wurde dabei das Massaker von Metgethen aufgedeckt.
Am 25. Januar ordnete Hitler die Umgruppierung der nun voneinander isolierten deutschen Truppen im Nordbereich der Ostfront an: die Reste der Heeresgruppe Mitte in Ostpreussen wurden in Heeresgruppe Nord umbenannt, die im Kurlandkessel eingeschlossene bisherige Heeresgruppe Nord wurde zur Heeresgruppe Kurland und in Ostpommern wurde die Heeresgruppe Weichsel gebildet. Gleichzeitig wurden mehrere Befehlshaber ausgetauscht und Königsberg zur Festung erklärt.
Bei einem Angriff auf den Kessel von Heiligenbeil wurde Tschernjachowski am 18. Februar bei Mehlsack tödlich verwundet, seine Nachfolge als Befehlshaber der 3. Weissrussischen Front trat der zuvor im Generalstab tätige Alexander Wassilewski an, dem auch die in „Samlandgruppe“ umbenannte 1. Baltische Front unterstellt wurde. Wassilewski setzte die Offensive nicht unmittelbar fort, sondern erwartete Verstärkungen, während Rokossowskis 2. Weissrussische Front die Schlacht um Ostpommern schlug.
Das Ende im Heiligenbeiler Kessel und in Samland
Die endgültige Zerschlagung der in Ostpreussen eingekesselten Truppen begann am 13. März 1945 mit dem Angriff der 3. Weissrussischen Front auf den Heiligenbeiler Kessel (Braunsberger Angriffsoperation, 13. März bis 25. April). Für die Zerschlagung von etwa 16 eingeschlossenen deutschen Divisionen setzten die Sowjets ganze 7 Armeen ein: Links gegen Braunsberg griff die 48. Armee gegen das VI. Armeekorps an, zwischen Breitlinde und Zinten wurde die 3., 50. und 31. Armee gegenüber dem XX. Armeekorps konzentriert. Rechts folgend, dem XXXXI. Panzerkorps gegenüber, verlängerte die 28. Armee die Kesselfront bis auf die Höhe von Kreuzburg. Nordwärts anschliessend, versuchte die 5. Armee unter General Krylow zwischen Kobbelbude und Altenberg antretend, die Landverbindung nach Königsberg abzuschneiden. Die Truppen der 48. Armee konnten am 20. März Braunsberg erobern, der Kessel wurde weiter verengt, die noch durch die Panzer-Grenadier-Division Grossdeutschland aufrechterhaltene Verbindung mit Königsberg war aber bereits durch die sowjetische 5. Armee bei Heide-Maulen unterbunden.
Ende März waren die Reste der 4. Armee und viele Flüchtlinge am schmalen Küstenvorsprung zwischen Balga und Kahlholz zusammengedrängt und im direkten Feuerbereich sowjetischer Geschütze. General Müller hatte sich bereits nach Pillau übersetzen lassen, verlangte aber das weitere Ausharren der Restbesatzung, um so viel Flüchtlinge wie möglich über See evakuieren zu können. Um die gleiche Zeit gingen in Westpreussen im Bereich der 2. Armee Gotenhafen und Danzig an die 2. Weissrussische Front verloren.
Am 6. April begann die Schlacht um Königsberg, der sowjetischen 39. Armee gelang es zum wiederholten Male die Eisenbahnlinie Königsberg-Pillau zu unterbrechen. Die 39. Armee drang dabei in die zur Festung erklärte Stadt ein, wo der sich rechtzeitig abgesetzte Gauleiter Erich Koch zum fanatischen Widerstand aufgerufen hatte. Nach zwei Tagen schwerer Kämpfe wurde die Garnison der Stadt von der nördlicher stehenden und durch die sowjetische 43. Armee abgedrängte Armeeabteilung Samland (General Gollnick) abgeschnitten. Der Stadtkommandant General Lasch beantragte beim AOK 4, die 5. Panzer-Division von Westen her zum Entsatz einzusetzen. General Friedrich-Wilhelm Müller, der Oberbefehlshaber der 4. Armee untersagte den Ausbruch der Besatzung nach Westen, wobei die Zivilbevölkerung mitgenommen werden sollte. Die eingeschlossene Besatzung lehnte am 8. April die von der Sowjetunion angebotene Kapitulation der Stadt ab. Nach schwerem Beschuss griff die sowjetische 11. Garde-, die 39. und 48. Armee, unterstützt von 1.500 Flugzeugen, das Stadtzentrum am 9. April an und zwang die Garnison zur Kapitulation. 42.000 deutsche Soldaten waren gefallen und weitere 92.000 gingen in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Die freigewordenen Kräfte der 2. Weissrussischen Front wurden für die Berliner Operation nach Westen an die nördliche Oderfront verlegt.
Die deutsche 2. Armee unter ihrem neuen Oberbefehlshaber General von Saucken war bereits am 7. April in Armee Ostpreussen umbenannt worden und war nach der Vernichtung der 4. Armee bis zum Kriegsende für die Verteidigung der restlichen Küstenstreifen in West- und Ostpreussen zuständig. Die verbleibenden sowjetischen Kräfte konnte bis zum 25. April auch die Reste der Armeeabteilung Samland (Reste IX. und XXVI. A.K.) aufreiben. Pillau fiel ebenfalls am 25. April in sowjetische Hände, der Kampf um die Frische Nehrung dauerte noch bis zum Kriegsende an.
Verluste und Folgen
Die Rote Armee eroberte Ostpreussen, vernichtete nach eigenen Angaben 25 deutsche Divisionen vollständig (weitere 12 verloren 50 bis 70 Prozent ihrer Stärke) und nahm 220.000 deutsche Soldaten gefangen. Grosse Mengen an Kriegsgerät etwa 5.000 Geschütze, 400 Panzer und 300 Flugzeuge wurden erbeutet oder zerstört. Nach sowjetischen Angaben verlor die Rote Armee 584.774 Soldaten (davon 126.464 Gefallene), 3.525 Panzer und Selbstfahrlafetten und 1.450 Flugzeuge.
Operation Blackcock (14.01.1945 – 26.01.1945)
Operation Blackcock war der Codename für die Eroberung des Rur-Dreiecks (‚Roer Triangle‘) etwa zwischen den Städten Roermond, Sittard und Heinsberg vom 14. bis 26. Januar 1945.
Ziel der britischen 2. Armee war es, die deutsche 15. Armee hinter die Rur und ihren Nebenfluss Wurm zurückzuschlagen und die Front weiter in Richtung Rhein voranzutreiben. Die Operation wurde von drei Divisionen ausgeführt, die unter dem Kommando des britischen XII. Korps standen:
- 7th Armoured Division (bekannter als „Desert Rats“),
- 52nd (Lowland) Infantry Division und
- 43rd (Wessex) Infantry Division („Wessex Wyverns“).
Die Operation Blackcock – benannt nach dem männlichen schottischen Moorhuhn – ist relativ unbekannt, obwohl es viele Tote auf beiden Seiten gab: Um viele Dörfer und Weiler im Rur-Dreieck wurde erbittert gekämpft, und dies in einem besonders harten Winter.
Ausgangslage
Gegen Ende 1944 hatte sich die Frontlinie in der niederländischen Provinz Limburg entlang einiger natürlicher Barrieren stabilisiert. Die bei weitem am schwierigsten zu überwindende Barriere war die Maas. Nach deren Überwindung kam als nächstes Hindernis die Wurm, ein von Süden (bei Aachen) nach Norden fliessender Nebenfluss der Rur, der nördlich von Heinsberg in die Rur mündet. Die Rur ist ein Nebenfluss rechts der Maas, entspringt in der Eifel und fliesst durch Heinsberg Richtung Roermond, wo sie in die Maas mündet.
Heinsberg war der nördlichste Punkt des von der NS-Propaganda oft beschworenen Westwalls (bei den Alliierten auch unter dem Namen ‚Siegfried-Linie‘ bekannt und nicht mit der Siegfriedstellung am Ende des Ersten Weltkrieges zu verwechseln), der dort am Ufer der Rur verlief. Süd-Limburg war von den Alliierten schon im September 1944 befreit worden; das Gelände entlang der Linie Sittard-Geilenkirchen war noch in deutscher Hand. Die Deutschen hatten ab Herbst 1944 die Maas-Rur-Stellung gebaut; diese verlief zwischen Heinsberg im Süden und Venlo im Norden.
Aus alliierter Sicht gab es ein dreieckiges Gebiet, das in die Front hineinragte (Geilenkirchen salient). Im Rahmen der am 10. November 1944 begonnenen Operation Clipper eroberten britische Truppen am 19. November Geilenkirchen. Dann kam die Offensive zum Stehen; das schon am 16. November 1944 mit 2.223 Bomben (Gesamtgewicht 1.019 Tonnen) weitgehend zerstörte Heinsberg wurde erst am 24. Januar 1945 erobert.
Hier verlief die Front am Saeffeler Bach, einem kleinen Flüsschen, der sich als erhebliches Hindernis erwies.
Wegen der Mitte Dezember 1944 von der Wehrmacht im Frontbereich der 1. US-Armee begonnenen Ardennenoffensive – und dem am 31. Dezember 1944 begonnenen Unternehmen Nordwind – mussten die Alliierten an anderen Stellen Ressourcen abziehen, um diese zu stoppen. Deshalb hatte das XII. Korps der britischen 2. Armee von der U.S. Army die Aufgabe übernommen, die Frontlinie nördlich von Sittard zu bewachen. Die Front an der Maas wurde vom britischen VIII Corps gebildet.
Dem britischen XII. Korps gegenüber stand das deutsche XII. SS-Armeekorps unter Günther Blumentritt, der zwischen Geilenkirchen und Roermond zwei Infanterie-Divisionen (176. Infanterie-Division und 183. Volksgrenadier-Division) hatte. In der Gegend von Roermond wurden diese Divisionen vom Fallschirmjäger-Regiment Hübner verstärkt.
Schlachtplan
Die Grobplanung zur Eroberung des Rur-Dreiecks orientierte sich entlang drei Achsen:
- Die linke Achse, gebildet von der 7. Panzerdivision (7th Armoured Division), zielte darauf, die Brücke über die Rur in Sint Odiliënberg zu erobern. Für die 7. Panzerdivision begann die Operation Blackcock damit, dass sie einige Flüsschen südlich von Susteren überbrückte.
- Die mittlere Achse – 52. Lowland Division – zielte darauf, Heinsberg einzunehmen. Zu diesem Zweck schlug man eine Bresche in die deutschen Verteidigungslinien bei Höngen, um die Strasse von Sittard nach Heinsberg für den Vormarsch nutzen zu können.
- Die rechte Achse – 43. Division (Wessex) – zielte darauf, die Gegend südöstlich von Dremmen zu erobern. Sie sollte die Bresche nutzen, die die Lowland Division schlagen sollte.
Hübners Verteidigung von Sint Joost
Die Schlacht um das niederländische Dorf Sint Joost war ein Wendepunkt der Operation. Nach vier Gefechtstagen war den Deutschen sehr wohl bewusst, dass sich der Vormarschplan der Panzerdivision sehr auf die Benutzung von Strassen stützte, vor allem wegen der widrigen winterlichen Bedingungen.
Sint Joost lag an der Vormarschroute der 7. Panzerdivision auf ihrem Weg Richtung Montfort. Am 20. Januar begannen bei kaltem und nebligem Wetter Infanterie- und Kavallerie-Einheiten der ‚Desert Rats‘ einen ersten Angriff auf die vermuteten zwei deutschen Kompanien des 2. Bataillons des Fallschirmjäger-Regiments Hübner in Sint Joost. Letztlich brauchten sie vier Angriffswellen, um das Dorf zu erobern; die letzte fand am 21. Januar (einem Sonntag) statt.
Insgesamt wurden 60 Fallschirmjäger gefangen genommen. Die 9th Durham Light Infantry hatte in Sint Joost 33 Ausfälle zu verzeichnen, wovon acht Mann gefallen waren; die 1st Rifle Brigade 34 (drei Gefallene). Über 100 deutsche Soldaten starben, die meisten von ihnen beim Häuserkampf. Die überlebenden deutschen Soldaten wagten sich nur im Schutz von Zivilisten aus den Kellern, weil sie fürchteten, von den Siegern erschossen zu werden. Hübner hatte durch Tod oder Gefangennahme fast zwei Kompanien verloren.
Montfort
Zwischen dem Abend des 19. Januar und dem 23. Januar wurde das niederländische Dorf Montfort sieben Mal beschossen oder bombardiert und dabei von über 100 Bomben getroffen. Die meisten dieser Geschosse fielen ins Zentrum. Fast alle der 250 Häuser wurden beschädigt. In einigen völlig zerstörten Häusern kamen ganze Familien um. Während dieser ‚bombing raids‘ gingen die Deutschen zusammen mit den Zivilisten in Kellern in Deckung oder suchten Schutz in bewaldetem Gelände.
Das 143rd Wing der Royal Canadian Air Force verlor während der Operation Blackcock sechs Flugzeuge; zwei davon stürzten in Montfort ab. Als Montfort schliesslich am 24. Januar befreit wurde, standen die überlebenden Einwohner unter schwerem Schock. 186 von ihnen starben bei dem Angriff, die meisten von ihnen durch den Einsturz der Bauten, in denen sie sich aufhielten.
Verluste
Die Alliierten erreichten in der Operation Blackcock alle ihre Ziele. Die deutschen Divisionen wurden zurückgetrieben – mit Ausnahme eines Gebietes direkt südlich von Roermond, wo noch deutsche Fallschirmjäger kämpften.
Die 52. Lowland Division hatte die härtesten Kämpfe: ihre Ausfälle betrugen 752 Soldaten, davon waren 101 „killed in action“ (Gefallene). Zudem erkrankten 258 von ihnen an der Front; die meisten von ihnen an Krankheiten, die die extreme Kälte und die widrigen Wetterbedingungen verursacht hatten. Die 7. Panzerdivision hatte über 400 Ausfälle.
Die ‚Desert Rats‘ verloren nur 20 Panzer durch Abschuss. Weitere 23 Panzer blieben wegen technischer Probleme liegen. Zehn der abgeschossenen waren Totalschäden; die übrigen Panzer konnten repariert werden.
Die deutschen Verluste sind nicht genau bekannt; die Zahl der Gefangenen überstieg 2000 Mann. Während Operation Blackcock nahmen die Desert Rats 490 Gefangene, darunter sechs Offiziere. Die Lowland Division nahm über 1200 Gefangene, die Wessex Division etwa 400.
Nachfolgende Aktionen
Nach dem Abschluss der Operation konnten die Alliierten beginnen, die Besetzung des Rheinlandes zu planen.
Die 1. Kanadische Armee begann Operation Veritable am 8. Februar 1945; diese zielte darauf, die deutschen Verteidigungslinien im Reichswald bei Kleve (etwa 60 km nördlich des Rur-Dreiecks) zu durchbrechen. Dies erwies sich als schwieriger als gedacht; die Schlacht im Reichswald dauerte über zwei Wochen. Auch die Operation Blockbuster um Uedem forderte viele Verletzte und Tote.
Die Operation Grenade der 9. US-Armee startete am 23. Februar 1945: General William Hood Simpsons Armee überquerte die Rur am frühen Morgen. Zwölf Stunden später hatte Simpson 16 Bataillone auf dem Ostufer, zudem sieben schwere Brücken und einige leichte Angriffsbrücken. Seine Armee hatte nur leichte Verluste und nahm an diesem Tag 700 Gefangene.
Das XVI. US-Korps bildete eine Task Force, die nach Norden Richtung Venlo zog, um sich mit den britischen Truppen dort zu vereinigen.
Am 1. März wurde Roermond von der Recce Troop (Aufklärungseinheit) der amerikanischen 35th Infantry Division („Santa Fe Division“) ohne einen einzigen Schuss besetzt.
Die Deutschen befürchteten seit dem Geländeverlust durch die Operation Blackcock, dass ihr Frontabschnitt zwischen Heinsberg und Venlo, die seit Herbst 1944 provisorisch befestigte Maas-Rur-Stellung, beidseitig umfasst werden würde. Militärs konnten Hitler erst in den letzten Tagen des Februar davon überzeugen (bzw. dessen Genehmigung dazu erwirken), den Frontvorsprung kampflos zu räumen.
Schlacht um Breslau (23.01.1945 – 06.05.1945)
Die Schlacht um Breslau bezeichnet den Versuch der deutschen Wehrmacht, eine Verteidigungslinie an der Oder aufzubauen, die Einschliessung des wichtigen Verkehrsknotenpunktes Breslau zu verhindern und die „Festung Breslau“ zu verteidigen. Diese Aktivitäten begannen am 23. Januar 1945, als die Rote Armee Brückenköpfe bei Oppeln und bei Ohlau jeweils südöstlich von Breslau an der Oder schuf. Die eigentliche Schlacht um die Stadt begann am 15. Februar mit der Einschliessung.
Im Zuge der Niederschlesischen Operation und endete am 6. Mai mit der Kapitulation gegenüber der sowjetischen 6. Armee.
Die Gegner
Die Schlacht um Breslau wurde zwischen der deutschen Heeresgruppe Mitte unter Ferdinand Schörner und der 1. Ukrainischen Front von Iwan S. Konew ausgetragen. Dabei standen sich die deutsche 17. Armee (unter der Führung von Friedrich Schulz und später Wilhelm Hasse) und die sowjetische 3. Gardepanzerarmee (Pawel S. Rybalko) sowie die sowjetische 6. Armee (Wladimir A. Glusdowski) gegenüber. In der Stadt Breslau wurde nur ein Teil der 269. Infanterie-Division eingeschlossen, die nicht mehr Divisions-, sondern nur noch Kampfgruppenstärke hatte.
Die zur Festung erklärte Stadt hatte eine kampfstarke Verteidigung von mindestens 24.000 Mann. Diese unterteilten sich in die weniger kampfstarken Soldaten des Volkssturms, in Spezialisten der Rüstungsbetriebe und andere Wehrfähige der nationalsozialistischen Staatsorganisationen. Zu den kampfstärkeren Einheiten zählten die der Wehrmacht (zu grossen Teilen Fronturlauber und Soldaten der Ersatzkompanien) und die der Waffen-SS. Befehlsgewalt in der sog. Festung Breslau hatte bis zum 7. März 1945 Generalmajor Hans von Ahlfen und danach bis zur Kapitulation am 6. Mai der General der Infanterie Hermann Niehoff. Der politische Verantwortliche der Festung war Gauleiter Karl Hanke, der einen hohen Machtstatus hatte und Befehlshaber über die in Breslau stationierten Truppen des Volkssturms war.
Die Festungsstadt
Führungsanspruch der NSDAP
Auf Anordnung des Reichsverteidigungskommissars und Propagandaministers Joseph Goebbels hatte Hanke in allen Wehrmachteinheiten die nationalsozialistische Führungstätigkeit als politisches Organ aktiviert. Für das Festungskommando zeichnete der NS-Führungsoffizier (NSFO) van Bürck mit besonderen Vollmachten verantwortlich. Hauptaufgabe dieser Politabteilung war es vor allem, den Nachrichtendienst für die Wehrmacht zu kontrollieren, die Kampfmoral durch propagandistische Agitation zu heben, sowie die politische Gesinnung der Soldaten zu überprüfen.
Evakuierung
Am 20. Januar rief Gauleiter Hanke die nicht wehrtaugliche Bevölkerung auf, die zur Festung erklärte Stadt sofort zu verlassen. Es war kalter, strenger Winter, und Breslau war voller Menschen, viele waren während der letzten Wochen aus den Dörfern und Städten rechts des Odertieflandes in Trecks hierher gekommen. Viele aus dem übrigen westlichen Reichsgebiet wohnten seit den letzten Kriegsjahren hier und waren von den Bombenangriffen feindlicher Flugzeuge bisher verschont geblieben. Allesamt mussten sie die Festungsstadt kurzfristig räumen. Allerdings war eine Evakuierung der Stadt überhaupt nicht vorbereitet. Schon am ersten Tag herrschte auf den Bahnhöfen Panik. Die Züge konnten die Massen nicht aufnehmen. Gauleiter Hanke ordnete daher den Fussmarsch von Frauen und Kindern nach dem südwestlich gelegenen Umland bei Kostenblut (Kostomloty) und Kanth an. Während der panischen Flucht bei Frost und Schnee kamen Tausende von Kindern und alten Leuten um. Aufgrund dieser Ereignisse weigerten sich nun viele Breslauer, die Stadt zu verlassen. Etwa 200.000 nicht kampftaugliche Männer und Frauen sowie junge Mädchen und Pimpfe der Hitler-Jugend blieben in der Stadt.
Die nördlichen und östlichen Vororte von Breslau wurden zwangsweise geräumt, weil man hier den ersten Ansturm der Sowjets erwartete. In den verlassenen Häusern quartierten sich schon in den nächsten Tagen Wehrmacht und Volkssturm ein. Die politische Gewalt oblag den Parteiorganen und ihrem Befehlshaber, dem Gauleiter. Mit dem Evakuierungsbefehl der Zivilbevölkerung liess Gauleiter Hanke auch alle Ämter und Institutionen, die für die Festungsverteidigung nicht unbedingt erforderlich waren, in andere Reichsgebiete verlegen. Es verliessen auch viele Schüler mit ihren Lehrern die Stadt: die Universität, die Universitätskliniken, das Technikum, das Botanische Institut und die Museumseinrichtungen wurden verlegt. Auch die Geistlichen wurden aufgefordert, die Stadt zu verlassen.
Repressalien
Männer, die Waffen handhaben konnten, mussten bleiben. Fünfzehnjährige Hitlerjungen und sechzigjährige Männer wurden zum letzten Volkssturmaufgebot mobilisiert. Die Befehlshaber drohten mit strengen Massnahmen allen, die sich nicht fügen wollten, mit Arrest und sonstigen Strafen, bei Feigheit vor dem Feind mit dem Tode. Der Festungskommandant war in der Lage, Standgerichte einzuberufen, um vermeintliche Deserteure, sog. Wehrkraftzersetzer, Saboteure oder Spione hinrichten zu lassen. Ebenso konnte der Gauleiter als politisches Organ sich auf das Standrecht berufen und Erschiessungen durchführen lassen.
Als prominentestes Opfer dieser Repressalien seitens des nationalsozialistischen Staates gilt der stellvertretende Oberbürgermeister Wolfgang Spielhagen. Spielhagen hatte zur Kapitulation geraten, um noch mehr zivile Opfer zu verhindern. Er wurde am 28. Januar auf dem Breslauer Ring, nahe dem Rathaus, von Angehörigen des Volkssturms standrechtlich erschossen. Den Befehl zur Liquidierung gab der Gauleiter selbst. Anschliessend wurde der Leichnam des Opfers zur Oder gebracht und dort hineingeworfen. Gauleiter Hanke liess öffentlich bekanntmachen: „Wer den Tod in Ehren fürchtet, stirbt ihn in Schande“.
Kriegspropaganda
Festungskommandant von Ahlfen erliess zur Disziplinierung der Truppen an seine Offiziere am 8. Februar folgenden Tagesbefehl:

„Ich mache es allen Führern zur Pflicht, die ihnen anvertraute Stellung zu halten. Wer eine Stellung eigenmächtig aufgibt und zurückgeht, wird wegen Feigheit vom Standgericht zum Tode verurteilt. Jeder Führer, gleich welcher Einheit, hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, sich Drückebergern gegenüber, die ihre Stellung verlassen, mit allen Mitteln, gegebenenfalls unter Anwendung der Waffe, durchzusetzen“. In einem bekannt gegebenen Gerichtsurteil vom Februar heisst es: „Zwei Soldaten einer im Festungsbereich eingesetzten Einheit waren in das nächste der Stellung gelegene Dorf zurückgeschickt worden, um dort Decken zu holen. Stattdessen zogen sie in diesem Dorf ihre Uniform aus, legten Zivilkleidung an und machten sich zu Fuss auf den Weg, um in ihre Heimat zu gelangen. Am 5. Februar wurden sie von einer Streife der Wehrmacht ergriffen und am gleichen Tage durch ein Standgericht zum Tode verurteilt und erschossen“.
Verteidigung
Am 10. Februar wurde eine innerstädtische Evakuierung durchgeführt. Die Einwohner der östlichen Stadtteile zwischen den Oderläufen sowie der Stadtgebiete im Westen mussten ihre Wohnungen räumen und ihre voll gepackten Koffer zurücklassen.
Breslau war militärisch kaum befestigt. Am 15. Februar belagerten sowjetische Truppen vom Süden und vom Westen her die Vororte Breslaus. Mit Flammenwerfern und Panzerfäusten kämpfte man beinahe um jedes Haus, und es gab kaum ein Haus, das nicht schwer zerstört worden war. Eine Moskauer Zeitung berichtete von den Häuserkämpfen in Breslau: „Gekämpft wurde nicht nur in jedem Haus, Stockwerk oder Zimmer, sondern um jedes Fenster, wo die Deutschen Maschinengewehre und andere automatische Waffen installiert haben“.
Die sowjetischen Stosstrupps zerstörten bei ihren Strassenangriffen zuerst die Eckgebäude der Häuserreihen mit Granatwerfer- oder Panzerbeschuss. Die Flammen vertrieben dann die Verteidiger aus den ersten Häusern, dann folgten die Flammenwerfertrupps und steckten ein Gebäude nach dem anderen in Brand. Als Vorbeugung gegen das Ausbrennen der Strassen räumten Trupps der Wehrmacht mit Hilfe von Zivilisten das Mobiliar, sämtliche brennbaren Gegenstände aus den Wohnungen, Büroräumen und Geschäften auf die Strasse und verbrannten alles, was man auf die Strasse gebracht hatte.
In der Stadt wurden Gebäude abgerissen, um Material für Verteidigungsanlagen zu gewinnen und dem angreifenden Gegner im Häuserkampf die Deckung zu nehmen. In den Parks und Promenaden gingen Geschütze in Stellung. An Strassenkreuzungen sprengte die Wehrmacht ganze Häuser. An jeder Strassenecke, an jeder Litfasssäule riefen Plakate zur Mithilfe und zum Kampf auf. Alte Männer, die nicht mehr kräftig genug waren, die Stadt zu verlassen, mussten das Strassenpflaster aufreissen und Steinbarrikaden errichten. Aus den Trümmern errichtete man Barrikaden. Strassenbahnen fuhren herbei, um Strassen zu verbarrikadieren. Mit Pferden wurden Möbelwagen herbeigebracht, ausgebrannte Panzer wurden herbeigeschleppt. Parterres und Keller verwandelten sich in Schiessstände.
Erfolgreich wurde ein Panzerzug bei der Verteidigung von Breslau eingesetzt. Die Bewaffnung dieses Zuges bestand aus vier Wannen für schwere Panzer, welche mit vier 8,8-cm-Flak-, einem 3,7-Flak- und vier 2-cm-Flak-Geschützen sowie zwei MG 42 bestückt waren. Ausserdem besass der Zug eine Funkstelle.
Versorgung
Die bald dringlich werdende Munitionsversorgung erfolgte auf dem Luftweg von Dresden aus. Die Kämpfe der letzten Wochen hatten die Munitions- und Betriebsstoffvorräte knapp werden lassen, so dass ohne dauernden Nachschub auf dem Luftweg die künftige Verteidigung gefährdet war. Sämtliche verfügbaren dreimotorigen Transportflugzeuge (Ju 52) waren im ständigen Einsatz. Die Maschinen landeten auf dem Flugplatz Gandau im Westen der Stadt. Die Belagerer kontrollierten bald die Luftversorgung, so dass wegen Flak- und Jagdfliegerbeschuss nur nachts Anflüge mit Transportflugzeugen erfolgen konnten. Mit Lebensmitteln und sonstigen Vorräten war die Stadt hingegen reichlich versorgt. In den Kühlhäusern hatte man das Fleisch von etwa 16.000 Schweinen eingelagert. Aus der Umgebung hatte man ausserdem vor der Belagerung herdenweise Rinder in die Stadt getrieben, denen in der Festung freilich die Futtermittel fehlten.
Nach der Eroberung des Flugplatzes durch die sowjetischen Truppen befahl General Niehoff, eine zweite Landebahn hinter der Kaiserbrücke anzulegen. Er liess entlang der Kaiserstrasse von Sprengkommandos eine Schneise von 300 m Breite und einem Kilometer Länge schlagen, für die auch die Lutherkirche gesprengt wurde. Zwangsarbeiter und Zivilisten mussten im ständigen Feuer der Belagerer tags und nachts arbeiten. Eine militärische Bedeutung erlangte die provisorische Startbahn nicht. Es wird berichtet, dass nur ein einziges Flugzeug darauf abhob: dasjenige des Gauleiters Hanke, der sich unmittelbar vor dem Fall der Stadt absetzte.
Schicksal der Stadt
Während der Osterfeiertage 1945, am 1. und 2. April, warfen hunderte Flugzeuge mehrere tausend Bomben auf das Stadtgebiet von Breslau ab. Die massivste Bombardierung vollzog sich am Ostermontag. Durch die abgeworfenen Phosphorbomben kam es zu schwerwiegenden Bränden in der ganzen Stadt.
Von 30.000 Gebäuden lagen am Ende der Kampfhandlungen 21.600 in Trümmern. Viele Industriebetriebe und wertvolle Kulturdenkmäler waren völlig zerstört.
Kapitulation
Breslau kapitulierte am 6. Mai 1945, vier Tage nachdem die letzten Verteidiger Berlins die Waffen niedergelegt hatten. Für die verbliebene Bevölkerung, die wochenlang unter Zwangsarbeit, Belagerung, Kämpfen und Zerstörungen gelitten hatte, kam mit der Kapitulation keine Erleichterung. Krankenhäuser und Kanalisation waren zerstört, Epidemien verbreiteten sich angesichts der katastrophalen Verhältnisse Hinzu kamen Plünderungen, Übergriffe und Vergewaltigungen durch Rotarmisten.
Nach Schätzungen des britischen Historikers Norman Davies kamen im Kampf um Breslau insgesamt 170.000 Zivilisten, 6.200 deutsche und 13.000 sowjetische Soldaten ums Leben. Es wurden 12.000 deutsche und 33.000 sowjetische Soldaten verwundet. Andere Schätzungen belaufen sich auf 20.000 getötete Zivilisten.
General Niehoff kapitulierte und verbrachte zehn Jahre in sowjetischer Gefangenschaft.
Schlacht um Posen (25.01.1945 – 23.02.1945)
Die Schlacht um Posen wurde während des Zweiten Weltkrieges im Rahmen der Weichsel-Oder-Operation der Roten Armee geschlagen. Sie begann am 25. Januar 1945 nach der vollständigen Einschliessung der von den deutschen Streitkräften zur Festung erklärten Stadt und endete nach schweren Kämpfen am 23. Februar 1945 mit der Kapitulation ihrer letzten Verteidiger. Den Kampfhandlungen waren schätzungsweise über 12.000 Menschen und ein beträchtlicher Teil der Bausubstanz Posens zum Opfer gefallen.
Ausgangslage
Zwischen 12. und 15. Januar 1945 begann die Rote Armee mit ihrer Grossoffensive von der Ostsee bis zu den Karpaten den „Endkampf“ an der Ostfront. Die weit überlegenen sowjetischen Verbände stürmten aus ihren Brückenköpfen an Weichsel und Narew und erzwangen binnen weniger Tage weiträumige operative Durchbrüche. Diese lösten nicht nur eine lawinenartig anschwellende Fluchtbewegung der volksdeutschen Bevölkerung dieser Gebiete aus, sondern führten auch zur Zerschlagung der deutschen Heeresgruppe A, die im Vorfeld des Warthegaues stand. Anschliessend wurde das Gebiet des Gaues binnen zwei Wochen von den Truppen der von Georgi Schukow (1896–1974) kommandierten 1. Weissrussischen Front überrannt. Bereits Ende Januar standen die ersten sowjetischen Verbände bei Küstrin an der Oder und waren damit nur noch 60 km von der Reichshauptstadt Berlin entfernt.
Arthur Greiser (1897–1946), der Gauleiter des Warthegaues, der noch zu Beginn der sowjetischen Grossoffensive verkündet hatte, dass in seinem Gau „kein Meter Boden freigegeben“ werde, gab am 18. Januar 1945 angesichts der sich dramatisch verschlechternden Frontlage doch noch die Erlaubnis zur Räumung der östlichen Kreise des Gaues und zum Abtransport von Frauen und Kindern aus der Gauhauptstadt Posen. Die Volksdeutschen der von Greiser zur Räumung freigegebenen Gebiete befanden sich zu diesem Zeitpunkt aber ohnehin bereits auf heilloser Flucht nach Westen und die Evakuierung der Zivilisten aus der Gauhauptstadt, für die Greiser nicht mehr als einen Tag veranschlagt hatte, lief angesichts der militärischen Lage und der fehlenden Transportkapazitäten völlig chaotisch ab. Bis 23. Januar hatten die rund 70.000 (volks-)deutschen Bewohner die Stadt dennoch nahezu vollständig verlassen, wobei sie auf ihrem Weg nach Westen meist völlig auf sich allein gestellt blieben und viele von ihnen umkamen. Der Grossteil der polnischen Stadtbevölkerung – Schätzungen zufolge bis zu 150.000 der insgesamt rund 200.000 Menschen – war jedoch geblieben und konnte kaum mehr tun, als die kommenden Ereignisse abzuwarten.
Greiser selbst hatte Posen mit den Angehörigen seines Stabes bereits am Abend des 20. Januar 1945 fluchtartig verlassen. Zuvor war noch um 5:25 Uhr die Alarmierung der Verteidiger der zur Festung erklärten Stadt erfolgt und diesen eingeschärft worden, dass Posen „unbedingt gehalten“ werden müsse. Zum Festungskommandanten war Generalmajor Ernst Mattern, der Kommandant der Garnison Posen, ernannt worden.
Verteidiger und Angreifer der Festung Posen
Genaue Anzahl und Zusammensetzung der um Posen kämpfenden Truppen sind seit langem Gegenstand verschiedenster Darstellungen. Auf der Seite der Verteidiger ergibt sich dabei vor allem das Problem, dass zwar einigermassen bekannt ist, welche militärischen und sonstigen Einheiten kurz vor dem Beginn der Kampfhandlungen in und um Posen stationiert waren, nicht aber, wie viele von ihnen tatsächlich in die Verteidigung der Stadt einbezogen wurden und wie viele noch vorher abgezogen wurden bzw. sich absetzen konnten. Zudem war die Stadt im Januar 1945 auch Anlaufpunkt zurückflutender Truppenteile der Wehrmacht und Waffen-SS, deren Angehörige dann zum Teil ebenfalls dem Festungskommando unterstellt wurden. Mit ziemlicher Sicherheit entspricht daher weder die von Generalmajor Mattern angegebene Zahl von 12.000 deutschen Verteidigern noch die Zahlen, die nach dem Krieg von diversen Teilnehmern der Schlacht um Posen sowie den Verfassern diverser Studien dazu genannt wurden, der Realität zu Beginn der Schlacht. Beispielsweise bezifferte Stanisław Okęcki in seiner 1975 erschienenen Studie zur Schlacht um Posen die deutschen Verteidiger mit 32.500, wohingegen Zbigniew Szumowski in seinen 1971 und 1980 erschienenen Werken von 61.000 sprach.
Im bislang letzten Werk zum Thema wird von einer Garnisonsstärke von 15.000 bis 20.000 Mann ausgegangen. Ihr Kern waren rund 1.500 Angehörige der Schule V für Fahnenjunker der Infanterie Posen, die angesichts der bevorstehenden Ereignisse per Sonderbefehl automatisch zu Leutnants befördert wurden. Während der Schlacht fungierten sie teils als Kompanie-, Zug- und Truppführer, teils als taktische „Berater“ und stellten somit eine willkommene Ergänzung der Riege der militärischen Führungskräfte dar. Aufgrund ihrer Kampfkraft erwies sich auch die nach ihrem Kommandeur, dem SS-Obersturmbannführer Wilhelm Lenzer, benannte Kampfgruppe Lenzer als besonders wertvoll für die Stadtverteidigung. Sie bestand aus diversen SS-Einheiten, die sich in der Stadt befunden hatten, als diese zur Festung erklärt worden war. Ferner wurden dem Festungskommando zumindest auch ein paar der insgesamt acht vor Kampfbeginn im Stadtgebiet stationierten Flakbatterien unterstellt. Den Rest der Stadtverteidiger schliesslich bildeten jene Einheiten, die aus versprengten Angehörigen anderer regulärer Kampfverbände, Polizisten, Landesschützen (insgesamt fünf Bataillone), Volkssturmmännern (ein Bataillon), Eisenbahnern, Feuerwehrleuten und anderen „Kämpfern“ zusammengestellt worden waren.
Dieser bunt gemischten deutschen Streitkraft standen zur Verteidigung auch – die Angaben differieren hier stark – bis zu 30 Sturmgeschütze III und IV der Sturmgeschütz-Ersatz- und Ausbildungs-Abteilung 500, die im Zuge ihres Bahntransports auf dem Posener Bahnhof „einkassiert“ worden waren, sowie zwei Panzer IV und je ein Panther- und Tiger-Panzer zur Verfügung. Ein wesentliches Element der Stadtverteidigung bildeten ferner die Anlagen der Festung Posen, die allerdings aus dem 19. Jahrhundert stammten und nur mehr zum Teil den Anforderungen der Zeit entsprachen. Sie bestanden aus 18 ringförmig um die Stadt liegenden Aussenforts und Zwischenwerken, vier Innenforts und dem so genannten „Kernwerk“, der auf einer die Stadt beherrschenden Anhöhe gelegenen Zitadelle. Die Festung Posen verfügte über insgesamt sechs Batterien Festungsartillerie.
Im Gegensatz zu den deutschen Verteidigern, die, abgesehen von der eher sporadisch erfolgten Luftunterstützung und -versorgung faktisch völlig auf sich allein gestellt waren, konnten die sowjetischen Angreifer, deren Anzahl mit bis zu 100.000 angegeben wird, sich nicht nur auf die Unterstützung ihrer Luftwaffe verlassen, welche im Kampfgebiet die nahezu unumschränkte Luftherrschaft ausübte, sondern erhielten auch genügend Nachschub an Kampfmitteln. Die sowjetischen Truppen bestanden aus verschiedenen Einheiten der 1. Gardepanzerarmee und der 69. Armee, vor allem aber jenen der 8. Garde-Armee, welche die Hauptlast der Kämpfe trugen. Unterstützt wurden sie von rund 5.000 polnischen Soldaten sowie etwa 2.000 Stadtbewohnern, die sich auf vielfältige Weise vor allem am Kampf um die Posener Zitadelle in der Endphase der Schlacht beteiligten.
Verlauf der Schlacht um Posen
Posen war ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt und lag an der sowjetischen Hauptstossrichtung über Warschau nach Berlin. Da die Stadt, solange sie in deutschen Händen war, zudem eine permanente Bedrohung für den Nachschub der nach Berlin vorstürmenden sowjetischen Truppen darstellte, waren diese schon deshalb daran interessiert, sie den Deutschen zu entreissen.
Nachdem am 21. und 24. Januar 1945 von Einheiten der von Michail Jefimowitsch Katukow kommandierten 1. Garde-Panzer-Armee der Übergang über die Warthe forciert worden war, wurde Posen bis zum 25. Januar von den Einheiten der bei Stalingrad siegreichen 8. Garde-Armee unter Wassili Iwanowitsch Tschuikow vollständig eingeschlossen. Noch am selben Tag begannen die Sowjets mit dem systematischen Angriff auf die Festungswerke und bereits am folgenden Tag eroberten die Soldaten der 27. und 74. Garde-Schützen-Division zwei Forts im Süden des Festungsrings, womit nun eine Lücke im Verteidigungsring der Stadt klaffte.
Obwohl Reichsführer SS Heinrich Himmler, inzwischen zum Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Weichsel ernannt, den Verteidigern Posens noch am selben Tag gefunkt hatte, dass er sie „nicht im Stich lassen“ werde, war ihr Schicksal zu diesem Zeitpunkt schon besiegelt. Deutscherseits standen keinerlei Kräfte für einen Entsatz zur Verfügung und sowohl Himmler als auch Hitler lehnten schon bald darauf einen „Antrag auf Herausschlagen der Besatzung Posen“ ab.
Ab 28. Januar begann die sowjetische Luftwaffe mit einem heftigen Bombardement der Stadt, während die sowjetische Infanterie in Kämpfen von Stadtteil zu Stadtteil und Haus zu Haus den Kessel um die Stadt immer mehr einengte. Nicht zuletzt wegen dieser Misserfolge der Verteidiger wurde Generalmajor Mattern am 30. Januar 1945 seines Postens als Festungskommandant enthoben. Zu seinem Nachfolger wurde bei offenbar gleichzeitiger Beförderung zum Generalmajor Ernst Gonell bestimmt, der zuvor die Fahnenjunkerschule V in Posen geleitet und am Beginn der Kämpfe den Festungsabschnitt „OST“ kommandiert hatte, wo der sowjetische Hauptangriff erwartet worden war. Gonell, der als erfahrener und „schneidiger“ Soldat galt, der aber laut Tschuikow auch ein „eingefleischter Nazi“ gewesen sein soll, wurde vonseiten Himmlers offenbar eher als dem geschassten Mattern zugetraut, die Stadt zu halten. Allen Berichten zufolge war Gonell überzeugt davon, dass die Stadt entsetzt werden würde und ging dementsprechend energisch an seine neue Aufgabe heran.
In der Nacht vom 30. auf den 31. Januar 1945 brachen die bis zu 1.200 Soldaten, die immer noch in dem im südwestlichen Abschnitt des Festungsringes gelegenen und mittlerweile völlig abgeschnittenen Fort VIII bzw. Fort Grolman (benannt nach einem preussischen General des 19. Jahrhunderts) ausharrten, befehlsgemäss in kleinen Gruppen aus und versuchten sich zur Hauptkampflinie im Westen durchzuschlagen. Unterdessen gingen die Kämpfe um die Festung weiter und banden die Kräfte von insgesamt vier Divisionen der 8. Garde-Armee und zweier weiterer Divisionen der von M. I. Kazakow kommandierten 69. Armee. Den tiefen sowjetischen Einbrüchen im Süden und Südwesten der Stadt folgte am 5. Februar die Eroberung des im Posener Stadtbezirk Weinern gelegenen Behelfsflugplatzes „Zeppelinwiese“ nicht weit entfernt von der Zitadelle. Für die Versorgungsflugzeuge der deutschen Luftwaffe, welche die Stadt ohnehin nur unzureichend versorgen hatten können, gab es fortan keine Möglichkeit mehr, im Stadtgebiet zu landen. Bis dahin waren laut Kriegstagebuch der deutschen Luftflotte 6 allein 110,0 t Munition und Kabel ein- und 277 Personen, überwiegend Verwundete, aber auch Frauen und Kinder, aus der Festung ausgeflogen worden.
Zum Zeitpunkt als der Flugplatz verloren gegangen war, hatten die sowjetischen Truppen bereits einen Grossteil des Posener Stadtgebiets erobert. Am 11. Februar setzte Festungskommandant Gonell, der zwei Tage zuvor für seine Leistungen bei der Verteidigung zum Generalmajor befördert worden war, das Führerhauptquartier davon in Kenntnis, dass seine Truppen „stark kampfmüde [und] zur Apathie neigend [seien], da keine Aussicht auf Entsatz [bestünde]“. Einen Tag später zogen sich die Reste der deutschen Verteidiger in die Zitadelle der alten preussischen Festung zurück, wo die Kämpfe nun ihrem grausamen Höhepunkt entgegengingen. Den bis zu 2000 Mann, die in den östlich der Warthe gelegenen Stadtteilen abgeschnitten waren und für die keine Chance mehr bestand, in die Zitadelle zu gelangen, erteilte Gonell die Erlaubnis zum Ausbruch.
Um die Zitadelle zu stürmen, mussten die dafür vorgesehenen Truppen des 29. Garde-Schützen-Korps, bestehend aus der 27. Garde-Schützen-Division, die nördlich der Zitadelle in Stellung gegangen war, der 82. Garde-Schützen-Division im Südwesten und der 74. Garde-Schützen-Division im Südosten der Zitadelle, den tiefen Graben überwinden, der diese umgab. Am 18. Februar begann der Generalangriff auf die Zitadelle, wobei die sowjetischen Einheiten versuchten, den Festungsgraben mit Leitern zu überwinden. Dabei wurden sie von den Redouten der Zitadelle aus unter schweres Feuer genommen. Erst nach fast drei Tage dauernden Kämpfen konnten die sowjetischen Einheiten die Redouten unter Einsatz von Flammenwerfern und Explosivstoffen oder durch Blockieren ihrer Feuerluken mit Schutt und Geröll zum Schweigen bringen. Nachdem eine Art Sturmbrücke errichtet worden war, um leichter auf den Grund des Grabens und an die Zitadellenmauern zu gelangen, begann am 22. Februar der letzte Abschnitt des langwierigen Kampfes um Posen. An diesem Tag wurde auf deutscher Seite der letzte Funkspruch aus der Festung Posen abgesetzt, in dem unmissverständlich klargemacht wurde, dass mit dem Fall der Festung zu rechnen sei. Einen Tag später, am 23. Februar 1945, um 3:00 Uhr morgens, entschied sich Festungskommandant Gonell den Widerstand einzustellen und zu kapitulieren. Entgegen Himmlers Weisung stellte er den ihm noch verbliebenen Truppen frei, den Ausbruch aus der Zitadelle zu wagen, für den es jetzt allerdings viel zu spät war und den daher auch nur ein kleiner Teil der Festungsbesatzung noch bewerkstelligen konnte. Gonell selbst nahm sich kurz darauf das Leben.
Das Oberkommando der Wehrmacht kommentierte den Fall Posens in seinem Kriegstagebuch mit einem der gewohnt lapidaren Statements, wohingegen die deutsche Presse die militärisch völlig sinnlose Opferung zehntausender Soldaten als „Heldenkampf“ und „[e]rfolgreiche[n] Wellenbrecher gegen die bolschewistische Sturmflut“ bejubelte
Folgen der Schlacht
Der Fall Posens verdeutlicht das völlige Scheitern von Hitlers Strategie, den sowjetischen Vormarsch durch die Bildung so genannter „fester Plätze“ aufhalten oder aber zumindest verlangsamen zu können. Angesichts ihrer gewaltigen Materialüberlegenheit konnten die sowjetischen Streitkräfte es sich leisten, ihren Vormarsch ungebremst fortzusetzen und entsprechende Truppenkontingente zurückzulassen, die Hitlers „Festungen“ anschliessend niederkämpften. In militärischer Hinsicht war die Verteidigung der zahlreichen zu „Festungen“ erklärten Städte an der Ostfront daher ein völlig sinnloses Opfer zehntausender Menschenleben.
Die Schlacht um Posen hatte allein auf deutscher Seite rund 5.000 Menschenleben gefordert. Auf sowjetischer Seite waren rund 6.000 Soldaten umgekommen, ferner eine nicht mehr genau zu eruierende Anzahl von Zivilisten. Von den etwa 2.000 Zivilisten, die am Kampf um die Zitadelle beteiligt waren, starben rund 100. Die Bausubstanz Posens war durch die rund einen Monat andauernden Kampfhandlungen ebenfalls schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. 55 % der Häuser der Stadt waren durch Artilleriefeuer und die Häuserkämpfe teilweise oder vollständig zerstört worden, die Altstadt war sogar zu 75 % zerstört. Vergleichsweise wenig Schaden hatte das Residenzschloss Posen genommen, das nach der Einschliessung der Stadt zum Lazarett umfunktioniert worden war. Schätzungsweise bis zu 2.000 Verwundete waren zuletzt in seinem Inneren untergebracht.
Nachdem das Schloss am 2. Februar von Rotarmisten besetzt worden war, diente es bis März 1945 als Sammelstelle für deutsche Verwundete. Zum Teil wurden diese dort nicht nur beraubt, sondern auch Opfer willkürlicher Racheakte der Sieger. Auch konnten die deutschen Verwundeten von ihren Kriegsgegnern, die sich zudem um eine grosse Anzahl eigener Verwundeter zu kümmern hatten, nur unzureichend versorgt und gepflegt werden, weswegen bald darauf die Ruhr ausbrach. Auf ihrem Höhepunkt forderte diese Krankheit schätzungsweise bis zu 30 Opfer täglich. 1947/48 exhumierten die polnischen Behörden allein im Schlosspark 765 in einem Massengrab verscharrte deutsche Soldaten. Aber auch die in Kriegsgefangenschaft geratenen deutschen Soldaten wurden zum Teil Opfer von Übergriffen der Sieger. Nach ihrer Gefangennahme wurden sie in eigens inszenierten „Propagandamärschen“ durch die Stadt geführt, wobei es immer wieder zu Ausschreitungen seitens der Stadtbewohner kam, die sich auf diese Weise für die jahrelange brutale Repression, der sie unter der deutschen Herrschaft ausgesetzt waren, rächten.
Kesselschlacht von Heiligenbeil (26.01.1945 – 29.03.1945)
Die Kesselschlacht von Heiligenbeil war eine der letzten grossen Kesselschlachten an der Ostfront während der letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs. Der Kessel befand sich nahe Heiligenbeil in Ostpreussen südlich von Königsberg. Die Schlacht war Teil einer grösseren sowjetischen Offensive in der Region Ostpreussen und dauerte vom 26. Januar bis 29. März 1945.
Vorgeschichte
Die deutsche 4. Armee unter General Hossbach wurde von der sowjetischen Armee im Rahmen der Schlacht um Ostpreussen mit dem Rücken zum zugefrorenen Frischen Haff im Raum zwischen Braunsberg und Königsberg eingeschlossen. Durch den sowjetischen Vorstoss zur Ostsee wurde der grösste Teil von Ostpreussen am 25. Januar vom Deutschen Reich abgeschnitten, die Versorgung und der Rückzug lief über Königsberg und den durch die Kriegsmarine versorgten Hafen Pillau. Ein deutscher Gegenangriff durch das auf die Linie Wormditt-Guttstadt umgruppierte VI. Armeekorps versuchte am 26. Januar mit der 131. und 170. Infanterie-Division und der 28. Jäger-Division am 26. Januar vergeblich einen Korridor nach Westen in Richtung Elbing zu öffnen. Im Kessel waren rund 150.000 deutsche Soldaten und viele Flüchtlinge eingeschlossen, die Verbindung zur ebenfalls eingeschlossenen Festung Königsberg blieb bis Mitte März aufrecht.
Am 30. Januar hatte General der Infanterie Friedrich-Wilhelm Müller den Oberbefehl der im Raum Heiligenbeil zusammengedrängten Truppen übernommen. Der Gefechtsstand des AOK 4 lag in Zinten, das am 25. Februar geräumt wurde. Nach dem Tod von General Iwan Tschernjachowski bei Mehlsack im Februar 1945 übernahm General Wassilewski den Oberbefehl über die 3. Weissrussische Front. Der Gauleiter von Ostpreussen, Erich Koch, flog mehrmals zur Koordinierung verschiedener Verteidigungsmassnahmen aus dem belagerten Königsberg in den Kessel, um zum Durchhalten aufzurufen, zog es aber am Schluss vor, sich vor der anbahnenden Katastrophe rechtzeitig in den Westen abzusetzen. Die endgültige Zerschlagung der eingekesselten Truppen durch die Sowjets wurde erst am 13. März in der sogenannten Braunsberger Angriffsoperation begonnen.
Verlauf
Für die Zerschlagung der etwa 16 eingeschlossenen deutschen Divisionen setzte Marschall Wassilewski ganze 6 Armeen ein: Links gegen Braunsberg wurde die 48. Armee gegen das VI. Armeekorps angesetzt. Zwischen Breitlinde und Zinten wurde die 3., 50. und 31. Armee gegen den Abschnitt des XX. Armeekorps konzentriert. Die Front rechts nach Nordwesten anschliessend verlängerte die 28. Armee die Kesselfront gegenüber dem XXXXI. Panzerkorps bis auf die Höhe von Kreuzburg. Nordwärts nach Königsberg hin abschliessend, versuchte die 5. Armee zwischen Kobbelbude und Altenberg antretend, nochmals die Landverbindung nach Königsberg abzuschneiden.
Am 13. März eröffnete ein starker Artillerieschlag der 3. Weissrussischen Front den Angriff. Am 14. März gab die 131. Infanterie-Division an der Südfront den Ort Breitlinde auf. Die Truppen der nachdrängenden 48. Armee konnten am 20. März Braunsberg erobern, der Kessel wurde weiter verengt. Die im Norden noch durch die Panzer-Grenadier-Division „GD“ aufrechterhaltene Verbindung mit Königsberg wurde durch die sowjetische 5. Armee bei Heide-Maulen abgeschnitten. Bis zum 23. März war die Kesselfront auf die Linie Alt-Passarge – Preussisch Bahnau – Schirten – Wollitta eingeengt. Am 25. März nahm die sowjetische 48. Armee in schweren Kämpfen die Stadt Heiligenbeil ein. Die Reste der 4. Armee und viele Flüchtlinge wurden am schmalen Küstenvorsprung der Küstennase von Natangen zwischen Balga und Kahlholz im engsten Raum zusammengedrängt und lagen im direkten Feuerbereich der sowjetischen Geschütze. General Müller hatte sich bereits nach Pillau übersetzen lassen, verlangte aber das weitere Ausharren der Restbesatzung, um möglichst viele Flüchtlinge über See evakuieren zu können.
Am 27. März bauten die Sowjets zwischen Rosenberg und Follendorf eine Batterie mit 17-cm-Kanonen auf und nahmen jedes anlegende Schiff unter Feuer. Die Kriegsmarine setzte dagegen mehrere Zerstörer ein, welche mit ihrem Beschuss die sowjetische Batterie kurzfristig niederhielten. Bis zum 29. März lief parallel zu den letzten dramatischen Kämpfen im Kessel das Drama der Flüchtenden ab, die verzweifelt versuchten einen Platz auf die Fähren zur Übersetzung nach Pillau zu ergattern. Sowjetische Schlachtflieger griffen in das äusserst verlustreiche Geschehen ein, völlig durcheinander geratene deutsche Kampftruppen versuchten bis zum Schluss auf die Laufstege zu kommen.
Folgen
Im Kessel waren in den etwa zweimonatigen Kämpfen rund 80.000 deutsche Soldaten gefallen oder wurden schwer verwundet, 50.000 kamen in sowjetische Gefangenschaft. Um die gleiche Zeit gingen in Westpreussen im Bereich der 2. Armee Gotenhafen und Danzig an die 2. Weissrussische Front verloren. Die Sowjets zogen danach alle Kräfte für die Schlacht um Königsberg zusammen.
Kampf um Küstrin (02.02.1945 – 16.04.1945)
Der Kampf um Küstrin begann gegen Ende des Zweiten Weltkriegs mit der Eroberung der östlich der Oder gelegenen Stadtteile Küstrins Ende Januar 1945 durch die Rote Armee. Kurz darauf, am 2. Februar 1945, folgte der Übergang sowjetischer Truppen nördlich und südlich der auf einer Oderinsel gelegenen Altstadt und der Festung Küstrin. Die dabei gebildeten beiden Brückenköpfe, die von der deutschen Versorgungslinie zur Festung getrennt wurden, waren in der zweiten Märzhälfte 1945 heftig umkämpft. Es gelang der Wehrmacht jedoch weder die Beseitigung der Brückenköpfe noch das Halten der Festung. Am 16. April 1945 war der Brückenkopf von Küstrin wichtigster Ausgangspunkt des sowjetischen Oberkommandos für den Angriff auf Berlin. Die Küstriner Altstadt wurde bei den Kämpfen vollständig zerstört.
Vorgeschichte
Im Zweiten Weltkrieg gelang es der Sowjetischen Armee mit der Operation Bagration im Sommer 1944 die deutsche Heeresgruppe Mitte aus Russland bis nach Polen an die Weichsel zurückzudrängen. Nach dem Warschauer Aufstand herrschte bis Mitte Januar 1945 an dieser Front eine relative Ruhe.
Nach der Offensive von der Weichsel bis zur Oder ab dem 12. Januar 1945 konnten Truppen von Schukows 1. Belorussischer Front in zwei Wochen durch Polen stossen und hatten Ende Januar 1945 auch Küstrin erreicht.
„Am Zusammenfluss von Oder und Warthe befand sich mit der Festung Küstrin einer der am stärksten befestigten Abschnitte Ostdeutschlands. […] Er riegelte den direkten Zugang nach Berlin ab“.
Sowjetischer Vorstoss nach Küstrin
„In den vom 26. bis zum 29. Januar tobenden Schneestürmen schoben sich Schukows erste Einheiten bis zur Oder vor. Am 1. Februar sahen die Vorausabteilungen den Strom vor sich. Er war zugefroren. […] Am 2. Februar gingen Tschuikows erste Einheiten über die Oder. Abgesehen davon, dass ein vereister Strom kein natürliches Hindernis bildete, schien er dort, wo er bei Frankfurt und Küstrin Berlin am nächsten ist, überhaupt nicht mehr verteidigt zu werden“.
Die 8. Gardearmee unter Führung des Generalobersten Tschuikow gewann den südlichen Brückenkopf und die 5. Stossarmee unter Generaloberst Bersarin bewerkstelligte den Übergang nördlich Küstrin. Damit hatten die Sowjets westlich der Oder Fuss gefasst. Nach Berlin waren es noch 65 Kilometer und in der Stadt wurde teils panikartig reagiert. „Es gelang (Bersarin) jedoch nicht, die zentral auf der Oderinsel gelegene Stadt zu nehmen. Damit blieb den Sowjets zunächst die Nutzung der einzigen Oderbrücke in diesem Abschnitt vorenthalten“.
Die sowjetische Strategie beschränkte sich Februar bis Mitte März 1945 darauf, die Oderlinie in voller Länge zu erreichen und zu festigen und in einer zweiten Offensive Pommern von der Odermündung bis nach Danzig und in Ostpreussen Königsberg zu erobern. Damit war die Ostseeküste auf dieser Linie für die Sowjets erreicht und gesichert. Auch der vom harten Winter erschwerte Aufbau der Nachschuborganisation war ein Grund für die sechswöchige Ruhe bei Küstrin.
Eroberung Küstrins
Die ausserordentliche Bedeutung Küstrins als „Tor nach Berlin“ war beiden Seiten bewusst. Auf deutscher Seite hatte der Generalstabschef Guderian zwar die Ablösung des militärisch völlig unbefähigten bisherigen Kommandeur der an der Oder verteidigenden Heeresgruppe Weichsel, Heinrich Himmler, von Hitler erzwungen und ihn am 20. März 1945 durch den Generalobersten Heinrici ersetzen lassen, doch hatte zu diesem Zeitpunkt bereits der russische Angriff zur Vereinigung der beiden Brückenköpfe begonnen:

„Bis jetzt klaffte noch eine Lücke von drei Kilometern […] zwischen den Brückenköpfen am westlichen Oderufer. Durch diesen schmalen Streifen hielt der Gegner die Verbindung mit der Festung Küstrin (aufrecht) […] Wenn sich die Flügel unserer beiden Armeen vereinigten, war die Besatzung der Festung abgeschnitten“.
Vereinigung der Brückenköpfe
Der sowjetische Angriff begann am 18. März mit einem 4-Tage-Bombardement der deutschen Befestigungen. Am 21. März gingen die 8. Gardearmee unter dem Kommando Tschuikows von Süden und die 5. Stossarmee unter Generaloberst Bersarin von Norden her gegen die Bahnlinie vor, die beide Brückenköpfe westlich der Oder noch trennte und deutscherseits die Verbindung zur sonst völlig umschlossenen Festung Küstrin herstellte. Nach dem Sturmangriff am 22. März gelang der Zusammenschluss der russischen Brückenköpfe und damit der Einschluss der Festung.
Zwei Gegenangriffe der Wehrmacht am 23. und am 24. März wurden unter hohen Verlusten auf beiden Seiten zurückgeworfen.

„Guderian, dem Heinrici davon berichtete, sagte schroff: ‚Es muss noch einmal angegriffen werden.‘ Hitler wollte es und das war für Guderian entscheidend. […] Und so hatte Busse am 27. März seine Truppen noch einmal gegen Küstrin geworfen. Diesmal gelang es einem Teil der Panzer tatsächlich, bis zur Stadt durchzubrechen. Doch die nachdringenden Einheiten gingen im Abwehrfeuer unter“. […] Bei dem „blutige(n) Massaker (waren) 8000 Mann – fast eine ganze Division – gefallen“.

„Das Armeeoberkommando wollte sich mit der Lage abfinden, weil es weitere Angriffe, nachdem der Feind Zeit zur Festigung in dem neu gewonnenen Gebiet gehabt hatte, erst recht für aussichtslos hielt. Hitler befahl trotz aller Gegenvorstellungen den erneuten Angriff für den 28. März 1945“.
Während der Lagebesprechung bei Hitler am 28. März kam es zu wutentbrannten Rededuellen zwischen Guderian und Hitler über den Sinn dieser Angriffe, wobei besonders die Verwendung von Truppen der Heeresgruppenreserve den energischen Einspruch Guderians zur Folge hatte, der diese Einsätze für vorbereitende Offensivoperationen nicht dulden wollte. Hitler verabschiedete ihn in einen sechswöchigen Genesungsurlaub.
Eroberung der Festung
In den schweren Kämpfen um Küstrin 1945 diente das Neue Werk als Unterkunft und blieb von den schweren Kampfhandlungen weitestgehend verschont. Bis zum 12. März 1945 wurde das Fort gehalten, ehe es wegen Munitionsmangel aufgegeben werden musste. An diesem Tag wurde die Küstriner Neustadt von der Roten Armee überrannt.
Nur die Festung Küstrin auf der Oderinsel war noch in deutscher Hand verblieben. Die Offensive zu ihrer Eroberung begann nach dem Rückzug der deutschen Truppen am 28. März ein oder zwei Tage später und dem Sturmangriff am folgenden Tag auf die Festung.
Ende März gelang es den Russen dann, Küstrin zu nehmen und den gegenüberliegenden Brückenkopf zu erweitern sowie südlich von Frankfurt einen weiteren zu bilden. Beide Brückenköpfe waren weniger als 65 Kilometer von Berlin entfernt“. „Der Kommandant von Küstrin […] erreichte mit schwachen, nicht mehr kampffähigen Resten seiner [..] Besatzung in der Nacht zum 1. April die eigenen Linien. Er selbst wurde auf Befehl Hitlers verhaftet, um abgeurteilt zu werden.
Hitler, der erkannte, dass der Kampf um Küstrin und den Brückenkopf bereits eine Vorentscheidung brachte, hatte vergebens auf dessen Beseitigung und das Freikämpfen der Festung gesetzt. „Doch die Russen waren viel zu stark“.
Nun begannen die unmittelbaren Vorbereitungen der Roten Armee zum Angriff auf die Reichshauptstadt.
Bei den Kämpfen um die Festung Küstrin wurde die Altstadt Küstrin vollständig zerstört. Die verbliebenen Reste dienten in den Nachkriegsjahren als Steinbruch für den Wiederaufbau der polnischen Stadt Kostrzyn. Die Strassen sind noch heute erkennbar und auch ausgeschildert, jedoch ist von den Bauwerken nicht viel mehr als die Grundmauern erhalten.
Ausbau des Brückenkopfes
Der Brückenkopf bei Küstrin bot nach einem Ausbruch den direkten Weg nach Berlin und in ihm konnte ein grosses Aufgebot an Panzern untergebracht werden, die an anderen Angriffspunkten erst über den Fluss gebracht werden mussten. Das nächste Hindernis waren die Seelower Höhen.
Am Ostersonntag, den 1. April 1945, waren die beiden Marschälle Schukow und Konew in Moskau zum Rapport bei Stalin und dem Staatlichen Verteidigungskomitee. Binnen zwei Tagen musste ein Angriffsplan ausgearbeitet werden. Schukow erklärte, dass der Hauptangriff aus dem mittlerweile „vierundvierzig Kilometer langen Oderbrückenkopf aus erfolgen (werde)“. Hier sollten sechs Armeen, darunter zwei Panzerarmeen und „einschliesslich der nachrückenden Truppen […] 768’000 Mann eingesetzt werden. Schukow hoffte, im Küstriner Brückenkopf mindestens 250 Geschütze pro Kilometer aufstellen zu können“. Als Termin dieser letzten Offensive wird der 16. April 1945 festgesetzt.
Bis zum Angriffsbeginn wurden im Küstriner Brückenkopf für die Artillerie 4500 Stellungen gebaut, 636 Kilometer Verbindungsgräben und über die Oder 25 Brücken, viele davon „Unterwasserbrücken“, geschlagen. Dazu kamen riesige Vorräte an Munition, Treibstoff und an Lebensmitteln. Dem Frontabschnitt war die 16. Luftarmee zugeordnet.
Deutsche Abwehrvorbereitungen

„Vom 30. März ab wurde von der deutschen Luftaufklärung zahlreiche sowjetische Truppenbewegungen in Richtung auf Küstrin und Frankfurt an der Oder festgestellt“.
Ungeachtet der tatsächlichen Lage „kam (Hitler) zu der Erkenntnis, dass die Konzentration der russischen Armeen bei Küstrin nichts weiter als ein grosses Täuschungsmanöver sei. Die sowjetische Hauptoffensive richtete sich seiner Meinung nach auf Prag – nicht auf Berlin. […] Am Abend des 5. April befahl er, vier von Heinricis bewährten Panzereinheiten nach Süden zu verlegen. Gerade sie hätte Heinrici gebraucht, um den russischen Vorstoss abzufangen“.
Der deutsche Kommandeur der Heeresgruppe Weichsel, die im Norden die 3. Panzerarmee und in der Mitte und im Süden die 9. Armee umfasst, fand sich am 6. April zur entscheidenden Lagebesprechung bei Hitler ein. Generaloberst Heinrici hielt einen ungeschminkten Vortrag über die Lage der Verteidigung – vor allem gäbe es keinerlei Reserven. Spontan stellten Göring, Himmler und Dönitz aus ihren Verbänden 150.000 Mann zur Verfügung. Damit war für Hitler das Thema erledigt. Auch die abgegebenen Panzerdivisionen erhält Heinrici nicht zurück. Nachdem Hitler die Vorbereitungen in Küstrin noch zum „Nebenangriff“ erklärt hatte und auf den weiteren Lagevortrag Heinricis verzichtete, zog dieser sich mit dem Hinweis zurück, dass er einen erfolgreichen Ausgang nicht garantieren könne.
„Mit 25 deutschen Divisionen verschiedener Waffengattung und Kampfstärke, 857 Panzern und Sturmgeschützen und mit einer Luftwaffe, die wegen Benzinmangel kaum länger als drei Tage im Einsatz sein kann …“ – verteilt auf die gesamte Front von der Odermündung bis Muskau, soll Heinrici die russische Offensive mit 1,5 Millionen Mann, 6000 Panzern, 40.000 Geschützen und 6696 Flugzeugen abwehren.
Sowjetische Oderoffensive
Nachdem die 2. Belorussische Front unter Marschall K. K. Rokossowski die Ostseeküste bis Danzig erobert hatte, wurden ihre Armeen Richtung Osten an den nördlichen Abschnitt der Oder mit Hauptquartier Stettin verlegt.
Die 1. Belorussische Front übernahm den Abschnitt vom Brückenkopf Küstrin bis nördlich Frankfurt/Oder. Ihr Befehlshaber Schukow sollte auf direktem Wege Berlin erobern.
Bei Frankfurt schloss die 1. Ukrainische Front des Marschalls Konew an, der zum einen nach Dresden vorstossen sollte, zum anderen von Stalin auch die Zusage erhielt, bei raschem Durchbruch mit seinem rechten Flügel nach Berlin vordringen zu können.
„Seit dem 12. April 1945 begannen dann aus dem Küstriner Brückenkopf heraus bis zu einem Regiment starke sowjetische Erkundungsvorstösse. Diese Angriffe waren für beide Seiten äusserst verlustreich, drängten die deutschen Linien jedoch zurück“.
Der Angriff der Roten Armee begann um 5.30 Uhr am 16. April 1945 mit einem Artillerieschlag auf die deutsche Front. Kommandeur Heinrici hatte jedoch die vorderen Linien kurz zuvor räumen lassen, so dass die Truppen intakt blieben und Stellung an den Seelower Höhen beziehen konnten.
Doch schon am Abend des ersten Angriffstages notiert der Erste Generalstabsoffizier der Heeresgruppe Weichsel: „Erwarten morgen die Fortsetzung dieses Angriffes. Aufgrund der eigenen Verluste wird der Tag noch schwerer werden. Schwerpunkt südlich Küstrin, Raum Seelow und Raum Wriezen“.
„Innerhalb von vier Tagen zerbröckelt die deutsche Front westlich Küstrin. Sämtliche Reserven der Heeresgruppe Weichsel sind aufgebraucht“. Die Schlacht um Berlin hatte begonnen.
Schlacht im Reichswald (07.02.1945)22.02.1945
Die Schlacht im Reichswald (engl: Operation Veritable) fand im Zweiten Weltkrieg zwischen alliierten Expeditionsstreitkräften der 21st Army Group und Verbänden der deutschen 1. Fallschirm-Armee vom 7. bis 22. Februar 1945 im Raum Kleve am Niederrhein statt. Die erbitterten Kämpfe um den Klever Reichwald erstreckten sich über zwei Wochen; über 10.000 alliierte und deutsche Soldaten fielen. Auch die Zivilbevölkerung erlitt schwere Verluste. Die Schlacht bildete den Auftakt des Rheinfeldzuges, der bis zum 10. März 1945 auf der ganzen Länge des westlichen deutschen Rheinufers zur Vertreibung der deutschen Truppen führte. Im Kampfraum setzte danach die britisch-kanadische 21. Heeresgruppe am 24. März 1945 bei Wesel über den Rhein.
Ausgangslage
Nach den Invasionen in der Normandie am 6. Juni 1944 und in Südfrankreich am 15. August 1944 war es den Westalliierten im Spätsommer gelungen, rasch durch Frankreich und im Norden über Belgien und die Niederlande bis zur deutschen Grenze vorzustossen. Dort hatte sich die deutsche Front wieder stabilisiert und nach dem Abwehrerfolg bei Arnheim gingen Amerikaner und Briten zur Reorganisation und zum Aufbau eines starken Nachschubs über.
Im Hintergrund schwelte der Streit zwischen zwei Strategien: Nach Montgomerys Auffassung hatten die Amerikaner seinen geplanten konzentrierten Vorstoss nach Deutschland ins Ruhrgebiet hinein (und eine mögliche Beendung des Krieges noch 1944) durch das faktische Beharren auf einem breit angelegten Vorgehen geschwächt. Zwar hatte Eisenhower diesen Plan durchaus abgewogen, ihn jedoch nicht eindeutig unterstützt und 1945 sah er keinen Sinn mehr in einem geballten Vorstoss.
Feldzugsplan Eisenhowers
Die Operation Veritable war Teil des Feldzugsplanes Eisenhowers, des Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Nordwesteuropa (SHAEF), der nach dem Rückschlag durch die Ardennenoffensive annahm, „dass ein weiterer grosser, auf breiter Front offensiv geführter Feldzug Hitler-Deutschland den Fangstoss versetzen“ werde. In einer ersten Phase sollte es darauf ankommen, „die Masse der feindlichen Armeen westlich des Rheins zu vernichten“.
Zwar sollte Montgomerys 21. Heeresgruppe den Hauptstoss im Norden führen, doch forderten die Briten nach „der alten Streitfrage vom Herbst [1944]: ein einziger Stoss oder breite Front“, auf das breit angelegte Vorgehen zu Gunsten eines ihre Operation verstärkenden Unternehmens zu verzichten. Die Amerikaner setzten sich jedoch durch – dabei war auch von Bedeutung, dass mittlerweile der sowjetische Erfolg in der Winteroffensive vom Januar 1945 bekannt war und die damit durch den Abzug von Truppen geschwächte deutsche Westfront überwindbarer erschien. So wurde der Rheinfeldzug von Eisenhower in drei Phasen entwickelt: Im Norden „durch zusammenlaufende Angriffe der kanadischen 1. Armee vom Reichswald und der amerikanischen 9. Armee von der Roer“ Rur, beide unter Montgomerys Kommando. (Dies löste noch heftige Proteste des Kommandierenden der 12. amerikanischen Heeresgruppe – General Bradley – aus). In der Mitte sollte die 1. Amerikanische Armee auf Köln und dann südostwärts zur Eifel vorstossen, während die 3. US-Armee (Patton) zeitgleich frontal durch die Eifel Richtung Koblenz vorgehen sollte und danach zusammen mit der 7. US-Armee im Süden das Dreieck Mosel-Saar-Rhein bis auf die Höhe von Karlsruhe sichern. Ziel der Alliierten war, das Westufer des Rheins zu besetzen.
Ausgangslage der Operation Veritable
„Am 8. Februar [1945 …] brach das dem kanadischen 1. Armeekommando unterstellte XXX. Korps südöstlich von Nimwegen aus dem zusammengepressten Frontvorsprung zwischen Maas und Rhein gegen den Reichswald vor. […] Das dem Angriff vorausgehende Trommelfeuer dauerte fünfeinhalb Stunden, und am ersten Tag verschossen 1034 Geschütze auf eine Front von sieben Meilen, die von einer einzigen deutschen Division besetzt war, über eine halbe Million Granaten“. Der Korpskommandeur Horrocks setzte 5 Infanterie-Divisionen, 3 Panzerbrigaden und 11 Spezialregimenter zur Bezwingung von Befestigungen ein, dahinter 2 Divisionen zur operativen Ausnutzung. Durch den schmalen Korridor zwischen dem Wald und den überschwemmten Flusstälern führten jedoch nur zwei Schotterstrassen hindurch. Zudem hatten die Deutschen fünf Monate ungestört Zeit zum Bau von Abwehrstellungen. Jenseits des Reichswalds waren die Städte Kleve und Goch stark befestigt „und weiter südlich stand ein schnelles Korps von 3 Divisionen bereit, um einem Angriff über die Roer oder die Maas zu begegnen“.
Geländeverhältnisse
Die Flüsse Maas – Rur – Rhein und der Niederrheinische Höhenzug waren natürliche Hindernisse. Der Westteil der Pfalzdorfer Höhen ging als „Reichswald“ in die Kriegsgeschichte ein. Im Gelände gab es eine Reihe behelfsmässiger, jedoch auch gut ausgebauter Stellungen.
Nach dem Fehlschlag in den Ardennen war der deutschen militärischen Führung bewusst, dass eine Grossoffensive zu erwarten war. Seit Dezember 1944 standen immer grössere Teile der Rheinniederung unter Wasser, nachdem begonnen wurde, Rhein- und Waal-Deiche zu sprengen. Die Rheinniederung war so für die hier angreifenden Briten und Kanadier zu einem schwierigeren Hindernis geworden. Mit den Angriffen hatte dann auch Tauwetter eingesetzt.
Der Angriff
Zur Zeit der Planung der Operation war der Boden gefroren und trug. Als aber die Angriffsdivisionen […] in den Reichswald eindrangen, hatten die Fahrwege begonnen, sich in Schlamm zu verwandeln, während das Hochwasser in den Flanken stieg“. Die deutsche Frontdivision wurde nach dem Bombardement zwar durchstossen und die Angriffsspitze erreichte am Nachmittag des zweiten Tages Kleve: „Die Stadt war aber nicht, wie Horrocks gefordert hatte, mit Brandbomben, sondern mit 1384 Tonnen Sprengbomben belegt worden, und in den zerkraterten und trümmerbedeckten Strassen kam der Angriff zum Stehen“. Noch ohne Meldung darüber hatte Horrocks Verstärkungen eingesetzt, die auf den mittlerweile verstopften Strassen hängen blieben, denn Fahrzeuge konnten nicht auf die überschwemmten Felder ausweichen. Das Chaos auf den Zugängen und in der inzwischen mit deutschen Truppen verstärkten Stadt verzögerte die Fortführung des Angriffs. „Erst am 11. Februar war Kleve und am 13. Februar der Reichswald vom Feind frei. Bis dahin aber hatten die Deutschen zwei Panzer-Divisionen und zwei Fallschirmjäger-Divisionen herangebracht, die den Ausbruch vereitelten.
Lage
Die deutsche Führung konnte gegen den Angriff aus dem Reichswald starke Kräfte zusammenfassen, weil sie im Augenblick keinen Angriff über die Roer zu befürchten brauchte. […] Die Offensive der amerikanische 9. Armee [sollte] am 10. Februar (Operation ‚Grenade‘) beginnen, 48 Stunden nach der Eröffnung von Veritable. Am 9. Februar jedoch, als die Amerikaner den letzten der Roerstaudämme erreichten, hatten die Deutschen die Ablaufeinrichtungen zerstört und damit bewirkt, dass das Hochwasser des Flusses unter zwei Wochen nicht zurückging“. Der Angriff der 9. US-Armee war durch das Hochwasser blockiert.
Verbände der Wehrmacht hatten am 9. Februar 1945 nicht nur Deiche am Niederrhein gesprengt, sondern auch die Verschlüsse des Kermeterstollens am Kraftwerk Heimbach (woraufhin die Urfttalsperre bis zum Niveau des Kermeterstollens leer lief) und die Verschlüsse der Grundablassstollen der Staumauer Schwammenauel (Rursee). Beides zusammen erzeugte flussabwärts ein Hochwasser, das die Flussauen verschlammte und den Übersetzversuch der 9. US-Armee vereitelte.

„Die Amerikaner waren somit gezwungen, die Operation „Grenade“ zu verschieben. […] Genötigt, die Schlacht weitere vierzehn Tage allein fortzuführen, gewannen Briten und Kanadier nur langsam Boden und wurden in einen äusserst grimmigen Kampf verstrickt. […] Während die amerikanische 1. und die amerikanische 9. Armee gezwungen waren, hinter der hochgehenden Roer untätig zu warten, wurden an einer Front, die von einer Division besetzt gewesen war, 9 deutsche Divisionen in die Schlacht hineingerissen. In diesen vierzehn Tagen schweren Ringens zog die 1. kanadische Armee die Reserven auf sich, die v. Rundstedt (Oberkommandierender an der Westfront) in der kölnischen Ebene aufzustellen sich gemüht hatte“.
– Chester Wilmot, Der Kampf um Europa, S. 724.
Nach Wilmot hatte das Alliierte Hauptquartier (SHAEF) angenommen, dass die Wehrmacht „rechtzeitig in voller Ordnung hinter den Rhein zurückgehen würde“, doch man übersah dabei, dass der Rhein „der lebenswichtige Verkehrsweg zwischen dem Ruhrgebiet und der Rüstungsindustrie im übrigen Deutschland war. […] Es war die Notwendigkeit, den Wasserweg offenzuhalten, was die Wehrmacht dazu trieb, dem Angriff auf den Reichswald so erbitterten und hartnäckigen Widerstand entgegenzusetzen“.
Erneuter Ansatz des Rheinfeldzugs
Im Zusammenhang, mit dem vom nachlassenden Hochwasser ermöglichten Neuansatz des Angriffs der 9. US-Armee ab dem 23. Februar 1945 konnte auch die Operation Veritable neu angesetzt werden – sie lief nun unter dem Namen Operation Blockbuster.
Angriff der 9. US-Armee
„Am 23. Februar gegen Morgen begannen 4 Divisionen der 9. Armee und 2 der 1. Armee die Roer zu überschreiten (Operation Grenade). Da das Hochwasser noch nicht völlig wieder zurückgegangen war, kam der Angriff, vor dem sich die Deutschen noch sicher gewähnt hatten, einigermassen überraschend. [… ] Am Abend des zweiten Tages hatten Simpsons Divisionen neunzehn Brücken geschlagen, darunter sieben für Panzer“. Nach einigen hinhaltenden Kämpfen kam die 9. Armee ab dem 28. Februar 1945 zügig voran und am 2. März besetzte sie Neuss.
Anfang März war der Widerstand überrollt, der rechte Flügel stand kurz darauf südlich Düsseldorf am Rhein, „und am 3. März nahm (Simpsons) linker Flügel nördlich von Venlo mit der kanadischen Armee Verbindung auf“. Am 6. März gelang auch eine Verbindung bei Wesel.
Angriffsfortsetzung nach Veritable
Am 22. Februar 1945 hatte die 1. Kanadische Armee mit dem XXX. britischen Korps die Offensive erneuert (Operation Blockbuster), am 25. Februar kam es zu Kämpfen bei Goch (bis 3. März), am 27. Februar fiel Kalkar und nach harten Kämpfen wurde Uedem erreicht: Drei britisch-kanadische Divisionen nahmen deutsche Positionen im Uedemer Hochwald, bevor sie auf Xanten vorrückten. Nördlich von Uedem, am Uedemer Totenhügel, wurden die kanadischen Truppen unter General Crerar in die schwerste Panzerschlacht ihrer Geschichte verwickelt. Am 3. März vereinten sie sich in Berendonk bei Geldern mit der 9. US-Armee.
Endphase der Rheinfeldzugs
Am 2. März wurden die deutschen Truppen Richtung Rhein zurückgezogen, um noch einen Brückenkopf zu halten. „Nun waren 15 deutsche Divisionen westlich des Rheins in einen Schraubstock gepresst und der Vernichtung ausgesetzt, wenn sie nicht sofort herausgezogen wurden. Dies aber verbot Hitler“. Zwischen Krefeld und Wesel musste ein Brückenkopf gehalten werden, um von Duisburg über den Dortmund-Ems-Kanal [er führte damals bis zum Rhein] nach Mitteldeutschland die Verbindung zu sichern. „Auch in der Eifel und im Saarland verbot Hitler jedes Zurückgehen: Ein Rückzug ‚heisst nur, die Katastrophe von einem Platz zum andern zu verschieben‘“.
Nach dem Rückzug der 1. Fallschirmjägerarmee am 10. März 1945 befand sich das westliche Rheinufer von Wesel bis Emmerich vollständig in der Hand der alliierten Truppen. 10 deutschen Divisionen verblieb nur die Übergabe, 50.000 Mann wurden gefangen genommen.
Planmässig hatte ab 1. März 1945 auch die 1. US-Armee den Angriff begonnen (Operation Lumberjack). Sie überquerte die Erft, das Nordkorps erreichte am 4. März Euskirchen und am 5. März Köln – vor dem brückenlosen Rhein. Am 7. März 1945 gelang es der Spitze der 9. US-Panzerdivision, die Ludendorff-Brücke bei Remagen im Handstreich zu erobern.
Der Angriff der 3. US-Armee (Patton) durch die Eifel, der vom Südkorps der 1. US-Armee unterstützt wurde, auf den Raum von Koblenz begann am 25. Februar 1945, erreichte den Rhein dort am 7. März und wenig später auch südlich Mainz, Oppenheim und Mannheim.
Die 7. US-Armee gewann die Pfalz und den Rhein von Mannheim anschliessend an den bisherigen Frontverlauf nördlich von Strassburg. Am 10. März 1945 war das westliche Rheinufer somit für die Westalliierten „feindfrei“.
Bedeutung der Operation Veritable
Die Bedeutung der Schlacht im Norden – der Operation Veritable – lag vor allem daran, dass sie sämtliche deutschen Reserven auf sich zog und damit die Angriffe der US-Armeen erheblich erleichterte. Nach Wilmot geht dies auch aus der Verlustliste hervor: So hatten „die Kanadier und Briten bei der Bereinigung des unteren Rheinlandes mehr als doppelt so viel Verluste erlitten wie die Amerikaner: 15.634 gegenüber 7.478. Die deutschen Verluste können nicht viel weniger als 75.000 betragen haben, da vom 8. Februar bis zum 10. März 53.000 Deutsche in Gefangenschaft gerieten“.
Der britische Ehrenfriedhof im Reichswald
Aufgrund der verlustreichen Schlacht wurde der Britische Ehrenfriedhof im Reichswald angelegt. Er ist flächenmässig der grösste britische Soldatenfriedhof der 15 in Deutschland liegenden Sammelfriedhöfe und hat 7.654 Gräber. Im rechten hinteren Bereich sind Gräber von Soldaten der 53. Welsh Division, die bei dieser Schlacht fielen.
Anmerkungen
- Es bestand eine behelfsmässige Maas-Rur-Stellung etwa zwischen Heinsberg und Venlo – sie wurde vor dem 1. März kampflos geräumt – und die Niers-Rur-Stellung (auch Schlieffenlinie genannt). Letztere begann bei Niedermörmter / Rees am Rhein und verlief nach Süden Richtung Geldern (Ralph Trost (2001), S. 429 nennt Niedermörmter, Xanten-Marienbaum, Appeldorn am Westrand des Uedemer Hochwaldes und den Balberger Wald nach Geldern. In der Gegend von Uedemerbruch lag die Niers-Rur-Stellung nahe der Bahnstrecke Goch-Xanten (Quelle: Kevelaerer Enzyklopädie). Die Niers-Rur-Stellung hatte drei Abschnitte: Wankum, Viersen und Erkelenz (Quelle: Panzergraben Süchteln (140)) und dann östlich der Niers flussaufwärts nach Süden).
- In Anbetracht des Zustandes der Eisenbahnen gab es keinen Ersatz für den Rhein als Transportweg, und nachdem Oberschlesien verloren gegangen war, konnte das Ruhrgebiet „als Quelle für Kohle und Fertigstahl (nicht) im Geringsten entbehrt werden“.(Wilmot: Der Kampf um Europa, S. 724)
- Führer-Lagebesprechungen, Bruchstück 1. Das genaue Datum ist nicht bekannt, offenbar hat aber die betreffende Konferenz vor dem 6. März 1945 stattgefunden.
Niederschlesische Operation (08.02.1945 – 24.02.1945)
Die Niederschlesische Operation (russisch Нижнесилезская операция) war eine Offensive der Roten Armee an der deutsch-sowjetischen Front des Zweiten Weltkrieges, die vom 8. Februar bis zum 24. Februar 1945 dauerte und von den Einheiten der 1. Ukrainischen Front gegen die deutsche Heeresgruppe Mitte in Niederschlesien durchgeführt wurde.
Ausgangslage
Schon Ende Januar 1945 hatte die Rote Armee im Rahmen der Weichsel-Oder-Operation die Vorkriegsgrenze des Deutschen Reiches im Bereich Oberschlesien überschritten. Die Verbände der Heeresgruppe Mitte befanden sich seit dem sowjetischen Durchbruch an der Weichsel Mitte Januar 1945 praktisch im ständigen Rückzug in Richtung Westen, verwickelt in andauernde Kämpfe mit den schnell vorrückenden und überholenden Einheiten der Roten Armee („Wandernde Kessel“). Die Herstellung einer stabilen Hauptkampflinie (HKL) entlang der Oder und das Aufhalten der feindlichen Kräfte war nicht gelungen. Der sowjetischen 3. Garde-Armee, 13. Armee und 4. Panzerarmee war es zwar misslungen, die Stadt Breslau einzunehmen, aber es waren Stellungen am westlichen Ufer der Oder im Raum Steinau erobert und ausgebaut worden. Ähnliches geschah im Raum Ohlau, wo sich die sowjetische 52. Armee und 3. Gardepanzerarmee festsetzten. Südlich von Oppeln bis Cosel in Oberschlesien lagen die sowjetische 59. und 60. Armee. Die Ausgangsstellungen dieser drei Gruppierungen dienten dann als Brückenköpfe für den kommenden sowjetischen Grossangriff. Auf der sowjetischen Seite wurde ferner die 2. Luft-Armee eingesetzt.
Für die Reichsregierung war die Provinz Schlesien wegen ihrer zahlreichen Industriebetriebe von grösster Bedeutung. Als das Oberschlesische Industriegebiet Ende Januar 1945 verloren ging, wies Rüstungsminister Albert Speer darauf hin, „dass die Leistung der Wehrwirtschaft gegenüber der noch im Dezember [1944] erzielten auf 1/4 absinken würde“. Niederschlesien und die Mährisch-Ostrauer Region waren aber nach wie vor bedeutsam als Zentren der Waffenproduktion und der Steinkohleförderung.
Ziele der Operation
Der Operationsplan wurde Ende Januar vom Stabsoffizieren der 1. Ukrainischen Front unter Marschall Iwan Konew und dessen Stabschef Wassili Sokolowski erarbeitet und vom sowjetischen Hauptquartier Stawka am 29. Januar gebilligt. Die eilige Planausarbeitung ist ein Hinweis auf den Wetteifer gegenüber dem Konkurrenten Georgi Schukow, der – stets von Stalin bevorzugt – im Alleingang die Reichshauptstadt erobern könnte. Die Operation sollte um den 25. bis 28. Februar mit dem Erreichen der Elbe enden.
Es sollte also die letzte Erstürmung werden. Die Zerschlagung der deutschen Verbände um Breslau, der Vorstoss über die Niederlausitz in Richtung Sprottau und Cottbus, die südwestliche Umgehung von Berlin und ein koordiniertes Vorgehen mit der 1. Weissrussischen Front gegen die Hauptstadt waren als Ziele in der Direktive des 1. Kriegsrates vom 31. Januar 1945 erfasst.
Die Erfolge des bisherigen Vormarsches durch Weissrussland und Polen (ca. 150 km pro Woche in der Operationszeit) hatten das sowjetische Oberkommando zum Setzen dieser weitgesteckten Ziele verführt. Die Kampfkraft der Deutschen zu diesem Zeitpunkt wurde von der Roten Armee generell als gering eingeschätzt, es wurde mit einem eher schwachen Widerstand und einer schnellen Eroberung der Reichshauptstadt gerechnet.
Den Schwerpunkt des Angriffes bildeten auf dem rechten Frontflügel nordwestlich von Breslau vier Armeen (3. Garde-Armee, 13., 52. und 6. Armee), zwei Panzerarmeen (3. Garde-Panzer- und 4. Panzerarmee), sowie ein Panzer- (25.) und ein mechanisiertes (7.) Gardekorps. Die zweite Stossgruppierung mit der 5. Garde-Armee, der 21. Armee und dem 4. Garde- und 31. Panzerkorps konzentrierte sich um den Brückenkopf bei Ohlau südlich von Breslau. Diese Gruppe erhielt den Auftrag, in Richtung Dresden vorzurücken und sollte die Elbe um den 25. Februar erreichen. Die dritte Stossgruppierung konzentrierte sich auf dem linken Flügel der Front südöstlich von Oppeln und bestand aus der 59. und 60. Armee sowie dem 1. Garde-Kavalleriekorps. Sie sollte von dem Brückenkopf im Raum Cosel aus bis an die Sudeten vorrücken und die Handlungen der anderen Frontteile unterstützen. Die sowjetischen Armeegruppierungen wurden in ihrer Tiefe entsprechend gestaffelt: Einer Panzerarmee folgte direkt eine Schützenarmee.
Sowjetische Angriffsvorbereitungen
Die Vorbereitungszeit der neuen Offensive nach dem Beenden der Weichsel-Oder-Operation wurde von Marschall Konew knapp bemessen. Obwohl die Rote Armee seit Mitte Januar etwa 400 Kilometer nach Westen vorgestossen war, standen nur einige Tage zur Umgruppierung und Auffrischung und zum Heranschaffen von Munition und Kriegsgerät zur Verfügung. Der Personal- und Ausrüstungsstand vieler sowjetischer Einheiten war erheblich abgesunken, jedoch bestand immer noch eine Übermacht gegenüber den Wehrmachtverbänden. Der Grund für die eilige Fortsetzung des Vormarsches lag in mehreren Grundsätzen. Zunächst wollte man den deutschen Kräften keine Möglichkeit und Zeit zur Stabilisierung der Front und zum Ausbau ihrer Verteidigung geben. Auch war die bisher erreichte Frontlinie, insbesondere am mittleren und unteren Lauf der Oder, für die sowjetische Armee ungünstig und erforderte entsprechende Sicherungen an den Frontflügeln. Die 1. Weissrussische Front war bereits weiter westlich bis nach Küstrin vorangekommen, abgegrenzt durch den Fluss Oder von den südlich liegenden deutschen Einheiten, die jederzeit eine Bedrohung für ihre linke Flanke darstellen konnten.
Das sowjetisch-deutsche Kräfteverhältnis an der Oderfront gestaltete sich je nach Frontabschnitt unterschiedlich. Laut offiziellen sowjetischen Quellen betrug es nördlich von Breslau bei Infanterieeinheiten 2,3:1, bei der Artillerie 6,6:1, bei Panzern 5,7:1. Südlich der Stadtfestung betrug die Überlegenheit bei der Infanterie 1,7:1, bei der Artillerie 3,3:1 und bei Panzern 4:1. Noch weiter südlich war das Verhältnis der Kräfte fast ausgeglichen. Diese Angaben sind auch die einzigen Quellen über die Stärke der deutschen Truppen zu diesem Zeitpunkt, da Angaben von deutscher Seite nicht vorliegen. Insgesamt lagen aber Stärke und Ausrüstung der 1. Ukrainischen Front deutlich unter den Vorgaben des sowjetischen Oberkommandos.
Zu Beginn der Operation wurden für Konews Truppen 2215 einsatzfähige Panzer und Selbstfahrlafetten gemeldet, gegenüber 3661 beim Beginn der Weichsel-Oder-Operation am 12. Januar. Auf die 3. Garde-Panzerarmee entfielen davon 379 Panzer und 188 Selbstfahrlafetten, was jeweils 56 % bzw. 72 % des Sollbestandes darstellte. Bei der 4. Panzerarmee gab es 414 Panzer und Geschütze (55 % vom Soll). Die Panzerkorps zählten je etwa 120–150 Panzer. Bei der Infanterie zählten die Divisionen durchschnittlich etwas über 4000 Soldaten (50 % vom Soll). Die unterstützende sowjetische 2. Luftarmee verfügte über 2815 einsatzfähige Flugzeuge. Ab Ende Januar wurden einige Kommandotrupps per Fallschirm im deutschen Hinterland abgesetzt, deren primäre Aufgabe das Erkunden der Lage der Wehrmachtverbände war.
Pläne der deutschen Parteiführung
Nachdem die Kampfhandlungen immer weiter auf das Reichsgebiet übergriffen, stellte sich erneut die Frage der Befehlsführung in den betroffenen Heimatgebieten. Ein Operationsgebiet auf dem Reichsgebiet gab es laut den bisherigen Vorschriften eigentlich nicht. Die Wehrmacht war hier nur auf militärische Aufgaben beschränkt. Bis zur Front hielten die Gauleiter als Reichsverteidigungs – Kommissare die Verwaltungsbefugnisse und staatliche Hoheitsrechte in ihren Händen, was auch die Befehlsgewalt und ein Übergehen der Verantwortlichkeit von der Wehrmacht auf die von Hitler bevorzugte Partei beinhaltete. Nur in einer Kampfzone von etwa 20 km Tiefe war das Feldheer gegenüber den Dienststellen der Gauleiter weisungsberechtigt. Die Unfähigkeit der eingesetzten Gauleiter Karl Hanke, Fritz Bracht und Hans Frank sowie ihre nicht abgestimmten Aktionen führten zur Vernachlässigung der bereits bestehenden Wehranlagen oder deren unsachlichem Ausbau. Die Darstellungen Panzergräben schaufelnder Bevölkerung in den Wochenschauberichten sollte eher Durchhaltewillen demonstrieren, als es der Vorbereitung auf die kommende Schlacht diente. Ausser der „Oderstellung“ aus der Vorkriegszeit im mittleren Verlauf des Flusses (Breslau-Crossen) gab es seit Ende 1944 entlang der Oder zwischen Breslau und Ratibor eine grosse Anzahl von (anonymen) Kampfständen, Bunkern und Anlagen, die vor einem Angriff aus dem Osten schützen sollten. Hochwertige Kampfausrüstung und Waffen waren aber nicht vorhanden, da diese für den Atlantikwall abgegeben worden und somit verloren waren. Mit einer ausreichend ausgebildeten Besetzung würden die Anlagen ihren Zweck möglicherweise erfüllen können, aber das lag wiederum in der Verantwortung der militärischen Führer. Weitere Probleme mit der Kompetenz der Gauleiter ergaben sich vielfach bei der Versorgung oder Beurteilung der Lage und den damit verbundenen Massnahmen der Räumung und Evakuierung der Zivilbevölkerung und der Einsatzplanung der Volkssturm-Verbände. Schlecht ausgebildet, zusammengerufen in nicht winterfester Zivilkleidung oder in alten kaiserlichen Uniformen, schwach ausgerüstet mit unterschiedlichen Beutewaffen, ohne ausreichenden Munitionsbestand, konnten die überwiegend älteren Männer den übermächtigen Gegner nicht aufhalten, wie von den Gauleitern gewünscht. Die Kompetenzen waren nicht klar geregelt und die Volkssturmverbände anfangs nicht der militärischen Führungsorganisation unterstellt. Erst nach und nach erkannte die höchste Parteiführung die Probleme beim Einsatz der Volkssturm-Verbände. Am 26. Januar 1945 erging der Befehl Hitlers, gemischte Kampfgruppen des Volkssturms zusammen mit Truppenteilen des Feldheeres unter einheitlicher Führung zu bilden. Am 10. Februar stellte das Oberkommando der Heeresgruppe Mitte in einer Beurteilung fest, dass sich die selbständigen Volkssturmeinheiten in der HKL wenig bewährt hätten und empfahl „die Eingliederung in Truppenteile des Feldheeres, Einsatz in bekanntem Heimatgelände, in rückwärtigen Stellungen zur Bewachung und Sicherung und zum Stellungsbau sowie den Einsatz ortskundiger kleiner Volkssturmgruppen in Flanken und Rücken des Gegners“.
Eine wesentliche Erscheinung der Kampfhandlungen stellte die Flucht der deutschen Zivilbevölkerung vor der Roten Armee aus den Ostgebieten dar. Der Exodus erfasste ganze Kreise und Flüchtlingstrecks waren allgegenwärtig.
Anders als in Ostpreussen hatte sich der Gauleiter von Niederschlesien Karl Hanke nicht geweigert, eine mögliche (vorübergehende) Evakuierung zu planen. Ein zu frühes Verlassen der bedrohten Heimat durch die Bewohner wurde mit hohen Strafen belegt. Oft wurden die Gefahren der kommenden Kämpfe von den anwesenden Polizei- oder SS-Einheiten verharmlost und der Bevölkerung ein falsches Bild der Lage vermittelt. Die Räumungsbefehle der Partei kamen meist zu spät oder überhaupt nicht, die Flüchtlinge wurden anfangs in kaum 100 km entfernte Kreise transportiert, die nach kurzer Zeit selbst zum Kampfgebiet wurden. Die schlecht organisierten, der Kälte trotzenden und bis zu 16 Kilometer langen Flüchtlingskolonnen in Richtung Sachsen und Tschechien blockierten die Nachschub- und Rückzugswege des Heeres, gerieten teilweise direkt in militärische Auseinandersetzungen oder wurden Opfer gezielter sowjetischer Angriffe. Das OKW lehnte eine vorzeitige Evakuierung generell ab. Noch am 28. Januar 1945 äusserte der Chef des OKW Keitel: „zusätzliche personelle Räumung bedeutet für die Betroffenen nur Preisgabe an Hunger, Kälte und Gefahren“ und „in Schlesien sollte die Räumungsmassnahme über 30 km westlich der Oder unterbleiben“.
Am 30. Januar 1945 wurde der Wehrkreis VIII (Stellvertretender Kommandierender General Rudolf Koch-Erpach) der Heeresgruppe Mitte unterstellt, was das störungsreiche Verhältnis zwischen dem Feldheer und Ersatzheer entspannte. Durch den totalen Kriegseinsatz wurden vom Ersatzheer vom Ende Januar bis Anfang Februar über 93.000 Mann an die gesamte Ostfront überführt. Den improvisierten Verbänden fehlten aber hauptsächlich Fahrzeuge und Artillerie sowie Kampferfahrung. Somit war auch der Wert der teilweise aus magen- oder ohrenkranken Soldaten aufgestellten Einheiten äusserst zweifelhaft.
Pläne der Wehrmachtführung
Am 3. Februar 1945 erkannte die Heeresgruppe Mitte, dass die Rote Armee einen Stoss von Steinau aus in westlicher und südwestlicher Richtung nach Ostsachsen sowie gegen Mährisch-Ostrau plante. Sogar die von Stawka geplanten Ziele waren bekannt und wurden einen Tag vor dem Beginn des Angriffs wie folgt benannt:

„Als Schwerpunkt ist jetzt die 1. ukrain. Front im Raum von Steinau anzusehen; anzunehmen ist die Stossrichtung in den Raum südlich Berlin mit einem Nebenstoss in Richtung Dresden“.
Bereits im Dezember 1944 waren in den Stäben der Heeresgruppe mehrere Planspiele unter Leitung der Generäle Fritz Benicke und Wolf-Dietrich von Xylander durchgeführt worden, die den späteren Verlauf der sowjetischen Winteroffensive gut abbildeten und gleichzeitig die Mängel auf der deutschen Seite hervorhoben. Die sowjetische Operation und deren Verlauf kam also für die deutsche Seite nicht überraschend.
Dem Chef des Generalstabs des Heeres, Generaloberst Heinz Guderian, war schon vor dem Beginn der Winteroffensive bewusst, dass die Ostfront infolge ihrer dünnen Besetzung und der geringen Ausstattung mit Reserven „bei einem russischen Durchbruch wie ein Kartenhaus zusammenfallen würde“. Nachdem das mittel- und oberschlesische Gebiet von der Roten Armee besetzt worden war, schlug Guderian vor, Divisionen aus dem Kurland-Kessel nach Pommern abzuziehen und mit deren Hilfe einen Gegenschlag gegen die 1. Weissrussische Front zu führen (Unternehmen Sonnenwende).
Hitler betrachtete die Ostfront hingegen nicht als den primären Kriegsschauplatz. So wurden nach dem Ende der Ardennenoffensive die von dort abgezogenen letzten kampfkräftigen Panzerverbände der Westfront nicht an die Ostgrenze, sondern nach Ungarn verlegt, um bei der Plattenseeoffensive eingesetzt zu werden. Seine Strategie basierte darauf, die Ostfront mit den dort verfügbaren Kräften und durch den Ausbau der grösseren Orte zu „Festungen“ zu halten. Durchbrüche des Feindes führten dazu, dass die mobilen Einheiten von einem Kampfraum zum anderen geworfen wurden, was zu schnellerer Abkämpfung führte. Die Reserven standen meist zu nah an der HKL, sodass es keinen Freiraum für operative Einsätze gab. Unbewegliche Einheiten wurden vielfach überrollt, weil es an Betriebsstoff mangelte. Die Gefechtsstärke der Truppen war schwach, da ihre Personalstärke und Waffenausrüstung längst nicht mehr den Vorgaben entsprachen. Anstelle von geschlossenen Divisionen existierten oft nur Kampfgruppen. Die oft in Wochenschauen gezeigten modernen Waffen und Panzer waren bei den meisten Wehrmachtverbänden kaum vorhanden. Der Transport der Soldaten fand wieder zu Fuss oder mit Pferdewagen statt, was die Mobilität weiter einschränkte. Der Mangel an Artillerie, Panzerabwehrwaffen und vor allem an Munition musste jeden sowjetischen Vorstoss früher oder später zum Erfolg werden lassen.
Auch in Schlesien reduzierte sich die militärische Taktik zum passiven Halten mit immer wieder von der obersten Führung neu definierten Hauptkampflinien und „Festungen“. Das Ziel war, die sowjetischen Kräfte an solchen zu binden und den Vormarsch zu verlangsamen. Die Bestimmung zu „Festungen“, „Festen Plätzen“ und „Festungsbereichen“ behielt sich der Führer selbst vor.
Die Strategie der Wehrmachtführung, nun ohne volle Handlungsfreiheit, zielte im schlesischen Operationsgebiet wie auch an den anderen Abschnitten der Ostfront nur noch auf das Hinauszögern des sowjetischen Vormarsches ab. Ob die in der Nachkriegszeit oft von höheren Offizieren betonte Rettung der Zivilbevölkerung vor den Übergriffen der Roten Armee hierbei den Ausschlag gab, bleibt fraglich.
Lokale Operationen der Wehrmacht Anfang Februar
Am 5. Februar 1945 wurde von der deutschen Seite noch ein Unternehmen bei Dyhernfurth durchgeführt. Die Stadt Dyhernfurth und die nahegelegene Produktionsstätte für chemische Kampfstoffe waren am 25. Januar in die Hand der Roten Armee gefallen. Eine deutsche Kampfgruppe unter General Sachsenheimer und die Belegschaft der Fabrik drangen in einem Handstreich über die Oder und die Stadt in die Fabrik vor, um die Anlagen zu zerstören. Anschliessend gingen sie auf das linke Oderufer zurück, nachdem die gefährlichen Kampfstoffe einfach in den Fluss abgepumpt worden waren. Die Leichtigkeit, mit der die Aktion durchgeführt werden konnte, führte bei der deutsche Führung zu der falschen Einschätzung, der Feind sei merklich geschwächt. In den nächsten Tagen führten deutsche Einheiten immer wieder die Gegenangriffe gegen die gebildeten Brückenköpfe. Insbesondere die neuaufgestellte 408. Division des Panzerkorps „Grossdeutschland“, die Fallschirm-Panzer-Division 1 Hermann Göring und das XXIV. Panzerkorps griffen mit ihren bereits zerschlagenen Einheiten immer wieder die sowjetischen Kräfte nördlich von Steinau an. Vom 1. bis zum 7. Februar verlor die sowjetische 4. Panzerarmee in diesem Gebiet 42 Kampffahrzeuge. In der Gegend von Grottkau wurden die deutsche 8. Panzer-Division und 45. Volksgrenadier-Division als Keil zwischen der sowjetischen 5. Garde-Armee und 21. Armee eingesetzt.
Im Abschnitt zwischen Beuthen an der Oder und Crossen, also schon im Bereich der 9. Armee der Heeresgruppe Weichsel, führte das, seit der Zerschlagung in Polen im Raum Lissa im Rückzug befindliche, XXXX. Panzerkorps die Abwehrkämpfe. Kurzzeitig kam es am 6. Februar zu einem gefährlichen sowjetischen Stoss über die Oder in Odereck. Mit welchen Mitteln solche Aktionen durchgeführt wurden, beschreibt von Ahlfen:

„Die Kräfte des Korps zum Beseitigen dieser ‚Eiterbeule‘ bestanden nur aus einer 10-cm-Kanone, zwei Beutegeschützen mit wenig Munition und Volkssturm […]. In einem Werk bei Naumburg am Bober fand man Füllpulver für V2-Geschosse, mit dem an anderer Stelle aufgefundene ‚Goliaths‘ […] geladen wurden“.
Am nächsten Tag wurde der Angriff abgewehrt und die letzten Oderbrücken in Odereck, Crossen und Fürstenberg gesprengt.
Verlauf
Die gesamte Operation wird heute in zwei Phasen unterteilt. Den zeitlichen Trennpunkt bildet die Schlacht am Bober, sowie die Änderung der ursprünglichen Operationsziele durch das sowjetische Oberkommando.
- Phase (8. bis 15. Februar): Die sowjetischen Armeen greifen an und erreichen innerhalb einer Woche nur die Linie Bober-Queis.
- Phase (16. bis 24. Februar): Die deutschen Einheiten kommen zum Gegenangriff entlang des Flusses Bober. Das sowjetische Oberkommando ändert die Operationsziele. Die Rote Armee dringt bis zur Lausitzer Neisse vor.
Die Lageentwicklung zwischen dem 8. und 15. Februar
Der Angriff der sowjetischen Kräfte begann am 8. Februar um 6:30 Uhr Ortszeit nach einem verhältnismässig kurzen, 50-minütigen Artilleriefeuer aus den vorbereiteten Brückenköpfen. Für einen längeren Beschuss waren nicht genügend Munitionsvorräte vorhanden. Die ungenügende Aufklärung der deutschen Positionen und Stellungen führte zu einer geringen Wirkung. Wegen des schlechten Wetters war auch die sowjetische Luftunterstützung sehr begrenzt. Die deutschen Einheiten leisteten von Anfang an hartnäckigen Widerstand. In den letzten Tagen vor dem Angriff hatte Tauwetter eingesetzt, obwohl noch zwei Wochen zuvor Temperaturen von bis zu −20 °C geherrscht hatten. Der Wechsel zwischen Frost und Erwärmung bis zu +8 °C begleitete die kommenden Auseinandersetzungen. Durch den aufgeweichten Boden konnten die angreifenden Panzer im Gelände nur langsam vorwärtskommen.
Aus dem Raum Steinau wurde der Angriff halbsternförmig in westlicher Richtung vorgetragen. Bis zum späten Nachmittag konnten die Stellungen noch vom deutschen XXIV. Panzerkorps und dem Panzerkorps „Grossdeutschland“ auf der West-Hauptstosslinie aus dem Brückenkopf Steinau gehalten werden, die aber wachsender Übermacht nachgaben. Der Durchbruch im Norden gelang den Sowjets über das Dorf Raudten. Südlich von Lüben hielt die 408. Division des LVII. Panzerkorps trotz der starken Angriffskräfte weiterhin ihren Abschnitt. Allein bei Brauchitschdorf wurden an diesem Tag 18 sowjetische Panzer von einem Pionierbataillon niedergekämpft, was aber nicht verhinderte, dass dieser Strassenabschnitt verlorenging. Die heftigen Abwehrkämpfe auf dem Boden wurden unterstützt vom Schlachtgeschwader 2 „Immelmann“. Laut dem Lagebericht der Heeresgruppe Mitte erzielte die Gruppe Rudel an diesem Tag 80 Panzerabschüsse. Der Kommandeur Hans-Ulrich Rudel wurde bei einer Notlandung schwer verletzt.
Die Angriffe der sowjetischen 4. Panzerarmee aus dem Brückenkopf Steinau waren taktisch darauf ausgerichtet, die Wälder des Primkenauer Forstes (nordwestlich von Lüben) mit dem 6. Garde-Mechanisierten Korps über die nördliche Flanke und mit dem 10. Garde-Panzerkorps südlich zu umgehen. Nachdem die deutschen Linien durchbrochen waren, stellte sich heraus, dass die deutschen Divisionen „Brandenburg“, „Hermann Göring“ und die 20. Panzer-Division in Gefahr standen, in eine Kesselschlacht zu geraten.
Die Panzerverbände der Hauptgruppierung der Roten Armee drangen in den ersten beiden Tagen aus dem Brückenkopf Steinau in einer Tiefe von 30 bis 60 Kilometer vor, die Infanterie bis zu 15 Kilometer auf einer Breite von 80 Kilometern. Trotz der Geländegewinne wurde aber die Boberlinie nicht wie geplant erreicht und der Vormarsch nicht erweitert. Den langen Schwenk des sowjetischen 10. Garde-Panzerkorps um den Primkenauer Forst nutzten die dort befindlichen deutschen Einheiten sofort aus, um sich nach Westen in Richtung Sprottau gegen die sowjetischen Panzersperren der 63. Panzerbrigade (10. Garde-Pz.K.) auf die bekannte Weise des „Wandernden Kessels“ kämpfend abzusetzen.
Die sowjetischen Panzerspitzen verfolgten die Strategie, bei stärkerem Widerstand die Städte zu umgehen und deren Eroberung den nachrückenden Infanterie-Einheiten zu überlassen. In der Nacht zum 9. Februar rollte das sowjetische 7. Garde-Panzerkorps der 3. Garde-Panzerarmee weiter in Richtung Haynau. Die zwischen Lüben und Liegnitz liegenden deutschen Einheiten der 408. Division und der Panzerbrigade 103 („Mummert“) vom LVII. Panzerkorps wurden von Lüben abgeschnitten und verloren den Kontakt zu den nördlich stehenden Nachbardivisionen. Aus dem Raum um das Dorf Kaltwasser sollten diese Kräfte aber nach Anordnung von Generaloberst Schörner noch am 9. Februar einen riskanten Gegenstoss in Richtung der bereits verlorenen Stadt Lüben führen, um die schnellen Kräfte des Gegners von den Hauptkräften abzuschneiden. Dieses von vornherein fehlgeleitete Unternehmen scheiterte kläglich. Die zerstückelten deutschen Kolonnen der Infanterie, die Panzer und vor allem die Nachschubkolonnen wurden in den Wäldern zwischen Haynau und Kaltwasser zum grossen Teil vom sowjetischen 7. Garde-Panzerkorps und der nachkommenden Infanterie der 52. Armee zerschlagen. Die Reste der deutschen Einheiten setzten sich nach Süden in Richtung Goldberg ab. Der Weg nach Bunzlau war aber somit für das sowjetische 7. Garde-Panzerkorps frei. Inzwischen nutzte nördlich davon die 52. Panzerbrigade (6. Panzerkorps / 3. Panzerarmee) die Gelegenheit zum schnellen Vorstoss in Richtung Westen. Die Städte Kotzenau und Haynau wurden nach Strassenkämpfen am 10. Februar vom sowjetischen 78. Schützenkorps und 9. Mechanisierten Korps besetzt.
Im südlichen Frontabschnitt im Raum südlich von Cosel kam es auch nach zwei Tagen zu keinem Durchbruch durch die deutsche Front. Hierzu erwiesen sich die deutsche 17. Armee und Armeegruppe Heinrici als zu standhaft und die Linie Rybnik-Ratibor konnte von ihnen gehalten werden. Die erfolgten zwei Angriffe wurden von der 8. und der schnell herangeschafften 20. Panzer-Division zurückgeschlagen. Im Raum um Brieg, also im Kampfgebiet der sowjetischen 21. Armee, gab es auch keine Veränderungen im Frontverlauf.
Die Angriffe der 5. Garde-Armee mit der 20., 21. und 22. Garde-Panzerbrigade wurden von der 20. Waffen-Grenadier-Division der SS, der 283. Inf.Div und 20. Panzer-Division östlich der Reichsautobahn abgefangen. Die Truppen der 1. Ukrainischen Front konnten die 4. Ukrainische Front an der Nahtstelle nicht weiter unterstützen, da sie selbst nicht weiter vorankamen. Die 59. und 60. Armee stellten anschliessend am 9. Februar ihre offensiven Tätigkeiten weitgehend ein und bezogen selbst Abwehrstellungen. Das Mährisch-Ostrauer Industriegebiet konnte dadurch bis Ende April 1945 von der Wehrmacht gehalten werden.
Die Einbrüche in die deutschen Linien in den ersten Tagen der Offensive zeichneten die sowjetischen Stossrichtungen vor: Haynau–Bunzlau–Naumburg am Queis auf Görlitz und Goldberg–Löwenberg auf Lauban. Nördlich der Waldungen zeichnete sich die Linie über Primkenau–Sprottau–Sagan–Sorau auf Forst–Sommerfeld ab. Die deutschen Verbände zogen sich hier hinter den Bober zurück. Dagegen erreichten die sowjetischen Angreifer keine grossen Erfolge an den Flügeln des zentralen Vorstosses. Im südlichen Abschnitt zögerte die 6. Armee immer noch auf dem Marsch in Richtung „Festung“ Liegnitz, wo die umkreiste Panzerbrigade 103 den Zugang zu der Stadt vom Norden her und die Reste der 17. Infanterie-Division („Kampfgruppe Sachsenheimer“) den westlich der Stadt blockierte. Auf der sowjetischen Seite kam dem 22. Schützenkorps (6. Armee) am 9. Februar dem 9. Mechanisierten Korps (3. Garde-Panzerarmee) vom Nordwesten her zu Hilfe und das 78. Schützenkorps bewegte sich auf die Stadt zu. Die Reste der deutschen 408. Division mussten aus Liegnitz in westlicher Richtung ausweichen. An diesem Tag wurde Liegnitz ohne grosse Beschädigungen eingenommen. Die sowjetischen motorisierten Einheiten stiessen dann entlang der Autobahn in südöstlicher Richtung weiter vor, um die Verbindung zur 5. Garde-Armee herzustellen. Die Kampfgruppe Sachsenheimer wurde dabei nach Süden und in Richtung Goldberg abgedrängt.
Im nördlichen Abschnitt des sowjetischen Durchbruchs stiess die 3. Garde-Armee (unter General Gordow) auf starke Abwehrstellungen im Raum Glogau. Die Stadt wurde zur Festung erklärt, was in den sowjetischen Eroberungsplänen so nicht berücksichtigt worden war. Marschall Konew beorderte daher die 4. Panzerarmee und zusätzlich das 25. Panzerkorps zur Unterstützung in dieses Gebiet.
Durchweg wurde im Mittelabschnitt am 10. Februar im Nord-Süd-Verlauf die Linie Primkenau-Haynau von der Roten Armee (3. Garde-Panzer- und 52. Armee) erreicht. Am gleichen Tag wurde über Breslau der Kommandant des sowjetischen 6. Bomber-Korps Generalmajor Iwan Polbin durch Flak im Einsatz abgeschossen.
Das deutsche XXIV. Panzerkorps unter General Walther Nehring und das Panzerkorps „Grossdeutschland“ unter Dietrich von Saucken im Norden wichen dem Gegner kämpfend nach Nordwesten aus, während im Süden das LVII. Panzerkorps von mehreren sowjetischen Panzerspitzen aufgespalten worden war. Der massive Schlag des Panzerkorps „Grossdeutschland“ zwischen den Dörfern Weissig und Wolfersdorf am Rande des Primkenauer Forstes gegen die Panzersperren des sowjetischen 10. Garde-Panzerkorps ermöglichte es den restlichen Truppen, sich in den undurchsichtigen Wald abzusetzen und dem Gegner zu entkommen. Noch weiter nördlicher davon erhielt das XXIV. Panzerkorps (16. Panzer-Division, 72., 88. und 342. Infanterie-Division) am 10. Februar den Befehl, weiter in nordwestlicher Richtung auf Freystadt-Naumburg am Bober zurückzuweichen und den sowjetischen Einheiten am Fluss Bober zuvorzukommen. Diese Gelegenheit nutzte das sowjetische 25. selbständige Panzerkorps, um den Ring um Glogau am 12. Februar zu schliessen. Es folgten die andauernden Angriffe der drei sowjetischen Infanteriedivisionen mit Hilfe von Artillerieeinheiten vom Süden her gegen die Stadt, da das Panzerkorps weiter westlich gezogen worden war. Die Belagerung der „Festung“ hatte nun begonnen.
Die schnellen gepanzerten sowjetischen Kräfte der 17. Garde-Mechanisierten Brigade (6. Garde-Mechanisiertes Korps) unter Oberst Leonid Tschurilow drangen am 11. Februar von Primkenau aus in nordwestlicher Richtung vor, umgingen die Stadt Sprottau weit ausholend und überschritten nach 35 Kilometern südlich von Naumburg den Bober über einen Wasserwerkdamm bei Gladisgorpe. Sofort wurde von der Einheit ein Brückenkopf gebildet. Nun war die sowjetische 4. Panzerarmee unter General Leljuschenko die führende Armee der gesamten Front beim Rennen nach Westen. Die Einheiten der 3. Garde-Panzerarmee des Konkurrenten General Pawel S. Rybalko standen zwar am selben Tag am Bober, aber durch den Flussverlauf ca. 20–30 Kilometer weiter östlich. Die offenen Flanken der führenden Panzerarmee führten aber zu einer risikoreichen Lage.
Am 12. Februar nahmen Teile des Panzerkorps „Grossdeutschland“ nach dem Verlassen des Primkenauer Forstes Stellungen östlich von Sprottau ein. Die Division „Brandenburg“ bildete einen Brückenkopf in Ober Leschen und die Division „Hermann Göring“ richtete sich in einem Dreieck zwischen Sprotte und Bober um den dortigen Flugplatz ein. Die Verbindung zu dem nördlich der Sprotte zurückgehenden XXIV. Panzerkorps wurde dadurch wieder hergestellt und der Versuch unternommen, eine Verteidigungslinie schon östlich des Bober aufzubauen. Auch zwei Panzerzüge wurden dabei eingesetzt. Die deutschen Gruppierungen unter General Nehring eilten zwar dem sowjetischen 6. Garde-Mechanisierten Korps nach, wurden aber dabei selbst von nachrückenden Einheiten des sowjetischen 10. Panzerkorps verfolgt. Das Nachsetzen des sowjetischen Korps kostete es nahezu seine 61. Panzerbrigade, als die Kampfgruppen der 25. Panzer-Division über den schmalen Fluss den Gegner beschossen.
Die Stellungen vor Sprottau wurden am 12. Februar aufgegeben, als das sowjetische 102. Schützenkorps (13. Armee) wiederum das nach Süden ausgerichtete XXIV. Panzerkorps östlich umging und die Hinterstellungen bedrohte. Das Panzerkorps „Grossdeutschland“ zog sich dann am 13. Februar unterhalb Sagan zurück. Das XXIV. Panzerkorps von General Nehring hatte den längeren Weg über Neustädel-Freiburg befohlen bekommen und musste dazu den Marschweg nach Naumburg am Bober/Christianstadt freikämpfen. Die zwei benachbarten kleinen Städte am Bober spielten auch später noch eine wichtige Rolle bei der gesamten Operation. Das von Neusalz nachkommende XXXX. Panzerkorps erreichte den Doppelort erst am 13. Februar und zog weiter in nordwestlicher Richtung.
Die Schützen des sowjetischen 48. Schützenkorps (52. Armee) überquerten am 10. Februar den Fluss Bober zwischen Ober Leschen und Bunzlau und drangen in den nächsten Tagen sogar mit Stosstruppen weiter westlich durch das schwierige Waldgelände bis zum Queis vor. Dennoch konnten die Panzereinheiten des Generals Rybalko nicht über den Bober übergesetzt werden, da das geschickte Öffnen der Boberschleusen im oberen Flusslauf durch deutsche Pioniere mehrmals zur Zerstörung der sowjetischen schweren Pontonbrücken und damit zur mehrtägigen Verzögerung des Vorstosses führte.
Obwohl die deutschen Einheiten durch das schnelle Rückzugstempo stark zersplittert wurden, bestand die Absicht, die Abwehrstellung an der Boberübergängen zu halten. Weiterhin hatten die deutschen Einheiten vom „Festungsabschnitt Niederschlesien“ unter General Adolf Bordihn den Abschnitt Sagan-Bunzlau in ihren Händen – am 12. Februar kam zur Verstärkung des Panzerkorps „Grossdeutschland“ noch die 21. Panzer-Division aus dem Raum Küstrin. Der grosse Wald zwischen den zwei Städten wurde zum Fluchtraum für mehrere deutsche Kampfgruppen.
Die zusammen mit Volkssturmeinheiten neu formierte 6. Volksgrenadier-Division wich bogenförmig von Haynau bis nach Bunzlau zurück, immer wieder in die Rückzugskämpfe gegen die nachkommende 53. Garde-Panzerbrigade verwickelt. In der Kreisstadt wurde die Truppe durch die Jagdpanzerabteilung 1183 mit einigen neuen „Hetzer“-Panzern verstärkt. Die mangelnde Koordination mit den Nachbareinheiten (im benachbarten Dorf stand eine intakte Heimat-Flak-Abteilung, ohne in den Kampf einzugreifen) sowie das unerwartete Verlassen der Stellungen nördlich von Bunzlau durch ein Polizei-Bataillon führte dazu, dass die Volksgrenadiere auf verlorenem Posten kämpften. Der sowjetische Durchbruch kam am 12. Februar und führte zur Besetzung der Stadt. Abends wurde dieser Sieg in Moskau mit einer neuen Tradition begrüsst – einem 20-fachen Salutschuss aus 224 Kanonen.
Südlich von Bunzlau setzte am 12. Februar das gesamte 6. Panzerkorps der Roten Armee über den Bober, obwohl die deutsche Luftwaffe ständige Angriffe mit Schlachtfliegern flog. Das Korps bekam nun den Befehl von Konew, die Stadt Görlitz einzunehmen. Nach der Einnahme von Bunzlau schien der Weg für die Eroberer nun frei. Der sowjetische Marschall musste aber die Hauptkräfte der 3. Panzerarmee – das 7. Garde-Panzerkorps und das 9. Mechanisierte Korps – zurückrufen und bei der Offensive südlich von Breslau einsetzen. Dort war gerade von drei Kampfgruppen der Wehrmacht ein erfolgreicher Stoss (von kurzer Dauer) gegen die Festungeinschliessung durchgeführt worden. Der Rückruf von Konews besten Kräften in Richtung Osten unterbrach den Vorstoss nach Görlitz für mehrere Tage. Die im Richtung Lauban vorgehende sowjetische 53. Garde-Panzerbrigade drang zwar am Abend des 13. Februar bis nach Naumburg am Queis vor, wurde aber dort in zweitägige Kämpfe gegen die 6. Volksgrenadier-Division verwickelt. Die Flussüberquerung wurde wieder nach dem gleichen Muster verhindert – durch rechtzeitiges Öffnen der Schleusen im oberen Verlauf.
Die nun vom Westen her angreifenden Teile der sowjetischen 3. Panzerarmee konnten am 13. Februar bis Goldberg und Striegau vordringen. An diesem Tag wurde das nahegelegene KZ Gross-Rosen von der 91. Panzerbrigade (9. Mechanisiertes Korps) befreit. Eine eintägige Verbindung zur Festung Breslau konnte noch am 14. Februar von der deutschen 19. Panzer-Division geöffnet werden. Die von Westen herangekommenen sowjetischen Panzerverbände der 3. Panzerarmee unterstützten aber die bereits von Osten erfolgten Angriffe der 6. Armee (General Glusdowski). Am nächsten Tag, dem 15. Februar, war dann der Ring um die Landeshauptstadt geschlossen, wobei die Schlacht um Breslau noch weiter bis zum 6. Mai andauerte.
Im nordwestlichen Teil von Niederschlesien hatten die deutschen Einheiten das Gebiet zwischen der Oder und dem Bober mehr oder weniger kampflos verlassen müssen, da die Rote Armee bereits auf Sagan vorrückte und eine Umkreisung drohte. Aus den Brückenköpfen am unteren Bober konnten die sowjetischen Einheiten nur über eine schmale, einige Kilometer breite Landbrücke in Richtung Lausitzer Neisse vordringen. Bis Crossen war das linke Boberufer noch nicht vollständig von den Rotarmisten besetzt. Die versprengten Gruppen der Division 463 fanden bei Grünberg wieder Anschluss an deutsche Verbände, nachdem sie vor einem Einfall sowjetischer Truppen bei von Odereck zurückweichen mussten. Die Stadt Grünberg konnte aber mit ihren schwachen Kräften, verstärkt durch Volkssturm-Einheiten, nicht gehalten werden und wurde am 14. Februar von Truppen des sowjetischen 25. Panzerkorps und der 3. Garde-Armee besetzt. Am Abend feierte man in Moskau die Siege des Tages mit einem 20-fachen Salutschuss aus 224 Kanonen.
Obwohl die Rotarmisten bereits mehrere Brückenköpfe auf dem linken Bober-Ufer erkämpft hatten, gab es beim OKW immer noch den Ansatz, entlang der beiden Flüsse Bober und Queis die HKL wiederherzustellen. Die Chancen dazu waren Mitte Februar gross. Südlich von Sagan standen am westlichen Bober-Ufer die Panzerkorps XXIV. und Grossdeutschland. Das sowjetische 10. Panzerkorps (Oberst Nil Tschuprow) setzte am 12. Februar etwas nördlich der Stadt Sagan bei dem Wasserkraftwerk in Greisitz über den Bober, musste aber warten bis das 6. Mechanisierte Korps eigene Stellungen um Naumburg am Bober ausgebaut hatte. Dort wurde die Abwehr von Teilen der deutschen Brigade z. b. V. 100 unter Oberst Lothar Berger und der Polizeibrigade Wirth geführt.
Die Schlacht am Bober
Die Schlacht zwischen den vorrückenden sowjetischen und den nachkommenden deutschen Einheiten fand im unteren Verlauf der Flüsse Bober und Neisse in den Tagen vom 13. Februar bis 20. Februar 1945 statt. Diese Definition findet man meist in der polnischen militärischen Literatur.
Bei einem koordinierten Gegenangriff hatten die deutschen Truppen kurzzeitig die HKL von Naumburg/Christianstadt am Bober entlang bis Sagan wiederherstellen können und die Verbindung der sowjetischen Hauptkräfte zu den Einheiten westlich vom Bober verhindert.
Der detaillierte Verlauf der Kämpfe und die teilnehmenden deutschen Truppen sind aufgrund der Vermischung von improvisierten und zusammengestellten Einheiten heute schwer nachvollziehbar. Auch die kämpfenden Einheiten wurden in diesen Tagen per Befehl umbenannt oder neu unterstellt: am 15. Februar die Polizeibrigade Wirth in 35. SS-Polizei-Grenadier-Division und am 14. Februar die „Brigade Dirlewanger“ in 36. Waffen-Grenadier-Division der SS. Viele Gefechte wurden nachts durchgeführt und hatten Ablenkungscharakter für die operativen Aktionen. Die sowjetischen und deutschen Truppen waren oft ineinander vermischt. Da die deutschen Kommandanten auf Regiments- oder Bataillonsebene befehlsmässig frei handelten, sind auch die Unternehmen wenig dokumentiert. Das Kampfgebiet befand sich überwiegend in den Kiefer-Waldgebieten, die Tarnung aber auch die Möglichkeit für Überraschungsangriffe für beide Seiten boten. Die Panzereinheiten konnten nur auf den befestigten Wegen rollen, da der Boden abgetaut war. Die Luftkräfte der beiden Seiten hatten ihre Einsätze verstärkt. Die deutsche Luftwaffe flog in diesem Zeitraum bis zu 700 Einsätze täglich, da nun festgelegt war, „dass der Schwerpunkt im Osten liegt; dementsprechend erfolgt[e] die Benzinzuteilung“. Der Nachfolger von Hans-Ulrich Rudel als Kommandant des SG 2 Immelmann, Friedrich Lang, wurde hier bei einem Einsatz ebenfalls verwundet.
Am 13. Februar morgens führten die beiden sowjetischen Durchbruchseinheiten der 4. Pz. Armee (10. Pz.K. und 6. Gde.-Mech.K) aus ihren Stellungen bei Naumburg/Christianstadt den Angriff durch. Als die Polizeibrigade Wirth ihre Stellungen Richtung Sommerfeld unerwartet verlassen hatte, brach das sowjetische 6. Mech.K. aus dem Brückenkopf aus. Über das Dorf Benau, einen lokalen Bahnknotenpunkt, gingen die Rotarmisten entlang der Bahnlinie in Richtung Neisse vor und standen nachts bei Sommerfeld. Etwas südlich verlief parallel der Angriff des 10. Pz.Korps auf Sorau zu. Dort wurde bereits am Abend des 13. Februar ein Einbruch in den Garnisons- und Eisenbahnknotenpunkt vom Norden her erzielt. Da sich in dem Raum noch ca. 3500 Waggons Kohle befanden, wurde die Wichtigkeit der Verteidigung vom OKW im Lagebuch vom 13. Februar 1945 unterstrichen.
Nachdem die sowjetische 4. Pz.Armee den Bober überquert hatte, hatte nun auch das von Neusalz nachfolgende deutsche XXIV Pz.Korps den Fluss in Naumburg/Christianstadt überschritten, am 13. Februar abends die Stellungen um die kleine Stadt eingenommen und die HKL wiederhergestellt. Die Stadt Sagan wurde weiterhin von den Einheiten des Volksturms (Leutnant. Archer) gegen vom Norden her durch sowjetische Truppen der 117 Inf.Div. (Gen. E. Koberidse) vorgetragene Angriffe gehalten.
In den Morgenstunden des 14. Februars 1945 rückte das sowjetische 6. Mech.K. unter Oberst Wasyl Orlow in die Stadt Sommerfeld ein. Die Truppen gingen im Raum zwischen Forst und Guben vor. Auf dem linken Flügel der 4. Pz. A blieb die 61. Pz.Brig. in Sorau und ein kleiner Stosstrupp zog in Richtung Neisse los. Südlich und in der Stadt operierten noch die Einheiten der K.Gr. „GD“ und Strassenkämpfe begannen. An diesem Tag nahmen die heftigen Kämpfe am Bober weiter zu. Die Truppen der sowjetischen 13. Armee wurden gleichzeitig von der Luftwaffe und vom XXIV Pz.K. an der Flussüberquerung gehindert. Dem sowjetischen 102. Inf. Korps gelang aber der Übergang über den Bober bis an die Bahnlinie Benau–Sorau (abgeriegelt durch Volksturmbataillon 331 Sagan-Land und einen Panzerzug). Die sowjetische 121. Inf Div brach aus Benau aus, um sich den schnellen mechanisierten Kräften westlich Sommerfeld anzuschliessen, setzte sich aber bei den Kämpfen um die Kleinstadt Gassen fest. Es kam zu einer Situation, die typisch für die Kämpfe dieser Tage war: die sowjetischen Panzerspitzen hatten zwar die Verteidigungslinie durchbrochen und waren weiter bis zu 45 km westlich vorgerückt, allerdings ohne auf die nachrückende Infanterie zu achten. Zwar überrollten sie die deutschen Einheiten, andererseits war die Verbindung zu den eigenen Hauptkräften gerissen und sie sassen in dem Waldgelände fest. Die Angriffe der deutschen Schlachtflieger im Vorfeld zur Neisse, sowie starke Abwehr im Raum Forst–Triebel–Teuplitz, erlaubte keine schnelle Überquerung des Flusses durch die Sturmeinheiten der sowjetischen 4. Pz. Armee und des 10. Pz.Korps. Schliesslich nahmen beide Gruppierungen Verteidigungsstellungen ein.
Die deutsche 4. Panzerarmee unter General Fritz-Hubert Gräser fasste noch am 14. Februar den Plan, mit Hilfe des zwischen Neisse und Bober stehenden XXXX. Pz.Korps (25. Pz.Div) zusammen mit XXIV. Pz.K. (mit den Kampfgruppen 16. Pz.Div., 72, 88 und 342. Inf.Div.) vom Norden und mit den K.Gr. „GD“ und 20. Pz.Div. vom Süden her und entlang des westlichen Bober-Ufers, die sowjetischen Durchbruchskräfte restlos abzuschneiden und den Bober-Brückenkopf zu beseitigen. Die Truppen in der Stärke von zwei Regimenten mit 35 Panzer- und Sturmgeschützen führten den Gegenangriff auf Benau, wo der Stab der sowjetischen 4. Pz. Armee (Generaloberst Dmitri Leljuschenko) sass und nur von Teilen des sowjetischen 102. Inf. Korps (207 Reg.) gehalten wurde. Südlich verlaufende Gegenangriffe mit Hilfe von Resten der deutschen K.Gr. „GD“ und 20. Panzer-Grenadier-Division (unter Major Schrapkowski) über die Strasse Sorau–Sagan in Richtung Benau hatten ebenfalls Erfolg. Obwohl die beiden deutschen Stosstruppen bis auf eine 3 km breite Lücke nicht zusammenkamen, wurden die sowjetischen Einheiten westlich vom Bober abgeriegelt. Am Abend wurden die sowjetischen Truppen um Benau durch die 17. Garde-Mech.Brig und 93. Pz.Brig. aus den rückwärtigen Reserven verstärkt. Die Kämpfe dauerten dann über die Nacht an, ein Teil des Dorfes kam wieder in deutsche Hände. Ungeachtet dessen hatte die vor der Neisse stehende sowjetische 49. Mech.Brig in der Nacht zum 15. Februar bei Gross Gastrose (in der Nähe der Mühlenwerke) den Fluss überschritten und einen kleinen Brückenkopf gebildet.
Am 15. Februar morgens wurden die deutschen Gegenangriffe auf die Stadt Sorau aus drei Richtungen durchgeführt. Vom Norden stiess laut sowjetischen Quellen die SS-Polizeibrigade Wirth vor. Vom Südosten kam die K.Gr. „Zimmermann“ (die Reste der „GD“) unterstützt von Panzerwagen sowie die KGr. unter Major Michael (aus der Resten der 16. PD – I./Pz.Gr.Regt. 64) vom Süden her. Die Strassenkämpfe gegen die in Sorau verbliebene sowjetische 62 Pz.Brig. und das 726 Inf.Reg. (121. Inf.Div.) nahmen an Härte zu. Die Bedingungen der improvisierten Kämpfe in Raum Sorau beschrieb Wolfgang Werthen in der „Geschichte der 16. Panzer-Division“:
„[…] Die Lage war völlig ungeklärt, die Kommandantur in Sorau hilflos. […] Als Sorau von Russen angegriffen wurde, übernahm er [Mjr. Michael] die Führung mehrerer Volkssturmbataillone. Sie bestanden vorwiegend aus alten Weltkriegsteilnehmern, die nur mit veralteten Gewehren ausgerüstet waren. […] Dennoch gelang es den Russen, den Bahnhof von Sorau zu erobern. Ein deutscher Stosstrupp jedoch verjagte den sich zäh verteidigenden Gegner wieder und eroberte einen eigenen Waffentransport zurück. Der Volkssturm konnte mit neuen Karabinern und einigen MG ausgerüstet werden.
Rücksichtslos vereinnahmte Major Michael alle im Raume Sorau aufkreuzenden Einheiten. […] Sie setzte[n] dem Russen in harten Häuserkämpfen einen zähen Widerstand entgegen. […] Im Raume Hansdorf südlich Sorau, stiessen Nachersatz, fliegendes Personal der Luftwaffe, Marineartilleristen und Offiziere der Kraftfahrtruppe zur Kampfgruppe. Auf einer Eisenbahnstrecke entdeckten die Männer neue Sturmgeschütze mit noch nicht justierten Rohren; an der Strasse Sagan-Sorau fanden sich Nachrichtengeräte, Kraftfahrzeuge und Ersatzteile. Die notdürftig ausgerüstete und zusammengefügte Kampfgruppe trat am 18.II. [Februar] zusammen mit einer Fallschirmjägereinheit [‚HG‘] und einer ‚Hetzer‘-Abteilung […] an der Strasse Sorau–Sagan zum Angriff an“.
Auch der Gegenangriff gegen Benau wurde am 15. Februar zusätzlich mit Hilfe der nördlich von Sommerfeld stehenden deutschen 25. Panzer-Division und der aus Guben angerückten „Brigade Dirlewanger“ fortgesetzt. Die Einheiten stiessen an diesem Tag gegen das Dorf vor und besetzten es vollständig. Das SS-Sturmregiment 2 der „Dirlewanger“ eroberte gleichzeitig Sommerfeld am 16. Februar zurück. Somit wurden die sowjetischen Kräfte in Sorau (61. Pz.Brig. und 726 Inf.Reg.), Gassen (Teile von 121. Inf.Div) eingekesselt; westlich Sommerfeld das 49. Mech.Brig. mit dem Flakregiment 2003 und westlich Sorau die Teile der 62. Pz.Brig. von den Hauptkräften abgeschnitten. Die Stadt Sagan konnte von der deutschen Garnison noch an dem Tag behauptet werden. Die deutschen Truppen sicherten das Dorf Benau gegen die angreifenden Sowjets ab und sind stiessen weiter südlich in das benachbarte Dorf Reinswalde (Złotnik) vor, wo es vom sowjetischen 207 Flak-Reg. zäh verteidigt wurde. Weil die Boberübergänge für die sowjetischen 93., 63. Pz.Brig, 17. Garde-Mech.Brig, 68. Flak-Div. und 22. Selbstfahr-Art.Brig. (beide Kommandanten Oberst Aleksandr Koslow und Wasili Prichodko fielen bei den Kämpfen) weiterhin abgeriegelt waren, erkannte nun auch Marschall Konew die bedrohliche Lage. Um den Brückenkopf zu halten, griff der sowjetische Marschall am 16. Februar 1945 morgens auf die Reserven zu und rief gleichzeitig das an der Neisse stehende 6. Gde.-Mech.K. partiell zurück. Die sowjetischen 28. Gde.-Pz.Sturm-Reg., je ein Regiment der 112 Inf.Div und 49. Mech.Brig. sollten über den Raum Sommerfeld, die 61. Pz.Brig. über Raum Sorau vom Westen und gleichzeitig die 93. Pz.Brig. mit 280 Inf.Div den Abschnitt Benau–Reinswalde vom Osten her erobern. Die sowjetische 121. Inf.Div vom Westen her und die 6. Gde-Inf.Div (27. Korps) stiessen gegen den Sorauer Belagerungsring vor und besetzten die Stadt erneut. In und um die Stadt (Produktionsstätte von Focke-Wulff) wurden ca. 200 Flugzeuge erobert.
Die kritische Lage der sowjetischen Truppen entlang des Bobers verschärfte sich weiter am 17. Februar. Die Verbände des 6. Gde.-Mech.K. wurden von Sommerfeld aus angegriffen und kamen nicht weiter. Die sowjetischen Attacken von Osten her auf Benau und Reinswalde konnten von den deutschen Truppen der KGr „Dirlewanger“ und der 25. PD abgefangen werden. Des Weiteren wurden die sowjetischen Soldaten des 27. Inf.K und 61 Pz.Brig. nördlich von Sorau bei Wellersdorf von der deutschen KGr „GD“ angegriffen. Der Kommandant der 4. Pz.A Gen. Leljuschenko bat abends sogar die Front-Kommandos, alle seine an der Neisse stehenden Kräfte zurückzurufen, bekam aber von Konew keine Billigung, da der Marschall gerade neue Angriffspläne erstellt hatte. Die schweren und auf beiden Seiten verlustreichen Kämpfe am Bober dauerten auch am 18. Februar weiter an, und es kam zur Wende. Die vor Sorau kämpfende sowjetische 61. Pz.Brig. und die Teile des von der Neisse kommenden 6. Gde.-Mech.K. hatten sich nun vereinigt und gemeinsam am Abend den westlichen Rand von Benau erreicht. Ebenfalls am 18. Februar 1945 überschritt das sowjetische 25.Pz.Korps den Bober nördlich von Christianstadt. Dort drückten sie auf dem rechten Flügel des XXXX Pz.K. gegen die Brigade z.b.V. 100 und gemischte Einheiten der Infanterie-Division Matterstock die sich wiederum entlang der Strasse nach Guben zurückzogen. Die Stadt Crossen ging an die sowjetische 25.Pz.K. und 21. K verloren. Dies führte zu einer drohenden Umkreisung des XXIV. Pz.K. im Raum Sommerfeld-Naumburg vom Norden her. Auch südlich von Sagan kam es zu sowjetischen Durchbrüchen bis an die Halbau und zur drohenden Umkreisung von K.Gr. „GD“.
Am 19. Februar nachmittags, unterstützt durch Bomber und die 22. Selbstfahr-Art.Brig. eroberten die Rotarmisten das Dorf Benau. Damit hatte sich die Lage der deutschen Truppen erheblich verschlechtert. Die dauerhafte Vereinigung beim Stoss von Norden und Süden entlang des Bobers wurde damit vereitelt. Daraufhin erteilte der Kommandant der 4. Armee (AOK 4) General Fritz Gräser am 19. Februar 1945 den Befehl, die Gegenangriffe am Bober zu stoppen und sich hinter die Neisse zurückzuziehen. Die Brigade „Dirlewanger“ ging direkt nach Guben, da der Gegner bereits die Stadt erreicht hatte und die Kämpfe nahmen dort zu. Das deutsche 24. Pz.K. unter Gen. Walter Nehring ging vom Bober weg als letzte Truppe in Richtung Sommerfeld und erreichte den Brückenkopf des XXXX Pz.K. in der Nacht auf den 21. Februar südlich von Guben. Ein Angriff zuvor gegen den sowjetischen Brückenkopf um Gastrose schlug fehl. Die Kampfgruppe 16. Pz.Div. ging nach Bad Muskau über die Neisse. Die Kämpfe der zurückziehenden Resteinheiten zwischen Bober und Neisse dauerten jedoch noch einige Tage an.
Änderung der Operationsziele durch das sowjetische Oberkommando
Nach einer Woche der Operationszeit kam Konew zu der Einsicht, dass die verlustreichen Kämpfe gegen die deutschen Truppen der Heeresgruppe Mitte nicht planmässig verliefen und die vorgegebene Ziele nicht erreicht wurden. Insbesondere die Flügeltruppen der 1. Ukrainischen Front kamen nicht vorwärts und wenn, dann mit grossen Opfern verbunden. Die Belagerungen der zwei Festungen Glogau und Breslau banden noch dazu drei Armeen (5. Gde, 6., 21.). Auch der deutsche Gegenangriff am Bober brachte das gesamte Unternehmen ins Wanken. Marschall Konew erfasste selbst später in seinem Buch:

„Leider hat unsere 13. Armee, die sich ihr öffnenden Möglichkeiten nicht verwendet und hat sich an die Panzersoldaten nicht gerichtet. In diesem Fall ungenügend energisch, dass man mit der äussersten Müdigkeit der Belegschaft erklären kann, ist die Armee bis zur Neisse nicht angekommen. Und den Deutschen gelang es, die durchgebrochene Front hinter der Armee Leljuschenko zu schliessen. Die Kämpfe der Infanterie haben hier den langwierigen Charakter angenommen und die Verbindung zu den Panzersoldaten für einige Tage abgebrochen“.
Bei der Planung der Operation wurden mehrere Faktoren anscheinend nicht berücksichtigt: das umkämpfte Gebiet mit vielen dicht bebauten Ortschaften, Wäldern, Kanälen und Flüssen verlangsamte den Vormarsch des 1. Ukrainischen Front. Auch die Witterungsbedingungen, die Versorgungslage, der abgekämpfte Zustand der Einheiten und die nicht zu übersehende nachlassende Disziplin der Rotarmisten (Plünderungen, Alkoholexzesse) führten zur Verfehlung der Ziele. Vor allem hatte man das deutsche Oberkommando unterschätzt, wenn es um „die Fähigkeit zur Wiederherstellung der Kampffähigkeit der zerschlagenen Einheiten und Verbände“ ging.
Am 16. Februar übermittelte Marschall Konew die Plankorrektur an Stawka. Nun sollten unter ihm stehende restliche Einheiten nur bis zur Neisse kommen, den Raum Görlitz erobern, das Gelände von den deutschen Verbänden bereinigen, am Fluss die Verteidigungsstellungen nehmen, im Hinterland die belagerten Festungen Breslau und Glogau erobern und auf dem linken Flügel bis zu den Sudeten vormarschieren.
Für das sowjetische Oberkommando in Moskau entwickelte sich der laufende Angriff an der Ostfront nicht zufriedenstellend. Die 1. Ukrainische Front blieb viel weiter hinten im Osten, was auch den Vormarsch der 1. Weissrussischen Front gefährdete. Die in der Slowakei operierende 4. Ukrainische Front hatte in dem Zeitraum keine grossen Erfolge erzielt und war über die Karpaten nicht hinausgekommen. Das Vorfeld bis zu den Sudeten war noch in deutscher Hand. Konews Truppen mussten die lange Front südlich der Autobahn Breslau-Berlin bilden und Verteidigungsstellungen einnehmen. Am 17. Februar stimmte das sowjetische Oberkommando der Änderung zu. Gleichzeitig wurde Marschall Schukow der Auftrag zum Anhalten der 1. Weissrussischen Front an der unteren Oder von Fürstenberg bis Stettin erteilt.
Die Lageentwicklung zwischen dem 16. und 24. Februar
Südlich von Sagan verlief die Frontlinie am 16. Februar an der Queis entlang bis nach Bunzlau. Die Abschnitte wurden verteidigt von den Kampfgruppen Pz.K. „GD“, der 21. Pz.D und der 6. VGD.
Nach der erneuten Eroberung von Sorau am 16. Februar war die Gefahr für die linke Flanke der sowjetischen 4. Pz.Armee noch nicht vorbei, da sie noch von deutschen Kräften bedroht war. Einen Teil seiner verfügbaren Panzerkräfte musste General Leljuschenko an die 13. Armee abgeben und umgruppieren. Der Angriff gegen die südlich von Sorau bis Halbau entlang der Bahnlinie stehende Gruppe des deutschen Pz-K. „GD“ musste aber wegen fehlender Artilleriemunition um zwei Tage verschoben werden und begann erst am 19. Februar. In dieser Zeit hatte General von Saucken die sowjetischen Absichten erkannt und die Stellungen verlegt, sodass diese einen Halbkreis von westlich von Sorau bis Priebus bildeten. Die deutschen Einheiten hatten aber mittlerweile den Befehl bekommen, hinter die Neisse zu gehen, sodass die Umgruppierung die Vorbereitung für das Ausweichen des Korps „GD“ wurde. Der wirkungslose sowjetische Artillerieschlag und die Sperrung der Rückzugswege durch deutsche Nachhuteinheiten führten zu sehr hohen Verlusten bei der sowjetischen 4. Panzerarmee von General Lejuschenko. Seine Truppen kamen am 21. Februar südlich von Forst an die Neisse heran, und die Verbindung zu den abgeschnittenen Einheiten wurde wiederhergestellt. Der Brückenkopf bei Gastrose sowie andere kleinere wurden später im März 1945 von den deutschen Truppen beseitigt. Ein weiter Vorstoss über den Fluss war zu diesem Zeitpunkt für Konew undenkbar. Im Allgemeinen waren seine Einheiten sehr abgekämpft und am Ende ihrer Kräfte.[66] Die Übermacht gegen die deutschen Truppen konnte aber weiterhin gehalten werden. So hatte beispielsweise das XXXX. Pz.K. bei Guben zu dieser Zeit keine verfügbaren Panzer mehr. Die hinzugekommene Kampfgruppe XXIV. Pz.K. von Gen. Nehring war seit Mitte Januar ununterbrochen in Rückzugskämpfe verwickelt und hatte gerade den Anschluss an die Truppen hinter der Neisse über den Brückenkopf gefunden.
Die heftigen Kämpfe um die Stadt Guben begannen am 18. Februar 1945. In die Stadt hatten sich die versprengten Einheiten des Infanterie-Division Matterstock (XXXX Pz.K.) zurückgezogen. Auch die Brigade „Dirlewanger“ nach dem Rückzug aus Benau und die Brigade z.b.V. 100 aus Bobersberg nahmen an der Verteidigung der „Festung“ teil. Der Stadtteil auf dem östlichen Ufer der Neisse wurde bei den schweren und bis zum 1. März andauernden Strassenkämpfen zu 80 % zerstört. Im Waldgebiet kämpfte die rechte Flanke der sowjetischen 52. Armee (48 Inf.K.) gegen die deutsche 21. Pz. Div, die sich immer noch in Zufuhr befand. Ab 17. Februar erhielt die Division aber von der H.Gr. Mitte den Befehl, sich hinter die Neisse abzusetzen und dort die neue HKL aufzubauen. Somit wurde die Queis-Linie im mittleren Abschnitt vom deutschen Oberkommando aufgegeben. Der Rückzug der Division wurde anschliessend am 20. Februar im Raum Rothenburg/Oberlausitz beendet. Im Zentrum der 1. Ukrainischen Front erreichten die sowjetischen Infanterie-Einheiten 78. Inf.K am 21. Februar die Neisse. Am 23. Februar zogen die Hauptkräfte der 52. Armee bis Plensk nach und besetzten die Stellungen am östlichen Flussufer.
Angriff gegen Lauban und Görlitz
Die gut motorisierten sowjetischen Einheiten der 9. Mech.K. und 7. Pz.K. kehrten am 16. Februar aus dem Raum Breslau zurück und setzten die Angriffe mit dem Ziel Görlitz nach dreitägiger Unterbrechung fort. Der Plan sah vor, mit dem 6. Pz.K. von nordöstlicher Richtung und mit dem 7. Pz.K. von östlicher Richtung anzugreifen. Das erste Korps hatte noch grosse Chancen, den Plan auszuführen, da die Einheiten gerade die Queis überschritten hatten und ca. 30 km von der Stadt entfernt lagen. Das zweite Panzer-Korps mit der Mech.-Brigade sollte noch auf dem Weg die Kreisstadt Lauban erobern. Noch am 17. Februar hatte ein anfangs erfolgreicher Gegenstoss der deutschen 6. PVGD zusammen mit den Teilen der 17. Pz.Div. die Rotarmisten vom 6. Pz.K. auf der Reichsstrasse nach Görlitz angehalten. Nun wurden die deutschen Panzereinheiten am Abend plötzlich vom Armeekommando nach Görlitz zurückgerufen. Am nächsten Tag hatte sich die alleingebliebene 6. PVGD aus dem Naumburg zurückgezogen, aber zusammen mit dem Panzergrenadier-Regiment 40 (17. Pz. Div) unter Major Friedrich Ferdinand Prinz zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg durch einen gewagten Gegenangriff die Reichsstrasse nach Görlitz abgeriegelt. Durch die fehlende Kommunikation mit dem Rest der 17. Pz.Div. wurde die Chance verpasst, das zögerliche sowjetische 6. Gde-Pz.K. zurückzuwerfen. Im gesamten Zeitraum der Kämpfe war es sehr schwer, ohne funktionierende Kommunikation den Überblick über die Truppenbewegungen und Ortbesetzungen zu behalten. Wie schon von Anfang der Operation an, wurde die Lage oft über das öffentliche Post-Telefonnetz abgefragt oder die Befehle weitergegeben, was aber von den sowjetischen Nachrichtendiensten abgehört wurde. Am 19. Februar ging Kohlfurt verloren.
Durch das wechselhafte Wetter waren die Felder jenseits der befestigten Strassen für die Panzer unpassierbar. Die handelnden Seiten konnten in der Zeit also keine umkreisenden Operationen durchführen. Die Rotarmisten konnten auch keinen der so beliebten Frontalangriffe erfolgreich durchsetzen, da mittlerweile die Mittel knapp wurden. Wie General Dragunski in seiner Memoiren über die Strassen in Niederschlesien schrieb:

„Wir bewegten uns auf der deutschen Erde, die Unbefahrbarkeit überwindend. ‚Ist das aber Dreck — schlimmer als bei uns!‘ Die Stimme von [Adjutanten] Pjotr Koschemjakow hat mich aus den tiefen Gedanken herausgerissen. ‚Ich dachte, wir werden nach Berlin auf den Asphaltstrassen rollen‘. Pjotr hat absolut recht. Kaum wirst du vom Wege abbiegen — sofort wirst du in den klebrigen Schlamm geraten. Mir kamen eben die ersten zwei Jahre des Krieges in Erinnerung, als die Faschisten versucht haben, ihre Misserfolge bei Moskau und Stalingrad zu rechtfertigen […], wie der General ‚Winter‘, der General ‚Dreck‘ und fehlende Wege als die grössten Verbündeten den Russen helfen. […] Mit Mühe, Kilometer für Kilometer durchkommend, bewegten wir uns vorwärts“.
Das sowjetische 7. Pz.Korps rückte mit der 23. und 56 Inf. Brig. am 17. Februar an die östlichen Stadtteile von Lauban vor. Die sowjetische Artillerie sowie die Luftwaffe fingen mit dem Beschuss der Stadt an, was zu Zerstörungen und Bränden führte. Der letzte Flüchtlingszug hatte an diesem Tag die Stadt verlassen. Die mit dem Volkssturm operierenden HJ-Gruppen (ca. 40 meist 16-jährige) wurden von der Kommandantur in westlich gelegene Dörfer evakuiert, da sie an den direkten Kämpfen per Befehl nicht teilnehmen durften. In Lauban hatte nun ein über zweiwöchiger Kampf um die Stadt begonnen. Die zähen Strassenkämpfe mit der Beteiligung von Panzern, Artillerie und Luftwaffe beider Seiten führten zu weitgehenden Zerstörungen. Die sowjetischen Einheiten kontrollierten nun die durch die Stadt verlaufende Bahnlinie Görlitz-Greiffenberg-Troppau und hatten damit die Versorgungswege nach Oberschlesien unterbrochen.
In der nachfolgenden Nacht auf den 18. Februar wurde die deutsche 8. Pz.Div. mit Bahntransport aus dem Raum Jauer-Striegau nach Greiffenberg herangeschafft und die Truppen erheblich verstärkt, was zur grossen Überraschung für die sowjetischen Kommandanten wurde. Die sowjetischen Nachrichtendienste hatten nicht erkannt, dass südöstlich von Lauban bis an Löwenberg die deutsche 17. Pz.D und später die 8. Pz.D zusammenkamen, sowie die 408. Inf.D, die zwischen den beiden sowjetischen Verbänden der 3. Gde-Pz.A aus dem Raum Liegnitz zurückgezogen worden war. Anstatt in einer Stossrichtung anzusetzen, verteilte General Rybalko seine beiden Panzer-Korps auf breiter Front. Für die Korrektur des Fehlers war es schon zu spät. Das sowjetische 7. Pz.K. hatte sich zu der Zeit in die Kämpfe östlich von Lauban gegen die deutschen Angriffe vom Süden her verwickelt. Von der Bedrohung der 3. Gde-Pz.A erfuhr auch die Stawka (also Stalin), und Konew wurde zur Rede gestellt, was der Marschall selbst in seinem Buch vermerkte:

„An dem Tag, als die faschistischen Teile begonnen haben, auf die Hinterstellungen der 3. Panzerarmee hinauszugehen, hat mich Stalin angerufen und sein Besorgnis geäussert: ‚Was passiert da bei euch mit der 3. Panzerarmee? Wo befindet sie sich?‘ Ich habe geantwortet, dass die Armee von Rybalko sehr anstrengende Kämpfe bei Lauban führt und ich meine, dass nichts Eigenartiges mit ihr geschehen ist. Die Armee kämpft in der komplizierten Lage, aber für die Panzertruppen ist die Sache gewohnheitsmässig“.
Nun versuchte Konew noch, durch die Umgruppierung von 6. Pz.K. wiederum das 7. Pz.K. mit der 51., 53. Pz.Brig, 16. Selbstfahr-Art.Brig und 57. Pz.Reg zu unterstützen. Die nachfolgenden Angriffe am 23. und 27. Februar brachten aber keine Entscheidung, da sie von den lokalen Gegenstössen der deutschen Einheiten vereitelt wurden.
Lage in der Festung Glogau und Festung Breslau
Zwei zu „Festungen“ erklärte Städte wurden nun seit Mitte Februar von der 1. Ukrainischen Front belagert. Breslau war mit über 45.000 Verteidigern aus dem Feld- und Ersatzheer mit 200 Geschützen, 7 Panzern, 8 Sturmgeschützen und ca. 80.000 Zivilisten eingeschlossen. Unter dem Kommandanten Generalmajor Hans von Ahlfen standen die Reste der 609. und 269. Inf.Div. sowie Luftwaffe, Waffen-SS, Polizei und Volksturm-Einheiten. Gegen die 60 km lange Befestigungslinie um die Stadt kamen nun die Hauptangriffe der sowjetischen 6. Armee – mit 294. Inf.Div., 74. Inf.K und 22. Inf K., insgesamt in der Zeit ca. 50.000 Rotarmisten. Bis Ende Februar konnten die Angreifer in zähen Strassen- und Häuserkämpfen von Süden her nur 2 km Frontlinie gewinnen. Oft werden in der Literatur die drei Monate andauernden gesamten Kämpfe um die Stadt mit denen in Stalingrad verglichen.
Die Stadt Glogau wurde am 11. Februar mit ca. 9.000 Verteidigern unter Oberst Jonas Graf zu Eulenburg (ab 12. Februar) und etwa 2.000 verbliebenen Zivilisten eingeschlossen. Von Beginn an wurde die Stadt hauptsächlich durch Artilleriebeschuss und die Luftstreitkräfte der 2. Luftarmee in Brand gesetzt und zunehmend zerstört. Die sowjetische 329. Inf.Div. (3. Gde-Armee) unter Oberst Fiodor Abaschew war anfangs nicht stark genug (und ohne Panzerunterstützung), um eine schnelle Erstürmung durchzuführen. Ab 21. Februar liess der Beschuss nach, da die Munition knapp wurde. Von deutscher Seite kam Versorgung der Verteidiger aus der Luft in begrenztem Masse. Durch den fortschreitenden Rückzug der Wehrmachteinheiten hinter den Bober und schliesslich die Neisse wurden keine Durchbruchversuche zur Festung Glogau unternommen und somit die Besatzung ihrem Schicksal überlassen. Die sowjetischen Belagerungskräfte erhielten erst später nach dem Beenden der gesamten Operation Unterstützung durch Artillerie und Panzer.
Sowjetischer Angriff auf den Sudetenwall
Nach der Einschliessung Breslaus Mitte Februar wurde das sowjetische 32. Korps (3. Gde-A.) abgezogen und gegen die deutsche Abwehr der Linie Löwenberg-Goldberg-Jauer-Striegau eingesetzt. Dabei unterstützte das Korps bereits eingesetzte Einheiten der 5. Gde-A. und der 21. A beim Vormarsch in Richtung Sudeten. In Richtung Schweidnitz kamen die Kräfte des 4. Pz.K. und 31. Pz.K. in das Kampfgeschehen hinein. Auf deutscher Seite bei Strehlen standen zur Abwehr die Kampfgruppen der 254., 269. Inf.Div sowie 19. Pz.Div, 20. Pz.Div. und die 100. Leichte Inf.Div. bereit. In diesem Bereich drangen die Rotarmisten bis zum 24. Februar nur 8 km nach Süden vor und blieben bei Schweidnitz stehen. Marschall Konew hatte entgegen seinem Operations-Plan das Sudeten-Gebirgsvorland nicht erobert.
Verhalten der sowjetischen Truppen im Kampfgebiet
Beim Einmarsch der Rotarmisten nach Schlesien kam es zu unzähligen Verbrechen aller Art gegen die Bevölkerung und die deutschen Soldaten. Neben wahllosen Morden an einzelnen Personen oder Gruppen, brutalen Vergewaltigungen und zerschossenen Flüchtlingstrecks wurden auch übermässiger Alkoholkonsum, Plünderung und sinnloses Zerstören zu Begleiterscheinungen der Sowjetsoldaten in den besetzten Gebieten. Ein zuverlässiges Bild über die Verbrechen ergab sich für die Tatorte, wo die deutschen Gegenangriffe wie z. B. im März 1945 bei Lauban und Striegau erfolgreich waren und die behördliche Ermittlungen aufgenommen wurden.

„Der ersten Staffel blieb gerade Zeit, die ‚Uhri‘ [die Uhren] und Schmückstücke einzusammeln. Die zweite Staffel hatte es weniger eilig; ihr blieb genügend Zeit, sich an die Frauen zu machen. Für die dritte Staffel gab’s weder Schmuck noch frische Frauen mehr; doch konnte sie als Nachhut, die in der Stadt zurückblieb in aller Musse ihre Koffer mit Kleidungsstücken und Stoffen vollstopfen“.
Vor allem bei den nachstossenden Schützenverbänden und bei den Sicherungseinheiten kam es zu Exzessen in den besetzten Gebieten. Viele deutsche Gegenstösse und Überraschungsangriffe waren eben deshalb erfolgreich, da es zu den Verzögerungen bei der Sicherung des Geländes seitens der plündernden oder betrunkenen sowjetischen infanteristischen Truppen kam und sie ihren Aufgaben einfach nicht nachkamen.
Die Tagesration von 100 Gramm Vodka für jeden sowjetischen Frontsoldaten spielte dabei bestimmt eine Rolle, aber auch darüber hinaus konsumierter selbstgebrannter Fusel oder erbeutete Ware. In den unzähligen kleinen Betrieben in den schlesischen Städten wurden Mengen von Alkohol erobert. Während des Kampfeinsatzes war der Alkohol offenbar vorrangig ein Problem der Infanterie. Opfer des exzessiven Alkoholgenusses waren nicht selten die sowjetischen Soldaten selbst oder die Offiziere, die Ordnung in die Einheiten, die „am Rande der Auflösung“ waren, bringen wollten.
Ob nur der exzessive Alkoholkonsum zu den Morden, Vergewaltigungen und Raub führte, bleibt umstritten. Zuerst kämpften die Soldaten noch unter der Order, Rache zu nehmen. Eine beachtliche Rolle spielten dabei die Hassgefühle auf alles Deutsche, die von der sowjetischen militärischen Presse, Front- und Truppenzeitungen stimuliert wurden. Die Vergeltung an den Deutschen war auch ein Motivationsthema der Agitatoren für die immer jüngeren Rotarmisten – bis Ende 1944 wurden fast alle Siebzehnjährigen rekrutiert. Dass die Gewalttaten aufgrund besonderer Befehle verübt wurden, hatte selbst der Bericht der Abteilung Fremde Heere Ost vom Februar 1945 widerlegt, mit der Feststellung, dass „das bestialische Verhalten einzelner Gruppen von Rotarmisten […] nicht auf den Befehl vorgesetzter Dienststellen zurückzuführen, sondern eine Folge der fanatischen Deutschenhetze in der UdSSR“ sei. In von den deutschen Einheiten erbeuteten Feldpostbriefen kam die Auffassung der Rotarmisten von der gerechten Strafe für Deutschland zur Geltung. Die meisten sowjetischen Soldaten aus den von den Deutschen zeitweilig in den Jahren 1941–1944 besetzten Gebieten waren auch selbst betroffen von den deutschen Plünderungen und Repressalien, hatten Familienangehörige durch NS-Verbrechen oder Verschleppung nach Deutschland verloren (z. B. Gen. Rybalko hatte seine Tochter 1942 in der Ukraine verloren, Oberst Dragunski seine gesamte Familie) und dadurch wurden ihre Haltungen psychologisch gefestigt. Hinzu kamen die schnelle Verrohung und Brutalisierung in den Schützenverbänden, ständige Verfügungsgewalt über die Waffe als Ursache für gewalttätige Ausschreitungen.
Ein weiteres Problem für sowjetische Kommandanten stellte die nachlassende Disziplin der Rotarmisten dar. Obwohl das Oberkommando der 1. Ukrainischen Front den Befehl zu „Massnahmen zur Wiederherstellung der Ordnung in den von unseren Truppen befreiten deutschen Gebieten“ bereits am 27. Januar erlassen hatte, gab es Verstösse gegen die Disziplin und Ordnung in Niederschlesien. Durch das rasche Vorgehen wurden viele Ortschaften in Niederschlesien ohne nennenswerte Zerstörungen besetzt, aber dann von den Rotarmisten systematisch durch Brände verwüstet. Als Beispiel kann man die Kreisstadt Liegnitz nennen: Erst nach der Kapitulation im Mai 1945 wurde infolge der „Siegesfeier“ der Besatzer die gesamte Altstadt durch die angelegten Brände zerstört. Die Zerstörungswut galt auch den historischen Objekten oder Denkmälern historischer Persönlichkeiten, aber auch Friedhöfen.
Die bisher unbekannte Fülle vorgefundener Güter und Waren sowie die Wohnverhältnisse hatten auch einen gewissen Einfluss auf die Rotarmisten ausgeübt, den sie in ihren Briefen nach Hause wiedergaben:

„Wo man Rast macht, überall in den Kellern findet man herrrliche Weine, Eingemachtes und Gebäck. Auf den Höfen treiben sich Schweine, Kühe, Hühner usw. herum. […] Wir ernähren uns sehr gut, essen zehnmal besser als die Deutschen in der Ukraine gelebt haben. Es gibt alles zu essen, es fehlt nichts. […] Ich trage Reitstiefel, habe mehr als eine Uhr und dabei keine einfachen Uhren; mit einem Wort: ich schwimme im Reichtum […]“.
Die Erklärung für den vorgefundenen Wohlstand und das hohe Lebensniveau in Deutschland hatte die Staats- und Armeeführung den eigenen Soldaten jeweils mit einem „täuschenden Trugbild einer Scheinzivilisation“ unter Betonung der Sowjetsoldaten als „Bringer der wahren Kultur“ erklärt. Dazu kam auch die Formel, dass alle Güter aus ganz Europa von den deutschen Besatzern vorher zusammengeraubt wurden. Die durch Alkohol verstärkte Hochstimmung führte zu einer Siegeseuphorie und Unbesiegbarkeitsgefühlen bei den Soldaten. Andererseits wurde der Kontrast noch durch sich abzeichnende Probleme mit der Disziplin verstärkt. Die Neigung für geplünderte deutsche Kleidungsgegenstände, Mützen und sogar komplette NS-Uniformen, die zur phantasievollen Aufmachung einiger Sowjetsoldaten führte, sahen auch die sowjetischen Kommandanten als nicht würdig. Erst später, ab April 1945 hatte die sowjetische Führung begonnen, die Disziplin unter strengere Kontrolle zu nehmen, und es gab für Vergewaltigung sogar harte Bestrafungen bis zur Exekution.
Ergebnisse
Frontverlauf
Die ursprünglichen Operationsziele von Konew wurden von der 1. Ukrainischen Front nicht erreicht. Man hatte sich aber mit dem bescheidenen Erfolg zufriedengegeben. Nun verlief die Front ab Ende Februar 1945 entlang der Linie westlich Löwenberg, nordwestlich Lauban-Rothenburg an der Neisse bis zur Mündung in die Oder und konnte bis Mitte April gehalten werden. Die Grafschaft Glatz, das Gebirgsvorland mit Waldenburg, Reichenbach, Schweidnitz, Hirschberg, Lauban, im Görlitzer Raum der schlesische Teil westlich der Lausitzer Neisse blieben bis zur Kapitulation im Mai 1945 in deutscher Hand. Auch die Bahnlinie bis nach Mährisch-Ostrau konnte weiterhin benutzt und die Versorgung aus den Industriegebieten um Rybnik, Ostrau und Waldenburg vorerst gewährleistet werden.
Die Sowjetische Armee hatte die Reichsautobahn Berlin-Breslau vollkommen unter Kontrolle und nutzte diese zur schnellen Truppenbewegung und zu Materiallieferungen an die an der Neisse stehenden Truppen als Vorbereitung für die nächste Offensive. Die Aufstellung der neuen HKL an der Neisse und nördlich der Sudeten sah das OKH unter General Guderian noch am 21. Februar 1945 nur als vorübergehend und als Ausgangspunkt für eine grosse Gegenoffensive. Die Pläne waren zu diesem Zeitpunkt völlig realitätsfern. Ein rechtzeitiges Heranschaffen der Truppen brachte zwar oft begrenzte Erfolge, für die grossen Operationen fehlte es aber an Nachschub und vor allem an Treibstoff. Die Heeresgruppe führte zwar später Anfang März 1945 erfolgreiche lokale Gegenangriffe bei Lauban und Striegau, die aber die letzten Reserven verbrauchten. Die Übermacht der sowjetischen Armee blieb trotz der Verluste weiterhin erhalten und wurde mit jedem Tag noch verstärkt. Die Eroberung von Niederschlesien war für die Rotarmisten aber keineswegs einfach. Dieser Vormarsch wird in den meisten westlichen Publikationen als eine Art von Spaziergang dargestellt oder völlig verschwiegen.
Nun erstarrte der Frontverlauf für fast zwei Monate an der westlichen Neisse. Dass seit der Konferenz von Jalta die von Stalin bevorzugte künftige westliche Grenze Polens mit dieser Frontlinie übereinstimmte, ist nicht als Zufall anzusehen. Der ursprüngliche Plan für die Grenzziehung zwischen Polen und Deutschland basierte wiederum auf der Frontlinie vor dem Beginn der niederschlesischen Operation.
Verluste
In der sowjetischen Nachkriegsliteratur wurde lange behauptet, dass die Rote Armee gegen einen zahlenmässig überlegenen Gegner gekämpft habe. Die Zahlen wurden oft nach oben hochgesetzt, um eigene Verluste oder die Kampfdauerlänge zu begründen. Die Schlachten bei Lauban oder am Bober werden in den Memoiren der sowjetischen Kommandanten in den 1980er Jahren als operative Aktionen nicht erwähnt, sondern höchstens als schwierige Durchbruchspunkte.
Bei einigen Gefechten wurden nahezu komplette sowjetische Panzerbrigaden (z. B. 61. und 63 Pz.Brig/5. Gde-Mech.Korps) von deutschen Einheiten vernichtet. Hierzu ist es schwierig, absolute Verlustzahlen der vernichteten Panzereinheiten zu nennen, da jeden Tag neue Maschinen dazu kamen, einige wurden wieder instand gesetzt und wieder andere gingen verloren.
Eine besonders kritische Situation der sowjetischen mechanisierten und gepanzerten Kräfte gab es um den 21. Februar 1945, was sogar in den sowjetischen Memoiren der damaligen Kommandanten Platz fand. Bei den Panzerbrigaden gab es hierzu 15–20 Panzer. Das 7. Gde-Pz.K. (3. Gde-PzA) verfügte an dem Tag über 55 einsatzfähige Panzer, das 9. Mech.K über 48 Panzer (im Vergl. zu der Etatzahl von 241 am Anfang der Operation). Bei der sowjetischen 4. Pz.Armee sind zwischen dem 8. und 22. Februar 257 Panzerkampfwagen (162 Т-34, 22 JS-2, 12 SU-122, 16 SU-85, 20 SU-76, 23 SU-57 und 6 «Valentine») ausgefallen. Die meisten Zerstörungen wären auf die Wirkung der Artilleriewaffen (Panzerkanonen, Pak, Artillerie) zurückzuführen. Die Verluste bei der 4. Pz.A. durch die Panzerfausteinsätze wurden nach sowjetischen Angaben mit 20 Panzern, also ca. 7,8 % der Gesamtverluste beziffert. Ähnliche Quellen meldeten bei der 3. Pz.Armee für den Zeitraum 268 verlorene Panzer, 81 Selbstfahrlafetten, 248 Kanonen und Mörser, 342 Autos und 8.736 Soldaten (davon 1.883 getötet). Die neuesten russischen Quellen geben die eigenen Verluste mit 23.577 getöteten und 75.809 verwundeten (zusammen 2,4 %) von 980.800 in der Operation beteiligten sowjetischen Soldaten an.
In der Historiografie findet man keine Gesamtzahlen der deutschen Verluste für die Zeit der Operation. Auch die Grössenangaben der beteiligten Verbände der Zeitperiode sind nicht einstimmig. Man kann nur beschränkt anwendbare Zahlen angeben, die von einigen sowjetischen Verbänden bekannt gemacht wurden. So hätte z. B. die 3. Pz.A von General Rybalko 28.500 getötete und 500 kriegsgefangene deutsche Soldaten gemeldet; 3 Panzerwagen, 80 Selbstfahrlafetten, 24 Geschütze, 205 Flugzeuge, 200 Segelflugzeuge und über 200 Autos seien erobert worden.
Die grössten Verluste hatte aber die deutsche Bevölkerung zu beklagen. Fast jeder sechste Bewohner von Schlesien zählte zu den Opfern der Kriegseinwirkung, Ermordung oder Verschleppung.